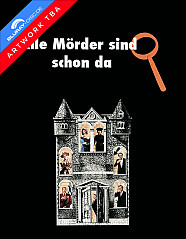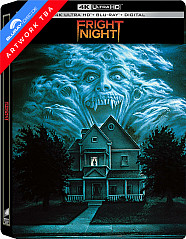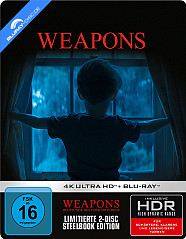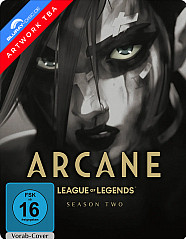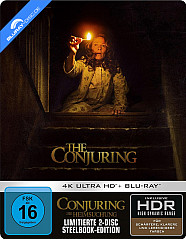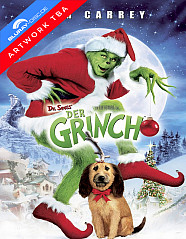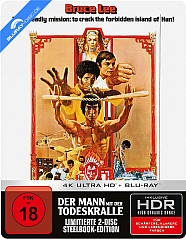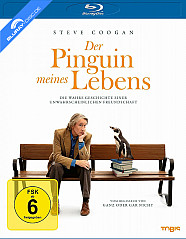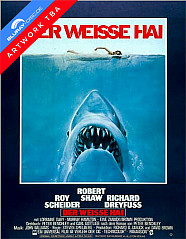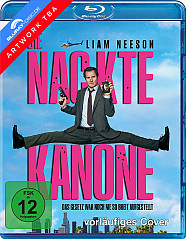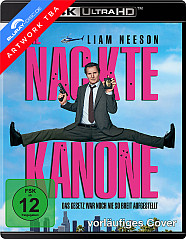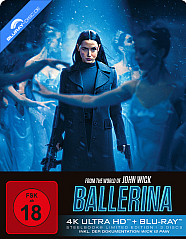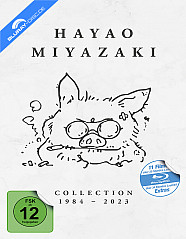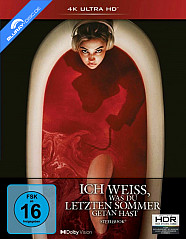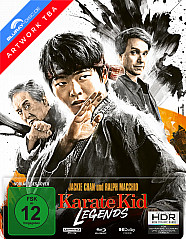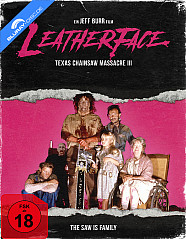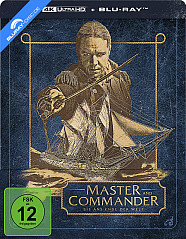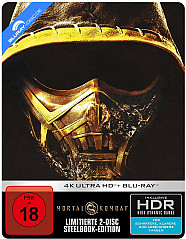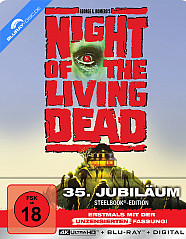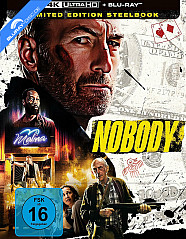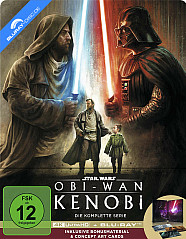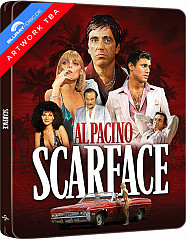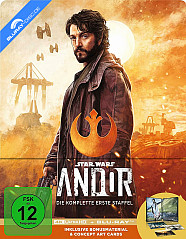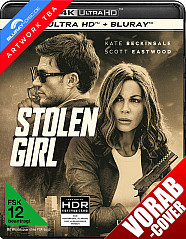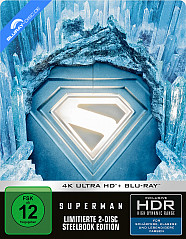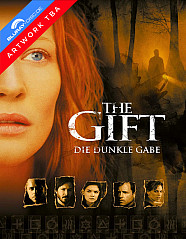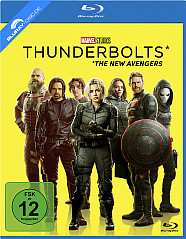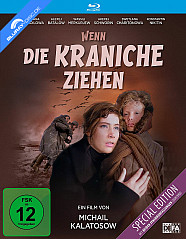"Weapons - Die Stunde des Verschwindens": Im Kino und ab 30.10. auf Blu-ray, UHD Blu-ray und im 4K-Steelbook - UPDATE 2"Mushi-Shi": Staffel Eins der Anime-Serie ab 30.10. komplett auf Blu-ray verfügbar"Alle Mörder sind schon da" auf Ultra HD Blu-ray: Deutsche 4K-Premiere erscheint im Steelbook"Sturm der Feuervögel": Ab 10. September 2025 zum ersten Mal auf Blu-ray Disc"The Monkey" auf Blu-ray und Ultra HD Blu-ray: Austauschaktion geplantPremiere: "Trigger Effect - Eine Stadt im Ausnahmezustand" von David Koepp ab 05.12. auf Blu-ray im Mediabook"Fright Night - Die rabenschwarze Nacht": Horror-Komödie ab 18.09. auf Ultra HD Blu-ray im Steelbook - UPDATE 3
NEWSTICKER
Heimkino-Steuerung mit SQ Remote & Vera lite
19. Juli 2013Hallo zusammen,
nachdem ich vor einer Weile ja bereits einmal einen Artikel über die Heimkino-Steuerung mit der Z-Wave-Fernbedienung Nevo Q50 geschrieben hatte, hat nun vor ein paar Wochen ein neues Steuerungs-System im Keller Einzug gehalten. Ein großer Schritt für mich, da ich bisher immer ein Verfechter von richtigen physikalischer Tasten war, nun aber ein iPad verwende.
Aber mal ganz von vorne. Wie die Nutzer eines iOS-Gerätes ja sicherlich wissen, verfügen diese nicht über IR-Sender, die man zur Steuerung der meisten Heimkino-Geräte aber immer noch benötigt. Nach etwas Reschersche bin ich auf die Firma Square Connect (www.squareconnect.com) gestoßen. Diese bietet auf der einen Seite eine iOS-App namens Square Remote an, auf der anderen Seite aber auch eine Box namens SQ Blaster, die sich ins selbe WLAN wie das iOS-Gerät einbucht. Sie empfängt dann per WLAN einen Tastendruck vom iPad (z.B. Play) und sendet diesen dann per IR aus.
 Die kleine Box (Kosten € 200) stellt man so auf, dass sie freie Sicht auf die zu steuernden Geräte hat. Fertig! Ab da steuert man seine Geräte über die Software SQ Remote auf dem iPad, iPhone oder iPod touch.
Die kleine Box (Kosten € 200) stellt man so auf, dass sie freie Sicht auf die zu steuernden Geräte hat. Fertig! Ab da steuert man seine Geräte über die Software SQ Remote auf dem iPad, iPhone oder iPod touch.
SQ Remote bietet zur Programmierung eine IR-Datenbank an, die von Universal Electronics lizensiert wurde. Das ist übrigens die Datenbank, auf die auch die Nevo bei der Programmierung zurückgegriffen hat. Natürlich kann man auch Befehle anlernen, die Datenbank ist aber bereits sehr mächtig.
Im Gegensatz zur Nevo kann man die Programmierung der SQ Remote aber direkt auf dem Gerät vornehmen. Die iOS-Software verfügt über einen einfach zu bedienenden Editor, mit dem man Geräte, Buttons, Makros etc. bauen kann und dann schließlich IR-Befehle auf die Buttons legt.
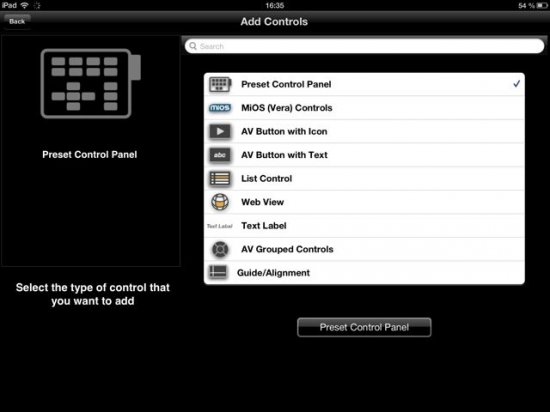
SQ Remote bietet eine Vielzahl von Buttons, Symbolen, Steuerkreuzen, Laufwerk-Steuerungs-Sets etc an, um nach Belieben ein eigenes Bedienkonzept zu bauen.
Der Ausgangspunkt von SQ Remote ist das Karussel, von dem aus man dann tiefer in die Bedienung einsteigt.
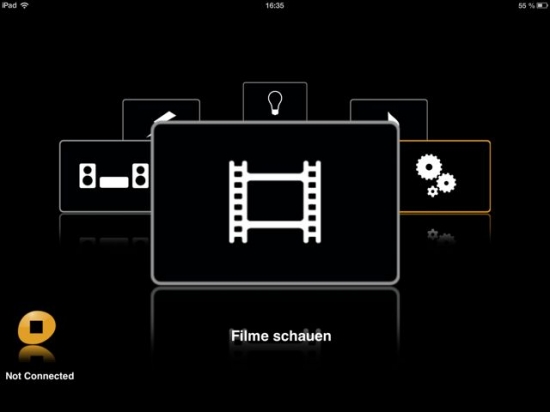
Ein Druck auf "Filme schauen" bringt einen dann (in meiner Benutzerführung) auf eine Seite, von der ich die Quelle auswähle (BD, HD-DVD, DVD). Sobald die Quelle gewählt wurde, schaltet ein Makro den Beamer, den AV-Receiver sowie die gewählte Quelle an und wählt dann den entsprechenden Eingang am AVR.
Danach kommt man dann automatisch auf die Steuerseite:

Pro Schalter im Karussel können 7 solcher Unterseiten angelegt werden. Neben reinen Steuerungsseiten mit Buttons können z.B. auch Websites eingebunden werden, z.B. die Online-Liste unserer Filmesammlung in MyMoviesPro:
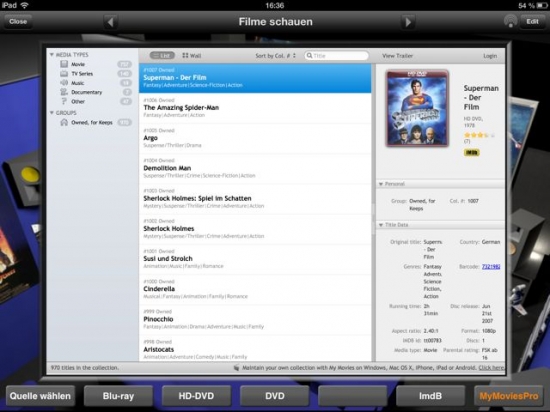
Zwischen diesen 7 Seiten (ich habe nur 6 genutzt) kann dann hin und her gesprungen werden.
Wer jetzt keine Lust hat, die ganze Programmierung auf dem iOS-Gerät durchzuführen, der kann sich für PC und Mac den SQ Designer für US$ 40 zulegen. Damit kann man dann einfach mit der Maus am Rechner alles designen und z.B. auch Buttons sehr viel genauer platzieren, als es auf dem iOS-Gerät möglich ist.
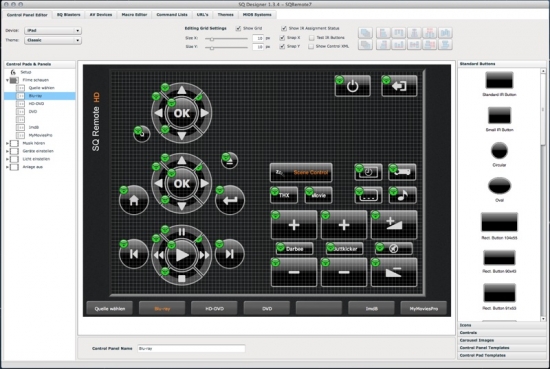
Egal, ob man nun auf iPad oder PC/Mac an der Konfiguration bastelt, sie kann auf box.com (Cloud-Speicher) abgelegt werden, sodass man auf allen Geräten immer die aktuellste Version hat.
Mit SQ Remote und dem SQ Blaster kann man nun also schon einmal die kompletten Geräte im Heimkino steuern. Aber was ist mit dem Licht? Für richtiges Kino-Feeling sollte doch bei Druck auf Play auch gleichzeitig das Licht langsam gedimmt werden. Hier kommt dann wieder Z-Wave als Funkstandard ins Spiel.
SQ Remote unterstützt nämlich das Z-Wave-Gateway Vera vom Hersteller Mi Casa Verde (www.micasaverde.com). Auch hierbei handelt es sich wieder nur um eine kleine Kiste, die ins WLAN eingebunden wird.

Mit diesem Gateway ist es dann möglich, die gesamte Elektronik im Haus von unterwegs aus zu steuern und Schaltzustände abzufragen. Das System ist sehr mächtig und unterstützt neben Lichtsteuerung auch die Abfrage von Feuer- und Wassermeldern, Bewegungssensoren und Türschlössern. Mit einem Wassermelder ist es z.B. möglich einen Alarm zu generieren. Dieser wird von Vera ausgewertet und man kann dann entscheiden, was weiter passieren soll:
- Vera soll mir eine SMS schicken
- Vera soll das Licht im Wohnzimmer blinken lassen
- Vera soll eine ebenfalls installierte Z-Wave-Sirene ansprechen
In meinem Fall geht es aber erst einmal nur um die Lichtsteuerung, außerdem habe ich einen Wassermelder installiert, da wir im Keller auch einen Waschraum haben. Sollte da mal etwas passieren, würde ich eine SMS bekommen und ich könnte dafür sorgen, dass das Wasser nicht bis in den Kinoraum vordringt.
Das Modell Vera lite (€ 160), für das ich mich entschieden habe, wird über einen Switch an einen WLAN-Router gehangen und dann per Assistent einmalig konfiguriert. Von da an kann man von jedem Rechner auf der Welt Einstellungen verändern. Es gibt auch noch das Modell Vera 3. Diese hat einen WLAN-Router direkt mit eingebaut.
Über ein einfach Web-Interface kann man dann alles einstellen:
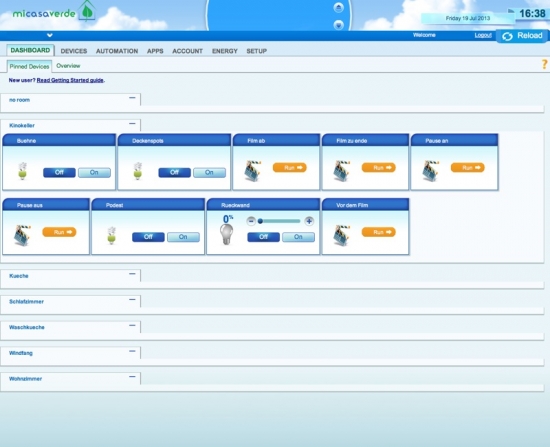
Man kann Räume anlegen, in die man dann die jeweiligen Z-Wave-Geräte ablegt. So behält man die Übersicht und kann Schritt für Schritt das ganze Haus automatisieren.
Direkt in Vera erstellt man auch die Lichtsituationen (Szenen), die definieren, was passieren sollen, wenn man z.B. während eines Films in SQ Remote auf Pause drückt. Diese Szenen werden in Vera einmal erstellt und stehen dann in SQ Remote unter den gewählten Namen zur weiteren Verwendung zur Verfügung.
Fazit: Mit der Kombination SQ Remote, SQ Blaster & Vera lite ist es mir gelungen, die komplette Steuerung des Kinokellers mit einem iPad zu bewerkstelligen. Im Gegensatz zur Nevo Q50 bietet das System noch unzählige zusätzliche Möglichkeiten, die ich Schritt für Schritt nun erforschen werde. Eine fast unerschöpfliche Spielwiese :-)
nachdem ich vor einer Weile ja bereits einmal einen Artikel über die Heimkino-Steuerung mit der Z-Wave-Fernbedienung Nevo Q50 geschrieben hatte, hat nun vor ein paar Wochen ein neues Steuerungs-System im Keller Einzug gehalten. Ein großer Schritt für mich, da ich bisher immer ein Verfechter von richtigen physikalischer Tasten war, nun aber ein iPad verwende.
Aber mal ganz von vorne. Wie die Nutzer eines iOS-Gerätes ja sicherlich wissen, verfügen diese nicht über IR-Sender, die man zur Steuerung der meisten Heimkino-Geräte aber immer noch benötigt. Nach etwas Reschersche bin ich auf die Firma Square Connect (www.squareconnect.com) gestoßen. Diese bietet auf der einen Seite eine iOS-App namens Square Remote an, auf der anderen Seite aber auch eine Box namens SQ Blaster, die sich ins selbe WLAN wie das iOS-Gerät einbucht. Sie empfängt dann per WLAN einen Tastendruck vom iPad (z.B. Play) und sendet diesen dann per IR aus.
 Die kleine Box (Kosten € 200) stellt man so auf, dass sie freie Sicht auf die zu steuernden Geräte hat. Fertig! Ab da steuert man seine Geräte über die Software SQ Remote auf dem iPad, iPhone oder iPod touch.
Die kleine Box (Kosten € 200) stellt man so auf, dass sie freie Sicht auf die zu steuernden Geräte hat. Fertig! Ab da steuert man seine Geräte über die Software SQ Remote auf dem iPad, iPhone oder iPod touch.SQ Remote bietet zur Programmierung eine IR-Datenbank an, die von Universal Electronics lizensiert wurde. Das ist übrigens die Datenbank, auf die auch die Nevo bei der Programmierung zurückgegriffen hat. Natürlich kann man auch Befehle anlernen, die Datenbank ist aber bereits sehr mächtig.
Im Gegensatz zur Nevo kann man die Programmierung der SQ Remote aber direkt auf dem Gerät vornehmen. Die iOS-Software verfügt über einen einfach zu bedienenden Editor, mit dem man Geräte, Buttons, Makros etc. bauen kann und dann schließlich IR-Befehle auf die Buttons legt.
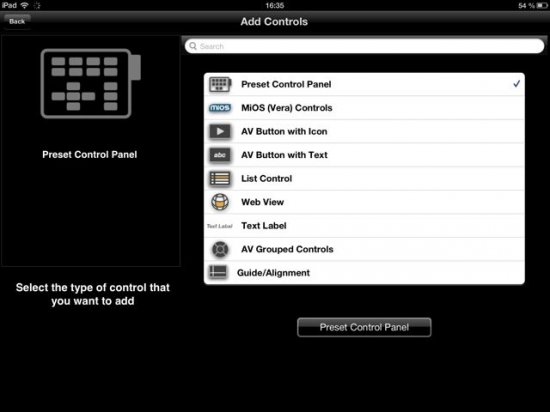
SQ Remote bietet eine Vielzahl von Buttons, Symbolen, Steuerkreuzen, Laufwerk-Steuerungs-Sets etc an, um nach Belieben ein eigenes Bedienkonzept zu bauen.
Der Ausgangspunkt von SQ Remote ist das Karussel, von dem aus man dann tiefer in die Bedienung einsteigt.
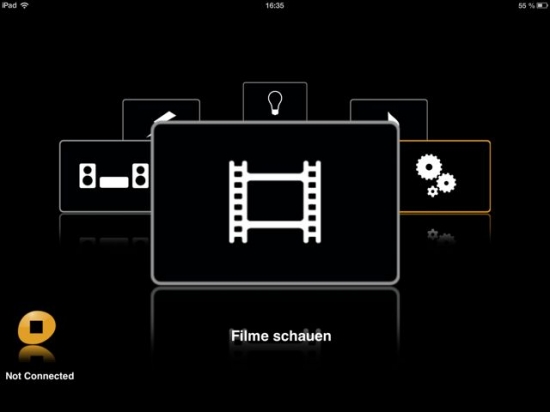
Ein Druck auf "Filme schauen" bringt einen dann (in meiner Benutzerführung) auf eine Seite, von der ich die Quelle auswähle (BD, HD-DVD, DVD). Sobald die Quelle gewählt wurde, schaltet ein Makro den Beamer, den AV-Receiver sowie die gewählte Quelle an und wählt dann den entsprechenden Eingang am AVR.
Danach kommt man dann automatisch auf die Steuerseite:

Pro Schalter im Karussel können 7 solcher Unterseiten angelegt werden. Neben reinen Steuerungsseiten mit Buttons können z.B. auch Websites eingebunden werden, z.B. die Online-Liste unserer Filmesammlung in MyMoviesPro:
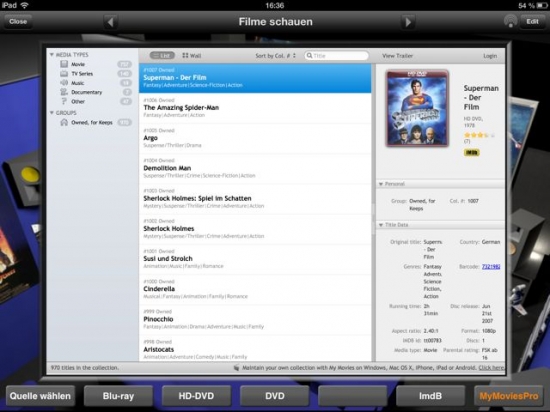
Zwischen diesen 7 Seiten (ich habe nur 6 genutzt) kann dann hin und her gesprungen werden.
Wer jetzt keine Lust hat, die ganze Programmierung auf dem iOS-Gerät durchzuführen, der kann sich für PC und Mac den SQ Designer für US$ 40 zulegen. Damit kann man dann einfach mit der Maus am Rechner alles designen und z.B. auch Buttons sehr viel genauer platzieren, als es auf dem iOS-Gerät möglich ist.
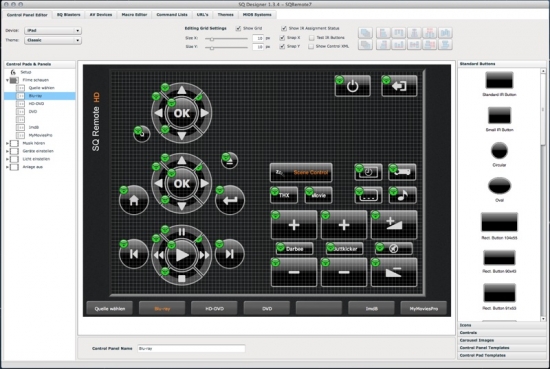
Egal, ob man nun auf iPad oder PC/Mac an der Konfiguration bastelt, sie kann auf box.com (Cloud-Speicher) abgelegt werden, sodass man auf allen Geräten immer die aktuellste Version hat.
Mit SQ Remote und dem SQ Blaster kann man nun also schon einmal die kompletten Geräte im Heimkino steuern. Aber was ist mit dem Licht? Für richtiges Kino-Feeling sollte doch bei Druck auf Play auch gleichzeitig das Licht langsam gedimmt werden. Hier kommt dann wieder Z-Wave als Funkstandard ins Spiel.
SQ Remote unterstützt nämlich das Z-Wave-Gateway Vera vom Hersteller Mi Casa Verde (www.micasaverde.com). Auch hierbei handelt es sich wieder nur um eine kleine Kiste, die ins WLAN eingebunden wird.

Mit diesem Gateway ist es dann möglich, die gesamte Elektronik im Haus von unterwegs aus zu steuern und Schaltzustände abzufragen. Das System ist sehr mächtig und unterstützt neben Lichtsteuerung auch die Abfrage von Feuer- und Wassermeldern, Bewegungssensoren und Türschlössern. Mit einem Wassermelder ist es z.B. möglich einen Alarm zu generieren. Dieser wird von Vera ausgewertet und man kann dann entscheiden, was weiter passieren soll:
- Vera soll mir eine SMS schicken
- Vera soll das Licht im Wohnzimmer blinken lassen
- Vera soll eine ebenfalls installierte Z-Wave-Sirene ansprechen
In meinem Fall geht es aber erst einmal nur um die Lichtsteuerung, außerdem habe ich einen Wassermelder installiert, da wir im Keller auch einen Waschraum haben. Sollte da mal etwas passieren, würde ich eine SMS bekommen und ich könnte dafür sorgen, dass das Wasser nicht bis in den Kinoraum vordringt.
Das Modell Vera lite (€ 160), für das ich mich entschieden habe, wird über einen Switch an einen WLAN-Router gehangen und dann per Assistent einmalig konfiguriert. Von da an kann man von jedem Rechner auf der Welt Einstellungen verändern. Es gibt auch noch das Modell Vera 3. Diese hat einen WLAN-Router direkt mit eingebaut.
Über ein einfach Web-Interface kann man dann alles einstellen:
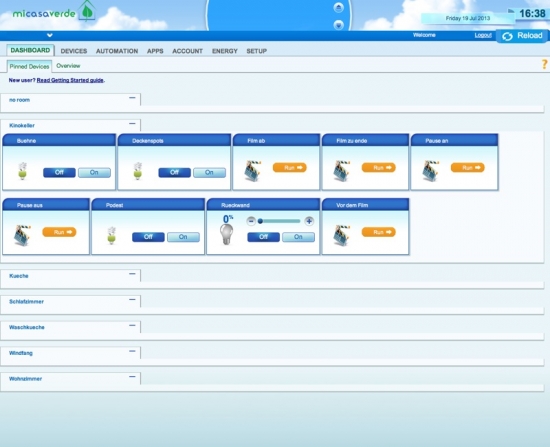
Man kann Räume anlegen, in die man dann die jeweiligen Z-Wave-Geräte ablegt. So behält man die Übersicht und kann Schritt für Schritt das ganze Haus automatisieren.
Direkt in Vera erstellt man auch die Lichtsituationen (Szenen), die definieren, was passieren sollen, wenn man z.B. während eines Films in SQ Remote auf Pause drückt. Diese Szenen werden in Vera einmal erstellt und stehen dann in SQ Remote unter den gewählten Namen zur weiteren Verwendung zur Verfügung.
Fazit: Mit der Kombination SQ Remote, SQ Blaster & Vera lite ist es mir gelungen, die komplette Steuerung des Kinokellers mit einem iPad zu bewerkstelligen. Im Gegensatz zur Nevo Q50 bietet das System noch unzählige zusätzliche Möglichkeiten, die ich Schritt für Schritt nun erforschen werde. Eine fast unerschöpfliche Spielwiese :-)
Antec AV Cooler - Hifi-Komponenten-Lüfter aus den USA
15. Juni 2013Hallo zusammen,
nachdem ich vor 2 Wochen einen neuen Onkyo TX-NR3010 bekommen habe, machte ich mir Gedanken darüber, wie man ihn vernünftig kühlen kann. Es wird ja in vielen Foren darüber diskutiert, dass die großen Onkyos ziemlich warm werden und obwohl er bei mir ganz oben im Rack steht, sollte noch eine zusätzliche Kühlung her.
Bei der Lektüre des AVSForums wurde ich schließlich auf ein Gerät namens Antec AV Cooler aufmerksam. Das ist im Grunde genommen ein umgedrehter Laptop-Kühler, den man auf das zu kühlende Gerät legt. Kurzentschlossen habe ich ihn mir einfach mal bei Amazon in den USA bestellt.

Der AV Cooler an sich ist aus Plastik, aber die Oberseite ist aus dünnem Aluminium und lässt das Gerät durchaus wertig aussehen. Maße sind 36cm Tiefe, 42,9cm Breite und 4,6cm Höhe. An der Front befindet sich ein kleiner Schalter, mit dem man den AV Cooler abschalten oder zwei Gebläsestufen (Low & High) wählen kann. Eingeschaltet leuchtet eine (leider recht helle) blaue LED-Leiste.
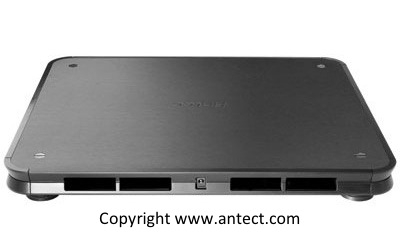
Auf der Rückseite findet man den Anschluss für das mitgelieferte internationale Netzteil (110 bis 240 V) und zwei Lüftungsauslässe.

Auf der Unterseite sieht man die beiden Lüfter und vier mit Gummi versehene Füße.
Der Einsatz ist nun ganz einfach: man legt den AV Cooler auf seinen AV-Receiver, schließt das Netzteil an und schaltet ihn ein. Fertig.
Wie viele von euch wissen, werden die Onkyo AVRs ja gerade hinten rechts am HDMI-Board heiß. Das ist beim 3010 auch so und zwar obwohl er bei mir zu allen Seiten frei steht. Durch den Einsatz des AV Cooler in Stellung "Low" bleibt der 3010 nun wesentlich kühler. Sicherlich ist es immer so eine Sache, wenn man über Temperaturen spricht und diese nicht mit Messergebnissen belegen kann. Ich kann hier leider nur meine persönliche Empfindung als Beleg anbringen: Wenn ich nach zwei Stunden Film den AV Cooler anhebe und fühle, dann kann ich meine Hand gut auf den AVR legen. Läuft der AVR ohne den AV Cooler weiter, dann merkt man förmlich wie innerhalb von Minuten die Temperatur wieder stark zunimmt. Also: Ziel erfüllt!
Wie sieht es nun mit der Lautstärke des AV Cooler aus? Schließlich arbeitet er mit 2 Lüftern. In der Stellung "Low" hört man ihn in einem komplett stillen Raum nur so lange, bis der erste leise Ton aus den Lautsprechen erklingt. Danach ist Ruhe. Wenn man einen Beamer verwendet, dann wird man den AV Cooler erst gar nicht hören (zumindest nicht, wenn mein im Eco-Modus sehr leiser Sanyo PLV-Z4000 läuft). In Stellung "High" ist er dann doch deutlich hörbar, mehr Lüfterleistung ist natürlich lauter, in meinem Fall reicht aber zum Glück Low aus.
Fazit: Lohnt sich der Antec AV Cooler?
Ich würde sagen, wenn jemand auf der Suche nach einer attraktiven und effektiven Lüfterlösung für den AVR ist, dann macht man mit dem Antec AV Cooler nichts verkehrt. Sicherlich bekommt man Selbstbaulösungen günstiger, aber die sehen dann meistens nicht so gut aus.
Apropos "billiger": Der Antec AV Cooler kostet, wenn man ihn bei Amazon US bestellt, inkl. Versand und Zoll € 70.
www.amazon.com/Antec-Profile-Component-Theater-Products/dp/B000QJ4ZE2/ref=sr_1_1
nachdem ich vor 2 Wochen einen neuen Onkyo TX-NR3010 bekommen habe, machte ich mir Gedanken darüber, wie man ihn vernünftig kühlen kann. Es wird ja in vielen Foren darüber diskutiert, dass die großen Onkyos ziemlich warm werden und obwohl er bei mir ganz oben im Rack steht, sollte noch eine zusätzliche Kühlung her.
Bei der Lektüre des AVSForums wurde ich schließlich auf ein Gerät namens Antec AV Cooler aufmerksam. Das ist im Grunde genommen ein umgedrehter Laptop-Kühler, den man auf das zu kühlende Gerät legt. Kurzentschlossen habe ich ihn mir einfach mal bei Amazon in den USA bestellt.

Der AV Cooler an sich ist aus Plastik, aber die Oberseite ist aus dünnem Aluminium und lässt das Gerät durchaus wertig aussehen. Maße sind 36cm Tiefe, 42,9cm Breite und 4,6cm Höhe. An der Front befindet sich ein kleiner Schalter, mit dem man den AV Cooler abschalten oder zwei Gebläsestufen (Low & High) wählen kann. Eingeschaltet leuchtet eine (leider recht helle) blaue LED-Leiste.
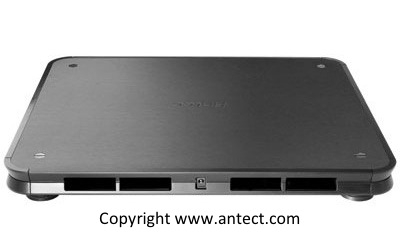
Auf der Rückseite findet man den Anschluss für das mitgelieferte internationale Netzteil (110 bis 240 V) und zwei Lüftungsauslässe.

Auf der Unterseite sieht man die beiden Lüfter und vier mit Gummi versehene Füße.
Der Einsatz ist nun ganz einfach: man legt den AV Cooler auf seinen AV-Receiver, schließt das Netzteil an und schaltet ihn ein. Fertig.
Wie viele von euch wissen, werden die Onkyo AVRs ja gerade hinten rechts am HDMI-Board heiß. Das ist beim 3010 auch so und zwar obwohl er bei mir zu allen Seiten frei steht. Durch den Einsatz des AV Cooler in Stellung "Low" bleibt der 3010 nun wesentlich kühler. Sicherlich ist es immer so eine Sache, wenn man über Temperaturen spricht und diese nicht mit Messergebnissen belegen kann. Ich kann hier leider nur meine persönliche Empfindung als Beleg anbringen: Wenn ich nach zwei Stunden Film den AV Cooler anhebe und fühle, dann kann ich meine Hand gut auf den AVR legen. Läuft der AVR ohne den AV Cooler weiter, dann merkt man förmlich wie innerhalb von Minuten die Temperatur wieder stark zunimmt. Also: Ziel erfüllt!
Wie sieht es nun mit der Lautstärke des AV Cooler aus? Schließlich arbeitet er mit 2 Lüftern. In der Stellung "Low" hört man ihn in einem komplett stillen Raum nur so lange, bis der erste leise Ton aus den Lautsprechen erklingt. Danach ist Ruhe. Wenn man einen Beamer verwendet, dann wird man den AV Cooler erst gar nicht hören (zumindest nicht, wenn mein im Eco-Modus sehr leiser Sanyo PLV-Z4000 läuft). In Stellung "High" ist er dann doch deutlich hörbar, mehr Lüfterleistung ist natürlich lauter, in meinem Fall reicht aber zum Glück Low aus.
Fazit: Lohnt sich der Antec AV Cooler?
Ich würde sagen, wenn jemand auf der Suche nach einer attraktiven und effektiven Lüfterlösung für den AVR ist, dann macht man mit dem Antec AV Cooler nichts verkehrt. Sicherlich bekommt man Selbstbaulösungen günstiger, aber die sehen dann meistens nicht so gut aus.
Apropos "billiger": Der Antec AV Cooler kostet, wenn man ihn bei Amazon US bestellt, inkl. Versand und Zoll € 70.
www.amazon.com/Antec-Profile-Component-Theater-Products/dp/B000QJ4ZE2/ref=sr_1_1
Bildverbesserung mit dem Darbee Darblet DVP5000?
9. März 2013Hallo zusammen,
nachdem ich bereits im letzten Jahr in verschiedenen amerikanischen Publikationen Werbung für einem Bildverbesserer namens Darbee Darblet gelesen hatte, weckten Testberichte in Magazinen wie Home Theater, Home Cinema Choice und Widescreen Review mein Interesse. Im Januar bestellte ich mir die kleine Kiste, um selbst zu schauen, was denn nun hinter den positiven Berichten steckt.

Was wird versprochen?
Was soll das Darbee Darblet nun machen? Ohne jetzt technisch zu werden: es soll Bildsignalen von DVD und BD mehr Tiefe, Schärfe und Durchzeichnung geben. Genau das versprechen ja auch zahlreiche Schaltungen, die bereits im Player, AV-Receiver und/oder Beamer/TV eingebaut sind. Wozu also den Darbee kaufen? Schauen wir mal!
Was bekommt man für sein Geld?
Rein optisch macht die kleine Kiste, die in etwa die Größe eines iPhones hat (aber etwas doppelt so dick ist), nicht viel her. Sie hat einen Anschluss für ein mitgeliefertes Netzteil sowie jeweils einen HDMI-Ein- und Ausgang nach HDMI 1.4 Spezifkation. Ansonsten befinden sich 4 kleine Knöpfe an der Front und ein paar Kontrolllämpchen. Mit in der Box ist außerdem noch eine kleine Fernbedienung im Kreditkarten-Format.
Wie sieht das nun in der Praxis aus?
Nun, aus meiner Erfahrung heraus erkauft man sich z.B. zusätzliche Schärfe bei Nutzung des entsprechenden Reglers im Player nicht ohne Nachteile. Es erscheinen z.B. Doppelkonturen, die das Endergebnis verunstalten. Zusätzliche Durchzeichnung in dunklen Szenen endet oft in überstrahlenden hellen Szenen.
Hier setzt nun der Darbee an. Er fügt durch die Nutzung verschiedener Algorythmen in Echtzeit eben diese Aspekte dem Bild hinzu und zwar OHNE unerwünschte Artefakte, was zumindest bei maßvoller Benutzung der Regler des Darbee auch sehr gut klappt.
Generell kann man den Darbee-Effekt zwischen 0 und 100 % einstellen. Ich habe ihn z.B. auf 60% eingestellt. Hier ist der Effekt deutlich zu erkennen, wirkt aber nicht künstlich.
Wie sieht das denn nun aus?
Wie man sich das vorstellen muss, sieht man hier (Bilder von der Darbee-Website):
Ohne Darbee

Mit Darbee

Das untere Bild wirkt "knackiger" und irgendwie dreidimensionaler, ohne jedoch unnatürlich zu werden.
Hier noch zwei Beispiele:
Ohne Darbee

Mit Darbee

Auch hier wirkt das bearbeitet Bild deutlich detaillierter.
Also nur Vorteile und keine Nachteile?
Es fällt auf, dass der Darbee das Bild umso mehr verbessert, je besser das Ursprungsmaterial ist. Das bedeutet leider auch, dass verrauschte DVDs nicht wirklich vom Darbee profitieren, da in diesem Fall z.B. Rauschn besonders "fein" herausgearbeitet wird. Hier ist sollte man den Darbee dann also besser abschalten (ein Druck auf die Fernbedienung). Bei BDs aber holt der Darbee erstaunlich viel aus dem Quellmaterial raus.
Originalgetreue Wiedergabe vs Darbee
Jetzt kann man natürlich einwenden, dass das, was der Darbee da macht, doch nichts mehr mit naturgetreuer Wiedergabe zu tun hat. Wenn ein Beamer einmal perfekt kalibriert ist, dann holt man doch das Optimum aus jeder Quelle heraus.
Wer diesen puristischen Ansatz verfolgt, für den ist der Darbee sicherlich nichts.
Ich für meinen Teil habe Gamma und Graustufen meines PLV-Z4000 mit Color HFR kalibriert und war eigentlich auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Trotzdem möchte ich das Plus an "Lebendigkeit", das der Darbee dem Bild hinzufügt, nicht mehr missen. Ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass mir das Bild ohne den Darbee fast schon defokussiert vorkommt. Es wirkt ohne Darbee so, als ob ich meine Brille nicht auf der Nase hätte. Ok, das ist vielleicht etwas extrem, aber es geht schon in die Richtung.
Eine Kalibrierung macht der Darbee also nicht überflüssig, man sollte ihn vielmehr zusätzlich zu dieser einsetzen.
Was kostet der Spaß?
Bisher hatte ich zum Preis nichts geschrieben und ich habe mich selbst ein paar Wochen gefragt, ob das, was der Darbee macht, seinen Preis wert ist. Wir reden hier, je nachdem, wo man das Gerät kauft, von € 280 bis 330.
Mein persönliches Fazit lautet mittlerweile:
Ja, das ist es mir persönlich wert!
Aber sicherlich muss das jeder für sich selbst entscheiden. Einen Versuch ist der Darbee aber auf jeden Fall wert.
Viele Grüße
Markus
nachdem ich bereits im letzten Jahr in verschiedenen amerikanischen Publikationen Werbung für einem Bildverbesserer namens Darbee Darblet gelesen hatte, weckten Testberichte in Magazinen wie Home Theater, Home Cinema Choice und Widescreen Review mein Interesse. Im Januar bestellte ich mir die kleine Kiste, um selbst zu schauen, was denn nun hinter den positiven Berichten steckt.

Was wird versprochen?
Was soll das Darbee Darblet nun machen? Ohne jetzt technisch zu werden: es soll Bildsignalen von DVD und BD mehr Tiefe, Schärfe und Durchzeichnung geben. Genau das versprechen ja auch zahlreiche Schaltungen, die bereits im Player, AV-Receiver und/oder Beamer/TV eingebaut sind. Wozu also den Darbee kaufen? Schauen wir mal!
Was bekommt man für sein Geld?
Rein optisch macht die kleine Kiste, die in etwa die Größe eines iPhones hat (aber etwas doppelt so dick ist), nicht viel her. Sie hat einen Anschluss für ein mitgeliefertes Netzteil sowie jeweils einen HDMI-Ein- und Ausgang nach HDMI 1.4 Spezifkation. Ansonsten befinden sich 4 kleine Knöpfe an der Front und ein paar Kontrolllämpchen. Mit in der Box ist außerdem noch eine kleine Fernbedienung im Kreditkarten-Format.
Wie sieht das nun in der Praxis aus?
Nun, aus meiner Erfahrung heraus erkauft man sich z.B. zusätzliche Schärfe bei Nutzung des entsprechenden Reglers im Player nicht ohne Nachteile. Es erscheinen z.B. Doppelkonturen, die das Endergebnis verunstalten. Zusätzliche Durchzeichnung in dunklen Szenen endet oft in überstrahlenden hellen Szenen.
Hier setzt nun der Darbee an. Er fügt durch die Nutzung verschiedener Algorythmen in Echtzeit eben diese Aspekte dem Bild hinzu und zwar OHNE unerwünschte Artefakte, was zumindest bei maßvoller Benutzung der Regler des Darbee auch sehr gut klappt.
Generell kann man den Darbee-Effekt zwischen 0 und 100 % einstellen. Ich habe ihn z.B. auf 60% eingestellt. Hier ist der Effekt deutlich zu erkennen, wirkt aber nicht künstlich.
Wie sieht das denn nun aus?
Wie man sich das vorstellen muss, sieht man hier (Bilder von der Darbee-Website):
Ohne Darbee

Mit Darbee

Das untere Bild wirkt "knackiger" und irgendwie dreidimensionaler, ohne jedoch unnatürlich zu werden.
Hier noch zwei Beispiele:
Ohne Darbee

Mit Darbee

Auch hier wirkt das bearbeitet Bild deutlich detaillierter.
Also nur Vorteile und keine Nachteile?
Es fällt auf, dass der Darbee das Bild umso mehr verbessert, je besser das Ursprungsmaterial ist. Das bedeutet leider auch, dass verrauschte DVDs nicht wirklich vom Darbee profitieren, da in diesem Fall z.B. Rauschn besonders "fein" herausgearbeitet wird. Hier ist sollte man den Darbee dann also besser abschalten (ein Druck auf die Fernbedienung). Bei BDs aber holt der Darbee erstaunlich viel aus dem Quellmaterial raus.
Originalgetreue Wiedergabe vs Darbee
Jetzt kann man natürlich einwenden, dass das, was der Darbee da macht, doch nichts mehr mit naturgetreuer Wiedergabe zu tun hat. Wenn ein Beamer einmal perfekt kalibriert ist, dann holt man doch das Optimum aus jeder Quelle heraus.
Wer diesen puristischen Ansatz verfolgt, für den ist der Darbee sicherlich nichts.
Ich für meinen Teil habe Gamma und Graustufen meines PLV-Z4000 mit Color HFR kalibriert und war eigentlich auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Trotzdem möchte ich das Plus an "Lebendigkeit", das der Darbee dem Bild hinzufügt, nicht mehr missen. Ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass mir das Bild ohne den Darbee fast schon defokussiert vorkommt. Es wirkt ohne Darbee so, als ob ich meine Brille nicht auf der Nase hätte. Ok, das ist vielleicht etwas extrem, aber es geht schon in die Richtung.
Eine Kalibrierung macht der Darbee also nicht überflüssig, man sollte ihn vielmehr zusätzlich zu dieser einsetzen.
Was kostet der Spaß?
Bisher hatte ich zum Preis nichts geschrieben und ich habe mich selbst ein paar Wochen gefragt, ob das, was der Darbee macht, seinen Preis wert ist. Wir reden hier, je nachdem, wo man das Gerät kauft, von € 280 bis 330.
Mein persönliches Fazit lautet mittlerweile:
Ja, das ist es mir persönlich wert!
Aber sicherlich muss das jeder für sich selbst entscheiden. Einen Versuch ist der Darbee aber auf jeden Fall wert.
Viele Grüße
Markus
Subwoofer-Position mit Stereoplay RaumRechenService optimieren
12. August 2012Hallo zusammen,
seitdem wir vor zwei Jahren nach dem Krefeld gezogen sind und ich meinen neuen Kino-Keller "bezogen" habe, war ich immer auf der Suche nach er optimalen Position für meinen Subwoofer Klipsch RT-10D. Der ist dazu gedacht, in eine Raumecke gestellt zu werden und kompensiert dabei möglicherweise entstehendes Dröhnen mit einem eingebauten Einmesssystem.
Tolle Sache an sich, aber leider ist ja ein potenter Subwoofer nur die halbe Miete wenn es darum geht, im Kino einen guten (sprich: tiefen, knackigen, sauberen) Bass zu erzielen. Viel wichtiger ist, dass die Kombination aus Stellplatz des Subwoofers und Hörplatz harmonieren. Wenn diese beiden Faktoren nicht zusammenpassen, dann kann selbst der beste Subwoofer keine Wunder bewirken und läuft nur auf Sparflamme.
Beide Faktoren (Subwoofer-Stellplatz und Hörplatz) waren bisher in meinem Raum weitgehend festgelegt, sodass ich gerade mal die Möglichkeit hatte, den Subwoofer ein wenig hin und her zu verschieben. Dabei gab es dann z.B. im Tiefbass leichte Verbesserungen, gleichzeitig erkaufte ich mir dann aber starke Einbrüche z.B. bei 100 Hz. Außerdem hörte sich der Bass auf jedem Platz unseres Sofas unterschiedlich an.
Was auch immer ich anstellte, der RT-10D klang im neuen Keller einfach nicht so gut wie damals im Keller in Oberhausen. Ich wusste, was der Subwoofer in der Lage ist zu leisten und es frustrierte mich, dass ich das nun nicht mehr auskosten kann.
Es musste etwas geschehen und vor ein paar Wochen stieß ich dann auf den
RaumRechenService des Magazins "Stereoplay"
www.stereoplay.de/tool-lautsprecher-rechner-751234.html
Der RaumRechenService ist ein Online-Tool, das im Webbrowser läuft. Man gibt die Maße des eigenen Raums ein, kann auch relativ genau Boden- und Wandbeläge sowie Möblierung wählen.
Danach legt man die bevorzugte Hörposition fest und wählt aus einer Lautsprecherdatenbank entweder seine eigenen Lautsprecher (wenn vorhanden) oder welche, die ihnen vom Frequenzgang her nahe kommen, aus.
Sobald man das getan hat, zeigt einem der RaumRechenService folgende Informationen an:
- Den Frequenzgang des Subwoofers am gewählten Hörplatz
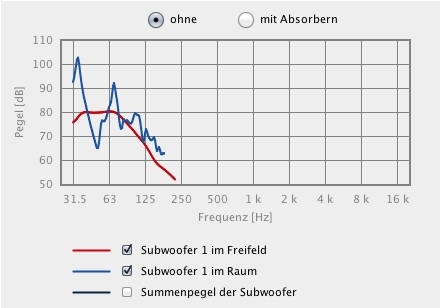
- Eine grafisch dargestellte Übersicht der akustischen Situation des Raums
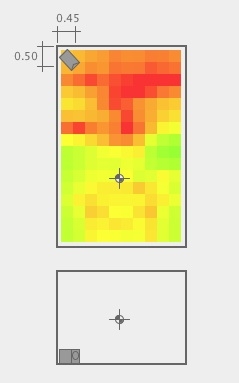
Frequenzgang des Subwoofers am Hörplatz
Hier wird nun genau das dargestellt, was ich eingangs schon beschrieben hatte: Der Einfluss von Hörplatz und Subwoofer-Position auf die Qualität des Klangs. Wenn man Subwoofer und Hörplatz in der bunten "Raumübersicht" verändert, dann kann man sehen, welchen Einfluss dies auf den Frequenzgang des Subwoofers bezogen auf den Hörplatz hat. Das ist die blaue Kurve. Zum Vergleich wird auch noch eine rote Kurve angezeigt, die angibt, welchen Frequenzgang des Subwoofer ohne den Einfluss des Raumes hat. Dies ist quasi der ideale Frequenzgang, der aber in einem Raum nie erreicht werden wird.
Akustische Situation des Raums bezogen auf den Hörplatz
Die bunte Raumübersicht gibt mit ihren Farben nun an, an welchen Positionen im Raum bezogen auf die gerade gewählte Hörposition der Subwoofer am besten aufgestellt werden sollte. Gute Positionen werden hierbei grün dargestellt.
Und so sieht es in meinem Keller aus:
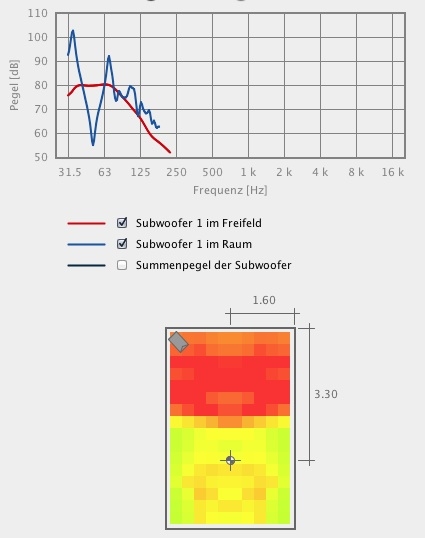
Hier sieht man dann auch schon das Dilemma in meinem Keller. Mein Subwoofer steht vorne links in einem ungünstigen roten Bereich, was mir eine sehr starke Erhöhung (Dröhnen) bei 35 Hz einbringt und einen starken Abfall bei ca. 50 Hz.
Was ändert sich, wenn der Subwoofer auf "grün" steht?
Hinten links und rechts sieht es aber farblich gut aus. Mal schauen, wie sich der Frequenzgang verändert, wenn ich den Subwoofer dorthin verschiebe:
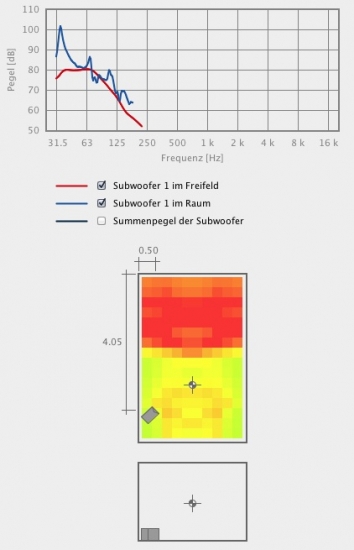
Und siehe da, das sieht schon viel besser aus. Es ist zwar immer noch eine Überhöhung bei 35 Hz vorhanden, diese kann aber per Einmesssystem des Receivers, eines Subwoofers oder mit einem AntiMode-Einmesssysten kompensiert werden. Danach liegt der Frequenzgang des Subwoofers aber wirklich nah an der roten Ideallinie und der Abfall bei ca. 50 Hz ist auch verschwunden.
Da mein Klipsch RT-10D dort aber nicht hinpasste, habe ich mir nun zwei kleinere Klipsch RW-10D geholt, einen für jede Seite:
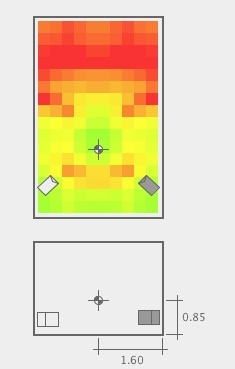
Das Ergebnis ist eine ungemein gleichmäßige Basswiedergabe auf der gesamten Breite des Sofas. Gerade bei Musik macht sich jetzt bemerkbar, wie "knackig" Bass auch bei uns im Keller sein kann. Eine Messung mit Room EQ Wizard bestätigt einen Frequenzgang, der zwischen 25 und 100 Hz nur im Bereich von maximal +- 3dB variiert. Das ist ein wirklich gutes Ergebnis.
Fazit: Der RaumRechenService der Stereoplay ist meiner Ansicht nach ein tolles Tool, um auf die Schnelle einfach mal zu schauen, wo sich im eigenen Raum etwas gut anhört und wo nicht. Einziger Nachteil ist, dass der Rechner nur für rechtwinklige Räume funktioniert. Ich habe zwar auch im vorderen Bereich des Raums eine 2qm große Nische. DIese kann aber vernachlässigt werden, da die neuen Subwoofer-Positionen im hinteren Bereich des Raums liegen und dieser ist symetrisch.
Da die Nutzung des RechenServices nichts kostet, kann ich nur jedem raten, ihn einmal auszuprobieren.
Viele Grüße
Markus
seitdem wir vor zwei Jahren nach dem Krefeld gezogen sind und ich meinen neuen Kino-Keller "bezogen" habe, war ich immer auf der Suche nach er optimalen Position für meinen Subwoofer Klipsch RT-10D. Der ist dazu gedacht, in eine Raumecke gestellt zu werden und kompensiert dabei möglicherweise entstehendes Dröhnen mit einem eingebauten Einmesssystem.
Tolle Sache an sich, aber leider ist ja ein potenter Subwoofer nur die halbe Miete wenn es darum geht, im Kino einen guten (sprich: tiefen, knackigen, sauberen) Bass zu erzielen. Viel wichtiger ist, dass die Kombination aus Stellplatz des Subwoofers und Hörplatz harmonieren. Wenn diese beiden Faktoren nicht zusammenpassen, dann kann selbst der beste Subwoofer keine Wunder bewirken und läuft nur auf Sparflamme.
Beide Faktoren (Subwoofer-Stellplatz und Hörplatz) waren bisher in meinem Raum weitgehend festgelegt, sodass ich gerade mal die Möglichkeit hatte, den Subwoofer ein wenig hin und her zu verschieben. Dabei gab es dann z.B. im Tiefbass leichte Verbesserungen, gleichzeitig erkaufte ich mir dann aber starke Einbrüche z.B. bei 100 Hz. Außerdem hörte sich der Bass auf jedem Platz unseres Sofas unterschiedlich an.
Was auch immer ich anstellte, der RT-10D klang im neuen Keller einfach nicht so gut wie damals im Keller in Oberhausen. Ich wusste, was der Subwoofer in der Lage ist zu leisten und es frustrierte mich, dass ich das nun nicht mehr auskosten kann.
Es musste etwas geschehen und vor ein paar Wochen stieß ich dann auf den
RaumRechenService des Magazins "Stereoplay"
www.stereoplay.de/tool-lautsprecher-rechner-751234.html
Der RaumRechenService ist ein Online-Tool, das im Webbrowser läuft. Man gibt die Maße des eigenen Raums ein, kann auch relativ genau Boden- und Wandbeläge sowie Möblierung wählen.
Danach legt man die bevorzugte Hörposition fest und wählt aus einer Lautsprecherdatenbank entweder seine eigenen Lautsprecher (wenn vorhanden) oder welche, die ihnen vom Frequenzgang her nahe kommen, aus.
Sobald man das getan hat, zeigt einem der RaumRechenService folgende Informationen an:
- Den Frequenzgang des Subwoofers am gewählten Hörplatz
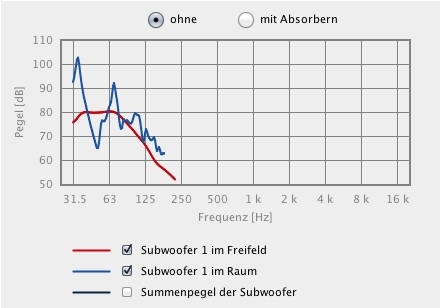
- Eine grafisch dargestellte Übersicht der akustischen Situation des Raums
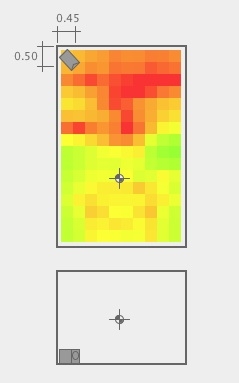
Frequenzgang des Subwoofers am Hörplatz
Hier wird nun genau das dargestellt, was ich eingangs schon beschrieben hatte: Der Einfluss von Hörplatz und Subwoofer-Position auf die Qualität des Klangs. Wenn man Subwoofer und Hörplatz in der bunten "Raumübersicht" verändert, dann kann man sehen, welchen Einfluss dies auf den Frequenzgang des Subwoofers bezogen auf den Hörplatz hat. Das ist die blaue Kurve. Zum Vergleich wird auch noch eine rote Kurve angezeigt, die angibt, welchen Frequenzgang des Subwoofer ohne den Einfluss des Raumes hat. Dies ist quasi der ideale Frequenzgang, der aber in einem Raum nie erreicht werden wird.
Akustische Situation des Raums bezogen auf den Hörplatz
Die bunte Raumübersicht gibt mit ihren Farben nun an, an welchen Positionen im Raum bezogen auf die gerade gewählte Hörposition der Subwoofer am besten aufgestellt werden sollte. Gute Positionen werden hierbei grün dargestellt.
Und so sieht es in meinem Keller aus:
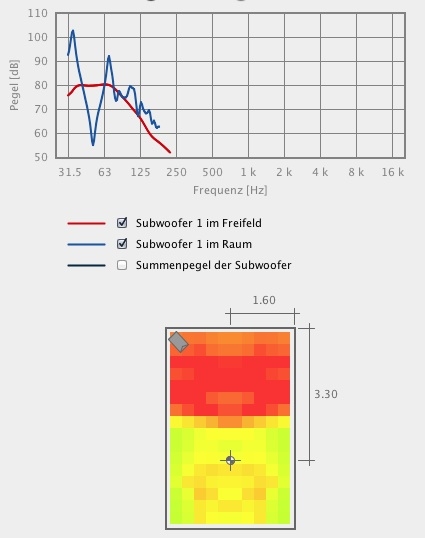
Hier sieht man dann auch schon das Dilemma in meinem Keller. Mein Subwoofer steht vorne links in einem ungünstigen roten Bereich, was mir eine sehr starke Erhöhung (Dröhnen) bei 35 Hz einbringt und einen starken Abfall bei ca. 50 Hz.
Was ändert sich, wenn der Subwoofer auf "grün" steht?
Hinten links und rechts sieht es aber farblich gut aus. Mal schauen, wie sich der Frequenzgang verändert, wenn ich den Subwoofer dorthin verschiebe:
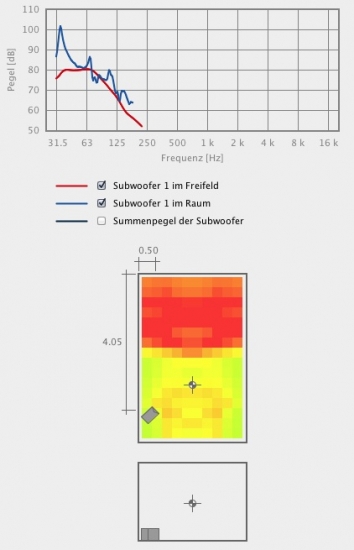
Und siehe da, das sieht schon viel besser aus. Es ist zwar immer noch eine Überhöhung bei 35 Hz vorhanden, diese kann aber per Einmesssystem des Receivers, eines Subwoofers oder mit einem AntiMode-Einmesssysten kompensiert werden. Danach liegt der Frequenzgang des Subwoofers aber wirklich nah an der roten Ideallinie und der Abfall bei ca. 50 Hz ist auch verschwunden.
Da mein Klipsch RT-10D dort aber nicht hinpasste, habe ich mir nun zwei kleinere Klipsch RW-10D geholt, einen für jede Seite:
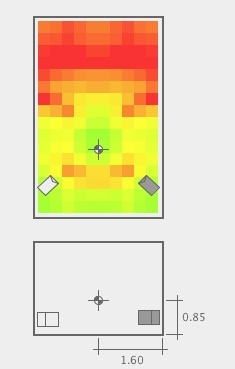
Das Ergebnis ist eine ungemein gleichmäßige Basswiedergabe auf der gesamten Breite des Sofas. Gerade bei Musik macht sich jetzt bemerkbar, wie "knackig" Bass auch bei uns im Keller sein kann. Eine Messung mit Room EQ Wizard bestätigt einen Frequenzgang, der zwischen 25 und 100 Hz nur im Bereich von maximal +- 3dB variiert. Das ist ein wirklich gutes Ergebnis.
Fazit: Der RaumRechenService der Stereoplay ist meiner Ansicht nach ein tolles Tool, um auf die Schnelle einfach mal zu schauen, wo sich im eigenen Raum etwas gut anhört und wo nicht. Einziger Nachteil ist, dass der Rechner nur für rechtwinklige Räume funktioniert. Ich habe zwar auch im vorderen Bereich des Raums eine 2qm große Nische. DIese kann aber vernachlässigt werden, da die neuen Subwoofer-Positionen im hinteren Bereich des Raums liegen und dieser ist symetrisch.
Da die Nutzung des RechenServices nichts kostet, kann ich nur jedem raten, ihn einmal auszuprobieren.
Viele Grüße
Markus
Raum-Design mit Sweet Home 3D
6. Mai 2012Guten Morgen zusammen,
da ich in den letzten zwei Wochen extrem viele Anfragen bekommen habe, in denen es darum ging, mit welcher Software ich die 3D-Ansichten unseres Kellers erstellt habe, möchte ich heute einen kleinen Einblick in den kostenlosen Raum-Designer Sweet Home 3D geben.
Mit Sweet Home 3D kann man auf relativ einfach Art und Weise Räume (sogar ganze Häuser) nachbauen und diese dann virtuell begehen oder hochwertige Bilder mit frei wählbaren Perspektiven rendern lassen (das sind dann die Bilder, die es in meiner Galerie zu bewundern gibt).
Aber wie funktioniert das alles?
Zuerst lädt man sich unter www.sweethome3d.com/de/index.jsp das Programm für entweder für Windows, Linux oder Mac OS (das ist die Version, die ich verwende) herunter.
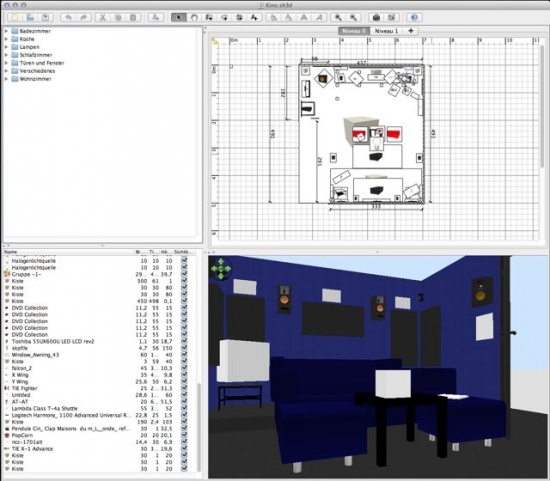 Dann fängt man an, mittels des intuitiven Editors zuerst die Raumwände zu bauen und so den Grundriss des Raums zu definieren.
Dann fängt man an, mittels des intuitiven Editors zuerst die Raumwände zu bauen und so den Grundriss des Raums zu definieren.
All dies geschieht aus der Vogelperspektive (oben rechts), man kann Bemaßungen einfügen, hinein und heraus zoomen und sich jederzeit mit einem frei positionierbaren "virtuellem Ich" ein Bild vom aktuellen Stand des "Bauvorhabens" machen (unten rechts).
Während des Bauens wird vom Programm kontinuierlich eine Liste der verwendeten Objekte geführt (unten links), aus der man einzelne Objekte direkt auswählen und deren Parameter (Maße, Beschaffenheit, Farbe, Position im Koordinatensystem) ändern kann. Gerade wenn man später dann viele Objekte im Raum platziert hat, die sich evtl. auch überlagern, ist diese Objekt-Liste sehr nützlich.
Sweet Home 3D kommt bereits mit einer großen Bibliothek an Objekten, sei es Möbel, Lichtquellen, Fenster, Treppen etc. Diese liegen in Format ".dae" vor und man findet per Google auch viele zusätzliche Modelle, die man dann in den eigene Konstruktionen verwenden kann.
Gerade Google stellt sich bei der Suche nach passenden Objekten als sehr hilfreich heraus. Es gibt nämlich von Google selbst eine eigene 3D-Software namens "Sketchup" und für deren Modelle bietet Google eine eigene Suchmaschine an (sketchup.google.com/3dwarehouse/).
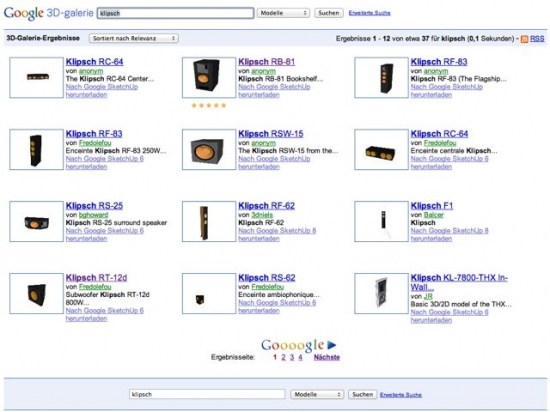
Das hat mir persönlich die lebensechte Konstruktion meines Keller sehr erleichtert, da es z.B. unzählige Möbel von IKEA im Format von Google Sketchup gibt. Auch meine Klipsch-Lautsprecher habe ich gefunden und konnte sie dann, ohne sie selbst erst bauen zu müssen, einfach in meinem Raum platzieren.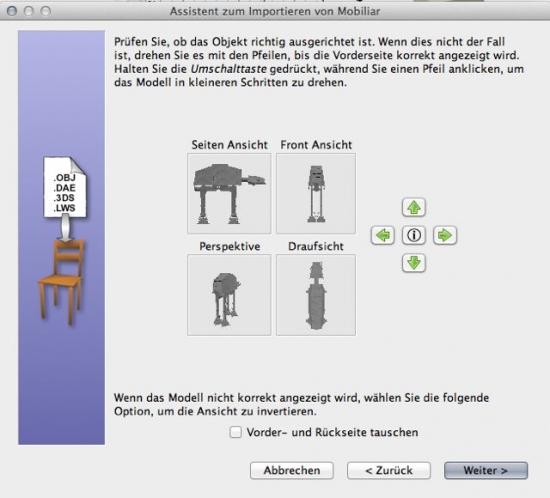
Ok, nicht ganz so einfach, denn die Modelle aus Google Sketchup liegen im Format ".skp" vor, mit dem Sweet Home 3D nichts anfangen kann.
Um sie dann doch nutzen zu können, habe ich mir die Test-Version von Google Sketchup Pro heruntergeladen. Diese kann man 8 Stunden lang testen und bietet die Möglichkeit an, skp-Objekte als dae-Objekte zu exportieren.
Damit ist es dann eine Sache von wenigen Minuten, einen Raum mit authentischen Objekten zu füllen. Sollten einzelne Dinge nicht auffindbar sein (z.B. die eigenen Poster oder Kino-Schilder), dann können solche einfachen Objekte unkompliziert nachgebaut werden. Ein Poster ist dann z.B. ein Quader mit einer dicke von 0,5 cm, dem man als Textur für die Vorderseite eben das Postermotiv zuweist.
 Sobald man den Raum mit allen seinen Objekten konstruiert hat, sucht man mit dem "virtuellen Ich" die erste Perspektive aus, von der aus man ein "Foto" des Raums machen möchte. Vorher kann man (oder sollte sogar) verschiedene Lichtquellen positionieren, da gerade die Lichter dem Raum Atmosphäre geben. Lichter kann man in Farbe und Intensität variieren, sodass man sogar vor einer realen Installation ausprobieren kann, wie bestimmte Lichteffekte aussehen würden.
Sobald man den Raum mit allen seinen Objekten konstruiert hat, sucht man mit dem "virtuellen Ich" die erste Perspektive aus, von der aus man ein "Foto" des Raums machen möchte. Vorher kann man (oder sollte sogar) verschiedene Lichtquellen positionieren, da gerade die Lichter dem Raum Atmosphäre geben. Lichter kann man in Farbe und Intensität variieren, sodass man sogar vor einer realen Installation ausprobieren kann, wie bestimmte Lichteffekte aussehen würden.
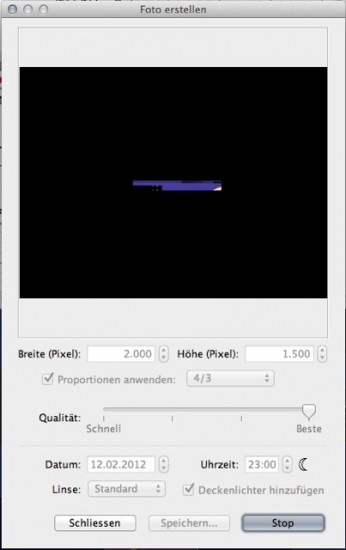 Sobald man damit fertig ist, lässt man das Bild berechnen. In einer Dialogbox kann man die Größe des fertigen "Fotos" festlegen, außerdem die Qualität des Endergebnisses.
Sobald man damit fertig ist, lässt man das Bild berechnen. In einer Dialogbox kann man die Größe des fertigen "Fotos" festlegen, außerdem die Qualität des Endergebnisses.
Klar: je höher die Qualität, desto länger dauert das Berechnen. Es bietet sich also an, sich erst eine kleine Vorschau in schlechter Qualität errechnen zu lassen und wenn man damit zufrieden ist, das finale Bild zu rendern.
Die Ergebnisse einer Berechnung in bester (langsamer) Qualität können sich sehen lassen. Je nach verwendeten Objekten sehen die errechneten Bilder ungemein lebensecht aus und zumindest ich ertappe mich seit Tagen immer wieder dabei, den virtuellen Raum noch ein wenig hier und da zu optimieren, um ihn noch mehr wie das Original aussehen zu lassen.
Wenn man sich einmal eingearbeitet hat (was für eine so möchtige Software erstaunlich schnell geht), dann sind Änderungen eine Sache von Sekunden und Wartezeiten entstehen nur, wenn ein neues Bild berechnet wird.
Fazit - Für wen ist Sweet Home 3D?
Ich kann einfach nur jedem, der von seinem Kino Fotos aus ungewöhnlichen Blickwinkeln haben möchte, empfehlen, sich ein wenit mit Sweet Home 3D zu beschäftigen. Die Software ist ungemein mächtig, ohne dabei den Anfänger mit komplizierten Funktionen zu erschlagen, und bietet eine hohe Qualität der gerenderten Fotos. Da Sweet Home 3D außerdem noch kostenlos ist, spricht eigentlich nichts dagegen, es einfach einmal auszuprobieren.
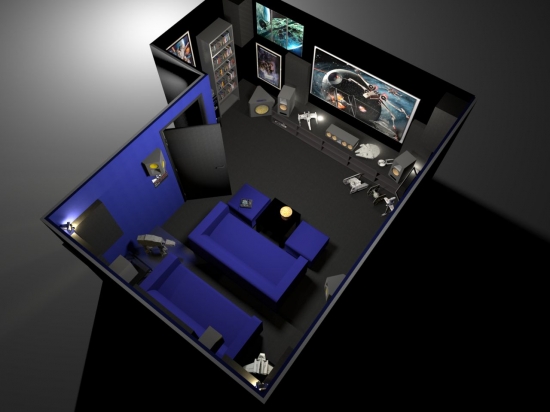
da ich in den letzten zwei Wochen extrem viele Anfragen bekommen habe, in denen es darum ging, mit welcher Software ich die 3D-Ansichten unseres Kellers erstellt habe, möchte ich heute einen kleinen Einblick in den kostenlosen Raum-Designer Sweet Home 3D geben.
Mit Sweet Home 3D kann man auf relativ einfach Art und Weise Räume (sogar ganze Häuser) nachbauen und diese dann virtuell begehen oder hochwertige Bilder mit frei wählbaren Perspektiven rendern lassen (das sind dann die Bilder, die es in meiner Galerie zu bewundern gibt).
Aber wie funktioniert das alles?
Zuerst lädt man sich unter www.sweethome3d.com/de/index.jsp das Programm für entweder für Windows, Linux oder Mac OS (das ist die Version, die ich verwende) herunter.
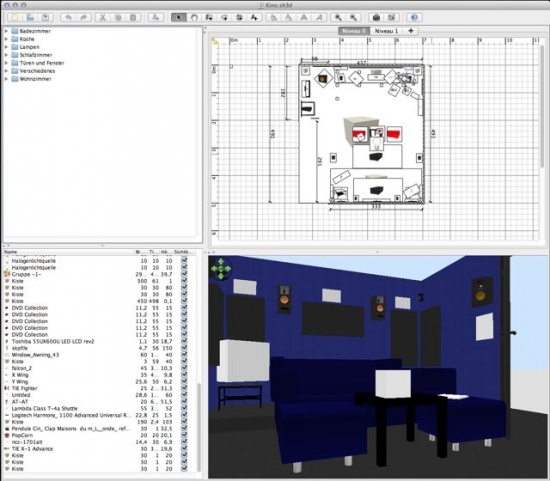 Dann fängt man an, mittels des intuitiven Editors zuerst die Raumwände zu bauen und so den Grundriss des Raums zu definieren.
Dann fängt man an, mittels des intuitiven Editors zuerst die Raumwände zu bauen und so den Grundriss des Raums zu definieren.All dies geschieht aus der Vogelperspektive (oben rechts), man kann Bemaßungen einfügen, hinein und heraus zoomen und sich jederzeit mit einem frei positionierbaren "virtuellem Ich" ein Bild vom aktuellen Stand des "Bauvorhabens" machen (unten rechts).
Während des Bauens wird vom Programm kontinuierlich eine Liste der verwendeten Objekte geführt (unten links), aus der man einzelne Objekte direkt auswählen und deren Parameter (Maße, Beschaffenheit, Farbe, Position im Koordinatensystem) ändern kann. Gerade wenn man später dann viele Objekte im Raum platziert hat, die sich evtl. auch überlagern, ist diese Objekt-Liste sehr nützlich.
Sweet Home 3D kommt bereits mit einer großen Bibliothek an Objekten, sei es Möbel, Lichtquellen, Fenster, Treppen etc. Diese liegen in Format ".dae" vor und man findet per Google auch viele zusätzliche Modelle, die man dann in den eigene Konstruktionen verwenden kann.
Gerade Google stellt sich bei der Suche nach passenden Objekten als sehr hilfreich heraus. Es gibt nämlich von Google selbst eine eigene 3D-Software namens "Sketchup" und für deren Modelle bietet Google eine eigene Suchmaschine an (sketchup.google.com/3dwarehouse/).
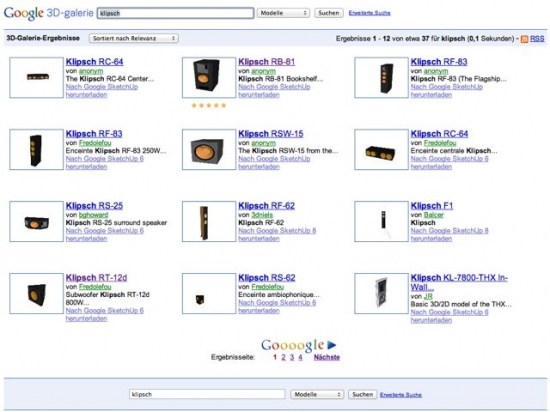
Das hat mir persönlich die lebensechte Konstruktion meines Keller sehr erleichtert, da es z.B. unzählige Möbel von IKEA im Format von Google Sketchup gibt. Auch meine Klipsch-Lautsprecher habe ich gefunden und konnte sie dann, ohne sie selbst erst bauen zu müssen, einfach in meinem Raum platzieren.
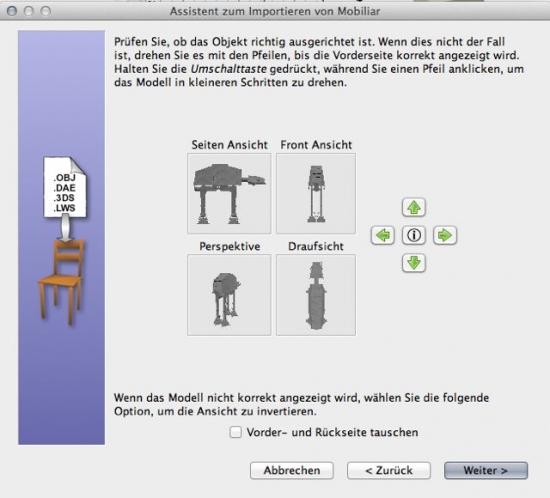
Ok, nicht ganz so einfach, denn die Modelle aus Google Sketchup liegen im Format ".skp" vor, mit dem Sweet Home 3D nichts anfangen kann.
Um sie dann doch nutzen zu können, habe ich mir die Test-Version von Google Sketchup Pro heruntergeladen. Diese kann man 8 Stunden lang testen und bietet die Möglichkeit an, skp-Objekte als dae-Objekte zu exportieren.
Damit ist es dann eine Sache von wenigen Minuten, einen Raum mit authentischen Objekten zu füllen. Sollten einzelne Dinge nicht auffindbar sein (z.B. die eigenen Poster oder Kino-Schilder), dann können solche einfachen Objekte unkompliziert nachgebaut werden. Ein Poster ist dann z.B. ein Quader mit einer dicke von 0,5 cm, dem man als Textur für die Vorderseite eben das Postermotiv zuweist.
 Sobald man den Raum mit allen seinen Objekten konstruiert hat, sucht man mit dem "virtuellen Ich" die erste Perspektive aus, von der aus man ein "Foto" des Raums machen möchte. Vorher kann man (oder sollte sogar) verschiedene Lichtquellen positionieren, da gerade die Lichter dem Raum Atmosphäre geben. Lichter kann man in Farbe und Intensität variieren, sodass man sogar vor einer realen Installation ausprobieren kann, wie bestimmte Lichteffekte aussehen würden.
Sobald man den Raum mit allen seinen Objekten konstruiert hat, sucht man mit dem "virtuellen Ich" die erste Perspektive aus, von der aus man ein "Foto" des Raums machen möchte. Vorher kann man (oder sollte sogar) verschiedene Lichtquellen positionieren, da gerade die Lichter dem Raum Atmosphäre geben. Lichter kann man in Farbe und Intensität variieren, sodass man sogar vor einer realen Installation ausprobieren kann, wie bestimmte Lichteffekte aussehen würden.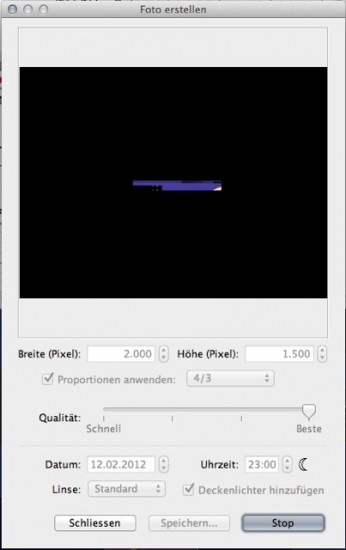 Sobald man damit fertig ist, lässt man das Bild berechnen. In einer Dialogbox kann man die Größe des fertigen "Fotos" festlegen, außerdem die Qualität des Endergebnisses.
Sobald man damit fertig ist, lässt man das Bild berechnen. In einer Dialogbox kann man die Größe des fertigen "Fotos" festlegen, außerdem die Qualität des Endergebnisses. Klar: je höher die Qualität, desto länger dauert das Berechnen. Es bietet sich also an, sich erst eine kleine Vorschau in schlechter Qualität errechnen zu lassen und wenn man damit zufrieden ist, das finale Bild zu rendern.
Die Ergebnisse einer Berechnung in bester (langsamer) Qualität können sich sehen lassen. Je nach verwendeten Objekten sehen die errechneten Bilder ungemein lebensecht aus und zumindest ich ertappe mich seit Tagen immer wieder dabei, den virtuellen Raum noch ein wenig hier und da zu optimieren, um ihn noch mehr wie das Original aussehen zu lassen.
Wenn man sich einmal eingearbeitet hat (was für eine so möchtige Software erstaunlich schnell geht), dann sind Änderungen eine Sache von Sekunden und Wartezeiten entstehen nur, wenn ein neues Bild berechnet wird.
Fazit - Für wen ist Sweet Home 3D?
Ich kann einfach nur jedem, der von seinem Kino Fotos aus ungewöhnlichen Blickwinkeln haben möchte, empfehlen, sich ein wenit mit Sweet Home 3D zu beschäftigen. Die Software ist ungemein mächtig, ohne dabei den Anfänger mit komplizierten Funktionen zu erschlagen, und bietet eine hohe Qualität der gerenderten Fotos. Da Sweet Home 3D außerdem noch kostenlos ist, spricht eigentlich nichts dagegen, es einfach einmal auszuprobieren.
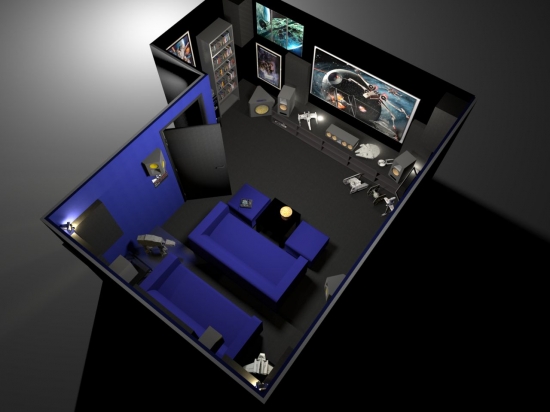
Raumakustik-Optimierung mit CARA 2.2 Plus
17. März 2012Hallo zusammen,
nachdem ich in den letzten Wochen mal wieder nach einer rechnergestützten Möglichkeit gesucht habe, die Akustik in unserem Kinokeller zu optimieren, bin ich auf die schon viele Jahre alte Software CARA 2.2 Plus gestoßen.
CARA besteht im Grunde genommen aus 2 Modulen:
CAD-Modul: Hier baut man den eigenen Raum inkl. Möbel, Wand- und Bodenbelägen, absorbierenden Flächen und natürlich Lautsprechern so gut es geht nach
Rechen-Modul: Hiermit kann man sich dann basierend auf dem im CAD-Modul gebauten Raum u.a. eine Optimierung von Lautsprecher-Positionen und Sitzplatz berechnen lassen.
CARA bietet noch sehr viel mehr, mit dem ich mich bisher nicht näher beschäftigt habe, es ging mir in erster Linie erst einmal um die Optimierungs-Berechnung und von der berichte ich heute hier.
Raum bauen
Zuerst baut man also seinen Raum nach. CARA ist da sehr flexibel und nicht nur auf rechteckige Räume begrenzt. In unserem Keller gibt es z.B. eine kleine Nische, die ich ohne viel Aufwand mit einbauen konnte. Generell führt CARA über einen Assistenten durch die grundsätzliche Anlage eines Raums. hier werden Maße abgefragt sowie die Beschaffenheit von Boden, Decke und Wänden festgelegt.
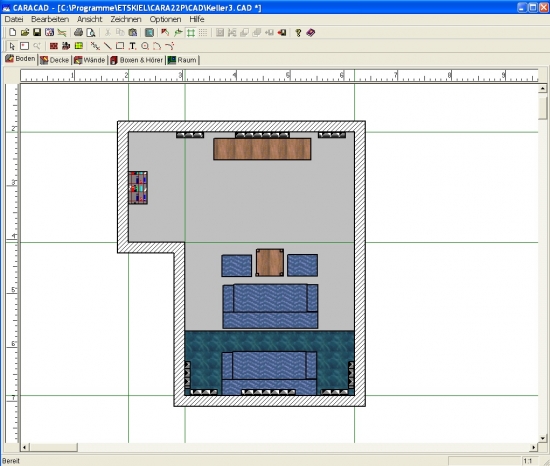
So sieht dann das Ergebnis für meinen Raum aus. Die hintere Couch steht auf einem Podest, man kann auch gut die Absorber in den hinteren Raumecken und hinter den Lautsprechern vorne erkennen.
Sämtliche Möbelstücke sucht man sich entweder aus einer leider nicht sehr großen Möbelbibliothek aus oder baut sie sich als 3D-Objekte selbst. Es stehen zahlreiche Materialien zur Verfügung, die man den Objekten zuweisen kann und die dann deren Absorbtionsverhalten bestimmen.
Akustisches Raumklima bewerten
An dieser Stelle kann man sich schon einmal eine Einstufung des akustischen Raumklimas geben lassen. Hier werden die akustischen Eigenschaften des Raums in Textform bewertet, alternativ kann man sich auch verschiedene Graphen zur eigenen Interpretation einblenden lassen:
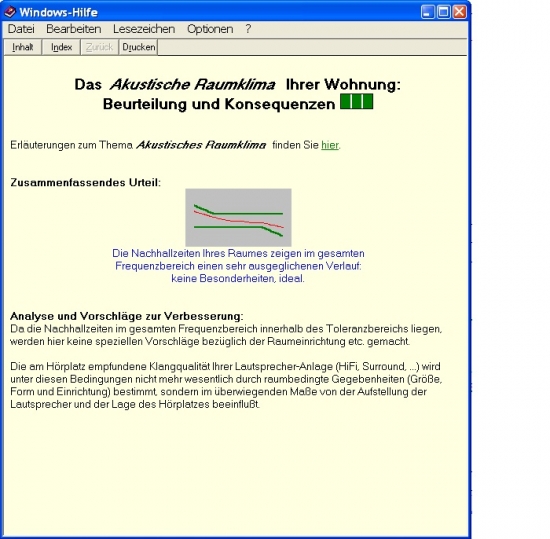
Lautsprecher aufstellen
Danach stellt man die Lautsprecher in den Raum. Auch hier kann man auf eine bestehende Datenbank zurückgreifen, in der aber leider neuere Lautsprecher nicht mehr drin sind. Man kann sich aber mittels der technischen Daten der eigenen Lautsprecher auch selbst Modelle bauen. Das war bei mir beim Subwoofer Klipsch RT-10D der Fall. Der hat einen dreieckigen Grundriss sowie eine Aktiv-und zwei Passiv-Membranen. Auch solche Ding werden unterstützt.
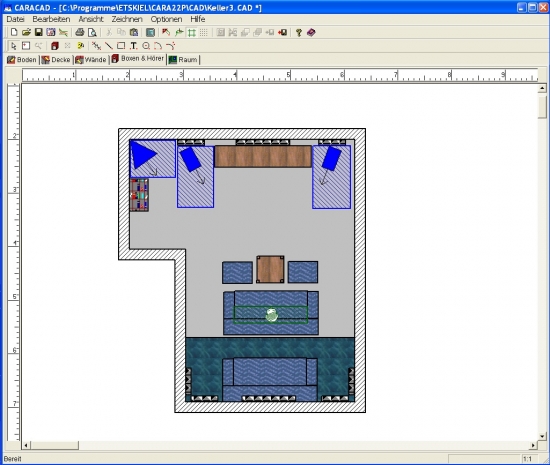
Wie man sieht, stehen nun vorne in Blau die 3 Lautsprecher, die ich in die Berechnung der Optimierung mit integrieren möchte. Der schraffierte Bereich um die Lautsprecher herum definiert den Bereich, in dem die Lautsprecher verschoben werden könnten.
Gleiches gilt für den Hörplatz (grüner Kopf auf dem vorderen Sofa), auch hier kann man angeben, in welchem Rahmen man diesen verändern kann.
Jetzt noch mal schnell schauen, wie der Raum in 3D aussieht und dann geht's los.

Jetzt wird gerechnet
Danach geht's dann ins Berechnungs-Modul. Hier spielt die Software dann tausende verschiedene Kombinationen aus Boxen-Positionen und Hörplätzen durch und ändert immer, wenn eine noch bessere Kombination gefunden wurde, die Positionen von Lautsprecher und/oder Hörplatz auf dem Bildschirm.
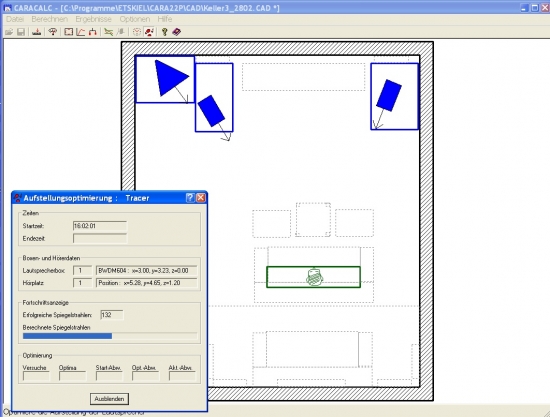
Als Ergebnis sieht man nun hier, wohin die Lautsprecher verschoben worden sind (Hinweis: Vor Start der Berechnung war der Hörplatz ganz links auf der Couch, weil dort die Basswiedergabe bei der alten Subwoofer-Position besser war als mittig auf der Couch).
Was hat das nun alles gebracht?
An sich bin ich mit der Wiedergabequalität meiner Hauptlautsprecher sehr zufrieden, was mich aber immer schon gestört hat, war die Basswiedergabe des Subwoofers. Die war nicht sonderlich druckvoll und irgendwie nur auf dem ganz linken Platz auf der Sofa einigermaßen erträglich.
Ich hatte daher schon seit Wochen immer mal wieder den Subwoofer verschoben, ja, ihn sogar in der Höhe verstellt.
Bisher stand der Sub immer ganz in der Raumecke (dafür ist der Klipsch auch vorgesehen) und die empfohlene Optimerung sieht nun so aus:
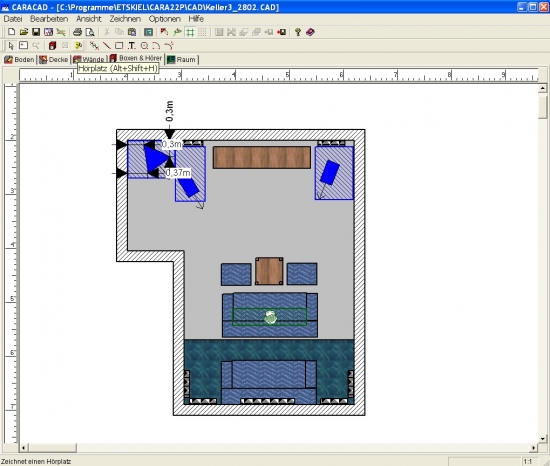
Und was soll ich sagen? Nachdem ich den Subwoofer nach oben gezeigten Werten verschoben hatte (es handelt sich dabei nicht um riesige Veränderungen) und den Sitzplatz in der Mitte eingenommen hatte, war der Bass auf einmal so, wie ich ihn mir gewünscht habe. Nicht ein bisschen besser, nein, massiv besser.
Somit hat sich der Einsatz von CARA 2.2 plus für mich absolut gelohnt und ich kann die Software nur empfehlen.
Berechnung dauert eine Weile
Die Berechnung bis zu o.g. Ergebnis hat übrigens 2 Tage gedauert (auf einem Laptop mit Windows XP und Intel Core2Duo-Prozessor mit 1.83 Ghz) und ca. 10.000 Berechnungen benötigt. Generell merkt man der Software von der Bedienung her an, dass sie schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Wenn man sich daran aber wieder gewöhnt hat, dann kommt man gut voran.
Viele Möglichkeiten
Wie schon eingangs erwähnt, kratzt man mit der Berechnung der Aufstellungsoptimierung nur an der Oberfläche von CARA. Wen es interessiert, der sollte einfach mal auf der Website www.cara.de vorbeschauen.
Und was kostet der Spaß jetzt?
Ich hatte mich für das CARA 2.2 Plus PowerPack entschieden. Dabei erhält man neben der eigentlichen Software noch eine CD-ROM mit Tutorial-Videos (sehr gut gemacht meiner Meinung nach und mit einem sehr guten Sprecher vertont) und die CARA-Test-CD mit Testtönen. Dafür werden dann € 69 zzgl. Versandkosten fällig. Sicherlich kein kleiner Betrag, aber wenn ich die tatsächlich hörbare Verbesserung und die Lösung meiner Bass-Probleme bedenke, dann doch eine sehr gute Investition.
Fazit
Wer also mehr über die Akustik des eigenen Hörraums erfahren möchte, der macht mit CARA nichts falsch.
nachdem ich in den letzten Wochen mal wieder nach einer rechnergestützten Möglichkeit gesucht habe, die Akustik in unserem Kinokeller zu optimieren, bin ich auf die schon viele Jahre alte Software CARA 2.2 Plus gestoßen.
CARA besteht im Grunde genommen aus 2 Modulen:
CAD-Modul: Hier baut man den eigenen Raum inkl. Möbel, Wand- und Bodenbelägen, absorbierenden Flächen und natürlich Lautsprechern so gut es geht nach
Rechen-Modul: Hiermit kann man sich dann basierend auf dem im CAD-Modul gebauten Raum u.a. eine Optimierung von Lautsprecher-Positionen und Sitzplatz berechnen lassen.
CARA bietet noch sehr viel mehr, mit dem ich mich bisher nicht näher beschäftigt habe, es ging mir in erster Linie erst einmal um die Optimierungs-Berechnung und von der berichte ich heute hier.
Raum bauen
Zuerst baut man also seinen Raum nach. CARA ist da sehr flexibel und nicht nur auf rechteckige Räume begrenzt. In unserem Keller gibt es z.B. eine kleine Nische, die ich ohne viel Aufwand mit einbauen konnte. Generell führt CARA über einen Assistenten durch die grundsätzliche Anlage eines Raums. hier werden Maße abgefragt sowie die Beschaffenheit von Boden, Decke und Wänden festgelegt.
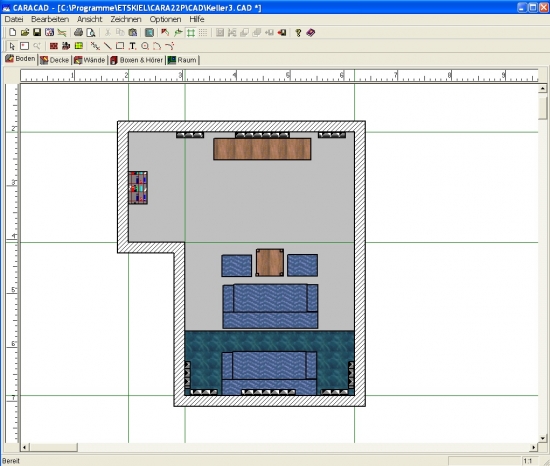
So sieht dann das Ergebnis für meinen Raum aus. Die hintere Couch steht auf einem Podest, man kann auch gut die Absorber in den hinteren Raumecken und hinter den Lautsprechern vorne erkennen.
Sämtliche Möbelstücke sucht man sich entweder aus einer leider nicht sehr großen Möbelbibliothek aus oder baut sie sich als 3D-Objekte selbst. Es stehen zahlreiche Materialien zur Verfügung, die man den Objekten zuweisen kann und die dann deren Absorbtionsverhalten bestimmen.
Akustisches Raumklima bewerten
An dieser Stelle kann man sich schon einmal eine Einstufung des akustischen Raumklimas geben lassen. Hier werden die akustischen Eigenschaften des Raums in Textform bewertet, alternativ kann man sich auch verschiedene Graphen zur eigenen Interpretation einblenden lassen:
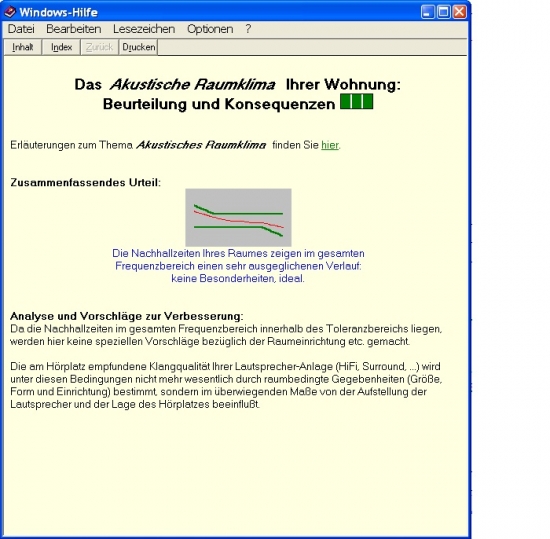
Lautsprecher aufstellen
Danach stellt man die Lautsprecher in den Raum. Auch hier kann man auf eine bestehende Datenbank zurückgreifen, in der aber leider neuere Lautsprecher nicht mehr drin sind. Man kann sich aber mittels der technischen Daten der eigenen Lautsprecher auch selbst Modelle bauen. Das war bei mir beim Subwoofer Klipsch RT-10D der Fall. Der hat einen dreieckigen Grundriss sowie eine Aktiv-und zwei Passiv-Membranen. Auch solche Ding werden unterstützt.
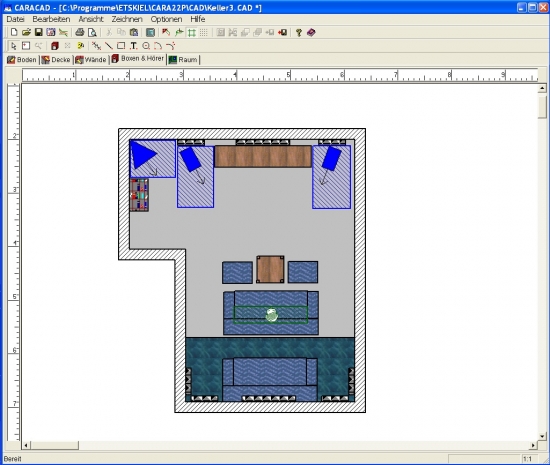
Wie man sieht, stehen nun vorne in Blau die 3 Lautsprecher, die ich in die Berechnung der Optimierung mit integrieren möchte. Der schraffierte Bereich um die Lautsprecher herum definiert den Bereich, in dem die Lautsprecher verschoben werden könnten.
Gleiches gilt für den Hörplatz (grüner Kopf auf dem vorderen Sofa), auch hier kann man angeben, in welchem Rahmen man diesen verändern kann.
Jetzt noch mal schnell schauen, wie der Raum in 3D aussieht und dann geht's los.

Jetzt wird gerechnet
Danach geht's dann ins Berechnungs-Modul. Hier spielt die Software dann tausende verschiedene Kombinationen aus Boxen-Positionen und Hörplätzen durch und ändert immer, wenn eine noch bessere Kombination gefunden wurde, die Positionen von Lautsprecher und/oder Hörplatz auf dem Bildschirm.
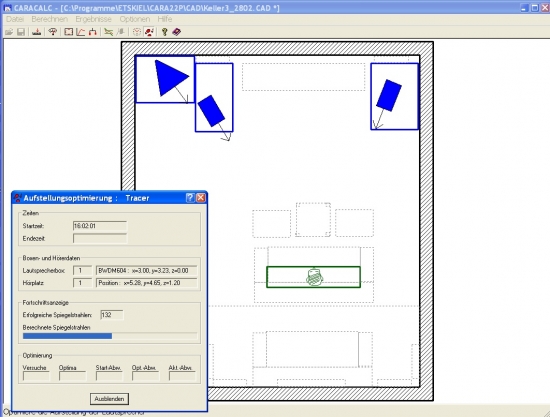
Als Ergebnis sieht man nun hier, wohin die Lautsprecher verschoben worden sind (Hinweis: Vor Start der Berechnung war der Hörplatz ganz links auf der Couch, weil dort die Basswiedergabe bei der alten Subwoofer-Position besser war als mittig auf der Couch).
Was hat das nun alles gebracht?
An sich bin ich mit der Wiedergabequalität meiner Hauptlautsprecher sehr zufrieden, was mich aber immer schon gestört hat, war die Basswiedergabe des Subwoofers. Die war nicht sonderlich druckvoll und irgendwie nur auf dem ganz linken Platz auf der Sofa einigermaßen erträglich.
Ich hatte daher schon seit Wochen immer mal wieder den Subwoofer verschoben, ja, ihn sogar in der Höhe verstellt.
Bisher stand der Sub immer ganz in der Raumecke (dafür ist der Klipsch auch vorgesehen) und die empfohlene Optimerung sieht nun so aus:
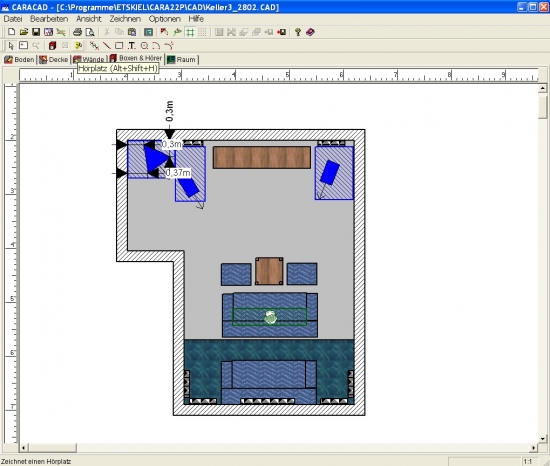
Und was soll ich sagen? Nachdem ich den Subwoofer nach oben gezeigten Werten verschoben hatte (es handelt sich dabei nicht um riesige Veränderungen) und den Sitzplatz in der Mitte eingenommen hatte, war der Bass auf einmal so, wie ich ihn mir gewünscht habe. Nicht ein bisschen besser, nein, massiv besser.
Somit hat sich der Einsatz von CARA 2.2 plus für mich absolut gelohnt und ich kann die Software nur empfehlen.
Berechnung dauert eine Weile
Die Berechnung bis zu o.g. Ergebnis hat übrigens 2 Tage gedauert (auf einem Laptop mit Windows XP und Intel Core2Duo-Prozessor mit 1.83 Ghz) und ca. 10.000 Berechnungen benötigt. Generell merkt man der Software von der Bedienung her an, dass sie schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Wenn man sich daran aber wieder gewöhnt hat, dann kommt man gut voran.
Viele Möglichkeiten
Wie schon eingangs erwähnt, kratzt man mit der Berechnung der Aufstellungsoptimierung nur an der Oberfläche von CARA. Wen es interessiert, der sollte einfach mal auf der Website www.cara.de vorbeschauen.
Und was kostet der Spaß jetzt?
Ich hatte mich für das CARA 2.2 Plus PowerPack entschieden. Dabei erhält man neben der eigentlichen Software noch eine CD-ROM mit Tutorial-Videos (sehr gut gemacht meiner Meinung nach und mit einem sehr guten Sprecher vertont) und die CARA-Test-CD mit Testtönen. Dafür werden dann € 69 zzgl. Versandkosten fällig. Sicherlich kein kleiner Betrag, aber wenn ich die tatsächlich hörbare Verbesserung und die Lösung meiner Bass-Probleme bedenke, dann doch eine sehr gute Investition.
Fazit
Wer also mehr über die Akustik des eigenen Hörraums erfahren möchte, der macht mit CARA nichts falsch.
Yamaha RX-V3067 - Top-Receiver zum Sparpreis
12. Februar 2012Hallo zusammen,
seit ein paar Wochen verrichtet nun ein Yamaha RX-V3067 seinen Dienst als AV-Schaltzentrale im Kino-Keller seinen Dienst. Er ersetzt damit den Pioneer SC-LX72, der mir seit Januar 2010 treue Dienste geleistet hat.
Warum also ein neuer AV-Receiver, wenn der Alte doch absolut in Ordnung war? Nun... einfach Lust auf etwas Neues :-) Außerdem gibt es den RX-V3067 im Moment zu einem unverschämt günstigen Preis von € 1050, da es sich um ein Auslaufmodell handelt, das vor kurzem vom RX-A3010 ersetzt wurde.
Mit der aktuellen Modellreihe hat Yamaha auch in Europa die "Aventage"-Serie eingeführt, die sich durch einige bauliche Maßnahmen von den Modellen der regulären RX-V-Serie absetzt. Dazu gehören z.B. Verstrebungen im Inneren und ein fünfter Fuß außen direkt unter dem Trafo.
Da aktuelle Tests des RX-A3010 auch durchweg sehr positiv ausgefallen sind, hatte ich an sich dieses Modell für einen Wechsel im Laufe des Jahres angepeilt.
Nach ein wenig Reschersche fand ich dann heraus, dass auch schon der 3067 in Amerika bereits als Modell der Aventage-Serie verkauft wurde, unter der Bezeichnung RX-A3000. Einziger Unterschied zwischen RX-A3000 und RX-V3067: dem 3067 fehlt der fünfte Fuß. Ansonsten sind beide Modelle identisch.
Ein Vergleich der technischen Daten und der Ausstattungsmerkmale zeigte dann, dass der 3067 bereits all das bietet, was auch der aktuelle RX-A3010 bietet. Gut, der 3010 hat 9 anstatt 7 Endstufen eingebaut, da ich aber sowieso nur vorhabe, ein 7.1-System zu befeuern, reicht mir der 3067 vollkommen aus.
Weitere für mich wichtige gemeinsame Ausstattungtsmerkmale umfassen:
- Aktuelle Version des YPAO-Einmesssystem inkl. Winkelmessung/Reflexionen und 8-Positionen-Messung
- 2 komplett getrennte Subwoofer-Ausgänge, die wirklich sehr frei konfiguriert werden können
- Generell ein sehr flexibles Boxen-Setup mit separaten Übergangsfrequenzen für alle Boxen-Paare und Center
- Die Möglichkeit, 2 komplette Boxen-Setups zu verwalten und zwischen ihnen im Betrieb hin und her zu schalten
 Das Setup des Receivers war dann auch schnell erledigt. Mit 7 HDMI-Eingängen an der Rückseite und 2 Ausgängen kapituliert er auch vor großen Geräteparks nicht. Die Boxenklemmen machen auch einen sehr hochwertigen Eindruck, klasse!
Das Setup des Receivers war dann auch schnell erledigt. Mit 7 HDMI-Eingängen an der Rückseite und 2 Ausgängen kapituliert er auch vor großen Geräteparks nicht. Die Boxenklemmen machen auch einen sehr hochwertigen Eindruck, klasse!
Ein erster Durchlauf des YPAO-Einmesssystem ist erstaunlicherweise sehr schnell erledigt, kein Vergleich zum minutenlangen pfeifenden und rauschenden MCACC des Pioneer.
Nachdem YPAO seine Arbeit erledigt hat, stellt das System verschiedene Equalizer-Kurven zur Verfügung (Natürlich, Front etc.). Diese können auf den Speicherplatz "Manuell" kopiert und dann dort (wie der Name es vermuten lässt) manuell verändert werden.
Yamaha bedient sich hierbei eines halbparametrischen Equalizers (im Gegensatz zum grafischen EQ des Pioneers). In der Praxis sieht das so aus, dass man aus 28 Frequenzen 7 auswählen kann und diese dann in 0,5db Schritten anheben oder absenken kann und außerdem noch die Filtergüte Q einstellen kann. Die bestimmt, wie sehr sich die Absenkung oder Anhebung einer Frequenz nur genau auf diese eine Frequenz bezieht oder aber auch noch Einfluss auf daneben liegende Frequenzen haben kann.
Insgesamt ist diese EQ-Variante durchaus flexibler als die Variante von Pioneer. Gut ist auch, dass selbst für jeden der beiden möglichen Subwoofer ein PEQ mit 4-Bänden zur Verfügung steht.

Nachdem also alle Einstellungen gemacht waren, musste der Yamaha in ersten Hörtests beweisen, was er denn so drauf hat. Und das war ganz schön viel! Im Gegensatz zum Pioneer öffnet er den Rückraum noch ein ganzes Stück weiter und lässt einen beim Betrachten eines Films sehr schön in die Soundkulisse eintauchen. "Mittendrin statt nur dabei" beschreibt es sehr schön.
Traditionell gibt es bei Yamaha natürlich auch hier ein ganzes Paket an verschiedenen DSP-Programmen, die sowohl Mehrkanal-Ton als auch Stereo-Signale aufpeppen sollen. Der 3067 ist nun bereits mein 4. Yamaha AV-Receiver seit 1994 und wie bisher habe ich auch hier das Gefühl, dass es nur Yamaha hinbekommt, wirklich brauchbare DSP-Programme zur Verfügung zu stellen. Alle Programme kann man selbst in zahlreichen Parametern editieren und sie so dem eigenen Geschmack anpassen. Wenn man z.B. eine Live-CD hört, die in einem kleinen Club aufgenommen wurde, dann kann man mit Wahl eines entsprechenden DSP-Programms die Akustik des Clubs sehr schön in die eigenen vier Wände übertragen. Das ist natürlich immer Geschmacksache, klingt aber auf jeden Fall wesentlich natürlicher als alle DSP-Programme sämtlicher anderer Receiver-Hersteller. Da merkt man den Yamahas einfach die Erfahrung an, die das Unternehmen seit vielen Jahren im Raumklang-Bereich sammeln konnte (Yamaha hat schon die akustischen Gegebenheiten zahlreicher Konzerthallen elektronisch gespeichert, als von Heimkino noch niemand gesprochen hat).
Generell macht der Yamaha also sowohl bei Filmen als auch Musik verdammt viel Spaß! Er spielt sehr druckvoll aber auch sehr fein aufgelöst. Gerade im Pure Direct Modus, der alle internen Beeinflussung wie YPAO, EQs etc abschaltet, hat man den Eindruck, dass rein gar nichts zwischen einem selbst und der Musik steht. Wenn man die Augen schließt, dann verschwinden tatsächlich die Lautsprecher und man sieht den Künstler vor sich. Für meine Ohren hört sich gerade Stereo-Musik in Pure Direct verdammt nah am Begriff "High End" an.
Was bietet der Yamaha sonst noch? Er hat einen HQV Vida Chip, der sich um Deinterlacing und Upscaling sowohl von analogen als uch HDMI-Quellen kümmert. Dabei stehen einem vielfältige Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. Generell ist der Yamaha dermaßen tief konfigurierbar, dass es schon ein paar Tage braucht, bis man sich durch alle Optionen einmal durchgearbeitet hat. Diese werden an sich alle sehr übersichtlich präsentiert, aber alleine die schiere Menge erfordert eben ein wenig Zeit zum Ausprobieren. Yamaha liefert direkt 2 Fernbedienungen mit, eine Große und eine Kleine. Die Große hat im unteren Bereich eine Klappe, die seltener benutzte Tasten verbirgt, wobei ich so manche Taste doch öfter nutze. Da ich aber sowieso alles über meine Nevo steuer, macht mir das nichts aus. Der Yamaha spielt übers Netzwerk bereitgestellte Musik ab, greift auf Internet-Radio-Stationen zu und lässt sich per Android und iOS-App steuern, was gerade beim Netzwerk-Zugriff auf Musik nützlich ist, um sich schnell durch Listen zu bewegen.
Fazit: Der Wechsel vom Pioneer auf den Yamaha hat sich für mich gelohnt. Klanglich liegen keine Welten zwischen den Geräten, das habe ich aber auch nicht erwartet. Für einen Preis von momanten gerade mal € 1050 (Listenpreis war € 1750) dürfte man aber Schwierigkeiten haben, einen besser klingenden und ebenso gut ausgestatteten AV-Receiver auftreiben zu können.
seit ein paar Wochen verrichtet nun ein Yamaha RX-V3067 seinen Dienst als AV-Schaltzentrale im Kino-Keller seinen Dienst. Er ersetzt damit den Pioneer SC-LX72, der mir seit Januar 2010 treue Dienste geleistet hat.
Warum also ein neuer AV-Receiver, wenn der Alte doch absolut in Ordnung war? Nun... einfach Lust auf etwas Neues :-) Außerdem gibt es den RX-V3067 im Moment zu einem unverschämt günstigen Preis von € 1050, da es sich um ein Auslaufmodell handelt, das vor kurzem vom RX-A3010 ersetzt wurde.
Mit der aktuellen Modellreihe hat Yamaha auch in Europa die "Aventage"-Serie eingeführt, die sich durch einige bauliche Maßnahmen von den Modellen der regulären RX-V-Serie absetzt. Dazu gehören z.B. Verstrebungen im Inneren und ein fünfter Fuß außen direkt unter dem Trafo.
Da aktuelle Tests des RX-A3010 auch durchweg sehr positiv ausgefallen sind, hatte ich an sich dieses Modell für einen Wechsel im Laufe des Jahres angepeilt.
Nach ein wenig Reschersche fand ich dann heraus, dass auch schon der 3067 in Amerika bereits als Modell der Aventage-Serie verkauft wurde, unter der Bezeichnung RX-A3000. Einziger Unterschied zwischen RX-A3000 und RX-V3067: dem 3067 fehlt der fünfte Fuß. Ansonsten sind beide Modelle identisch.
Ein Vergleich der technischen Daten und der Ausstattungsmerkmale zeigte dann, dass der 3067 bereits all das bietet, was auch der aktuelle RX-A3010 bietet. Gut, der 3010 hat 9 anstatt 7 Endstufen eingebaut, da ich aber sowieso nur vorhabe, ein 7.1-System zu befeuern, reicht mir der 3067 vollkommen aus.
Weitere für mich wichtige gemeinsame Ausstattungtsmerkmale umfassen:
- Aktuelle Version des YPAO-Einmesssystem inkl. Winkelmessung/Reflexionen und 8-Positionen-Messung
- 2 komplett getrennte Subwoofer-Ausgänge, die wirklich sehr frei konfiguriert werden können
- Generell ein sehr flexibles Boxen-Setup mit separaten Übergangsfrequenzen für alle Boxen-Paare und Center
- Die Möglichkeit, 2 komplette Boxen-Setups zu verwalten und zwischen ihnen im Betrieb hin und her zu schalten
 Das Setup des Receivers war dann auch schnell erledigt. Mit 7 HDMI-Eingängen an der Rückseite und 2 Ausgängen kapituliert er auch vor großen Geräteparks nicht. Die Boxenklemmen machen auch einen sehr hochwertigen Eindruck, klasse!
Das Setup des Receivers war dann auch schnell erledigt. Mit 7 HDMI-Eingängen an der Rückseite und 2 Ausgängen kapituliert er auch vor großen Geräteparks nicht. Die Boxenklemmen machen auch einen sehr hochwertigen Eindruck, klasse!Ein erster Durchlauf des YPAO-Einmesssystem ist erstaunlicherweise sehr schnell erledigt, kein Vergleich zum minutenlangen pfeifenden und rauschenden MCACC des Pioneer.
Nachdem YPAO seine Arbeit erledigt hat, stellt das System verschiedene Equalizer-Kurven zur Verfügung (Natürlich, Front etc.). Diese können auf den Speicherplatz "Manuell" kopiert und dann dort (wie der Name es vermuten lässt) manuell verändert werden.
Yamaha bedient sich hierbei eines halbparametrischen Equalizers (im Gegensatz zum grafischen EQ des Pioneers). In der Praxis sieht das so aus, dass man aus 28 Frequenzen 7 auswählen kann und diese dann in 0,5db Schritten anheben oder absenken kann und außerdem noch die Filtergüte Q einstellen kann. Die bestimmt, wie sehr sich die Absenkung oder Anhebung einer Frequenz nur genau auf diese eine Frequenz bezieht oder aber auch noch Einfluss auf daneben liegende Frequenzen haben kann.
Insgesamt ist diese EQ-Variante durchaus flexibler als die Variante von Pioneer. Gut ist auch, dass selbst für jeden der beiden möglichen Subwoofer ein PEQ mit 4-Bänden zur Verfügung steht.

Nachdem also alle Einstellungen gemacht waren, musste der Yamaha in ersten Hörtests beweisen, was er denn so drauf hat. Und das war ganz schön viel! Im Gegensatz zum Pioneer öffnet er den Rückraum noch ein ganzes Stück weiter und lässt einen beim Betrachten eines Films sehr schön in die Soundkulisse eintauchen. "Mittendrin statt nur dabei" beschreibt es sehr schön.
Traditionell gibt es bei Yamaha natürlich auch hier ein ganzes Paket an verschiedenen DSP-Programmen, die sowohl Mehrkanal-Ton als auch Stereo-Signale aufpeppen sollen. Der 3067 ist nun bereits mein 4. Yamaha AV-Receiver seit 1994 und wie bisher habe ich auch hier das Gefühl, dass es nur Yamaha hinbekommt, wirklich brauchbare DSP-Programme zur Verfügung zu stellen. Alle Programme kann man selbst in zahlreichen Parametern editieren und sie so dem eigenen Geschmack anpassen. Wenn man z.B. eine Live-CD hört, die in einem kleinen Club aufgenommen wurde, dann kann man mit Wahl eines entsprechenden DSP-Programms die Akustik des Clubs sehr schön in die eigenen vier Wände übertragen. Das ist natürlich immer Geschmacksache, klingt aber auf jeden Fall wesentlich natürlicher als alle DSP-Programme sämtlicher anderer Receiver-Hersteller. Da merkt man den Yamahas einfach die Erfahrung an, die das Unternehmen seit vielen Jahren im Raumklang-Bereich sammeln konnte (Yamaha hat schon die akustischen Gegebenheiten zahlreicher Konzerthallen elektronisch gespeichert, als von Heimkino noch niemand gesprochen hat).
Generell macht der Yamaha also sowohl bei Filmen als auch Musik verdammt viel Spaß! Er spielt sehr druckvoll aber auch sehr fein aufgelöst. Gerade im Pure Direct Modus, der alle internen Beeinflussung wie YPAO, EQs etc abschaltet, hat man den Eindruck, dass rein gar nichts zwischen einem selbst und der Musik steht. Wenn man die Augen schließt, dann verschwinden tatsächlich die Lautsprecher und man sieht den Künstler vor sich. Für meine Ohren hört sich gerade Stereo-Musik in Pure Direct verdammt nah am Begriff "High End" an.
Was bietet der Yamaha sonst noch? Er hat einen HQV Vida Chip, der sich um Deinterlacing und Upscaling sowohl von analogen als uch HDMI-Quellen kümmert. Dabei stehen einem vielfältige Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. Generell ist der Yamaha dermaßen tief konfigurierbar, dass es schon ein paar Tage braucht, bis man sich durch alle Optionen einmal durchgearbeitet hat. Diese werden an sich alle sehr übersichtlich präsentiert, aber alleine die schiere Menge erfordert eben ein wenig Zeit zum Ausprobieren. Yamaha liefert direkt 2 Fernbedienungen mit, eine Große und eine Kleine. Die Große hat im unteren Bereich eine Klappe, die seltener benutzte Tasten verbirgt, wobei ich so manche Taste doch öfter nutze. Da ich aber sowieso alles über meine Nevo steuer, macht mir das nichts aus. Der Yamaha spielt übers Netzwerk bereitgestellte Musik ab, greift auf Internet-Radio-Stationen zu und lässt sich per Android und iOS-App steuern, was gerade beim Netzwerk-Zugriff auf Musik nützlich ist, um sich schnell durch Listen zu bewegen.
Fazit: Der Wechsel vom Pioneer auf den Yamaha hat sich für mich gelohnt. Klanglich liegen keine Welten zwischen den Geräten, das habe ich aber auch nicht erwartet. Für einen Preis von momanten gerade mal € 1050 (Listenpreis war € 1750) dürfte man aber Schwierigkeiten haben, einen besser klingenden und ebenso gut ausgestatteten AV-Receiver auftreiben zu können.
Internet ins Kino bringen
11. Februar 2012Hallo zusammen,
nachdem ich vor ein paar Wochen ja auf einen neuen AV-Receiver umgestiegen bin, dachte ich, dass es ja auch endlich mal an der Zeit wäre, im Keller eine funktionierende Internet-Verbindung zu haben.
Folgende Dinge sollten damit laufen:
1.) Musik-Streaming von der NAS zum AV-Receiver
2.) Internet-Radio
3.) Bedienung des AVR mit dem Android-Tablet (gerade bei NAS-Musik sehr übersichtlich)
4.) Komplette Filmverwaltung mit dem Android-Tablet und My Movies Pro
Jetzt haben wir ja an sich unseren WLAN-Router direkt im Wohnzimmer über dem Kino-Raum im Keller aufgestellt. Trotzdem drang über dieses eine Stockwerk kein brauchbares Signal mehr in den Keller.
Ich hatte daher nach einer Möglichkeit gesucht, das bestehende WLAN zu "verlängern". Die Lösung habe ich dabei im Access Point TL-WA801ND von TP-Link gefunden. Das kleine Ding kostet bei Amazon gerade mal € 30 und bietet neben der Verstärkung des WLAN-Signals auch noch einen kabelgebundenen Netzwerk-Anschluss. Den benötige ich, um den AV-Receiver anzuschließen, da der nur eine RJ45-Buchse hat.
 Was mir besonders gut gefallen hat, das war die kinderleichte Einrichtung des Access Points. Man schließt ihn per Kabel an den PC an, startet das Konfigurations-Programm von der beiliegenden CD und wird durch alle nötigen Schritte geführt. Nach wenigen Minuten ist der Access Point dann mit dem WLAN verbunden, das vom WLAN-Router bereitgestellt wird. Ob sich Geräte wie iPhone, Tablet oder was auch immer nun direkt über eine Verbindung zum Router oder über den Access Point mit dem Internet verbinden, das merkt man im täglichen Gebrauch nicht, man hat einfach "mehr Internet" im Haus.
Was mir besonders gut gefallen hat, das war die kinderleichte Einrichtung des Access Points. Man schließt ihn per Kabel an den PC an, startet das Konfigurations-Programm von der beiliegenden CD und wird durch alle nötigen Schritte geführt. Nach wenigen Minuten ist der Access Point dann mit dem WLAN verbunden, das vom WLAN-Router bereitgestellt wird. Ob sich Geräte wie iPhone, Tablet oder was auch immer nun direkt über eine Verbindung zum Router oder über den Access Point mit dem Internet verbinden, das merkt man im täglichen Gebrauch nicht, man hat einfach "mehr Internet" im Haus.
So ist es zumindest gedacht - leider war das bei unserem Keller nicht ganz so einfach. Ich hatte nun zwar ein Signal bis ins Kino, welches aber immer wieder gerne abriss. Es reichte für absolute Kleinigkeiten, aber Musik-Streaming war nicht möglich.
Ich habe dann ein wenig rescherschiert und herausgefunden, dass gerade mit Rigips-Platten verschalte Räume extrem "gut" gegen WLAN abschirmen. Mir fiel aber auch auf, dass das Signal, wenn ich den Access Point oben aufs Billy-Regal stelle, durchaus brauchbar war. Nicht weltbewegend gut, aber zumindest war das Signal stabil.
Ich habe mich dann entschieden, eine der beiden Antennen des Access Points gegen eine verstärkte bidirektionale WLAN-Antenne auszutauschen. Auch hier wurde ich bei Amazon im Sortiment von TP-Link fündig.
 Meine Wahl fiel auf das Modell TL-ANT2408C (Kostenpunkt € 12). Diese Antenne ist ca. 30 cm hoch, steht auf einem stabilen Magnetfuß und hat ein ca. 1,5 m langes Kabel.
Meine Wahl fiel auf das Modell TL-ANT2408C (Kostenpunkt € 12). Diese Antenne ist ca. 30 cm hoch, steht auf einem stabilen Magnetfuß und hat ein ca. 1,5 m langes Kabel.
Nachdem ich eine der Access Point Antennen nun gegen die TL-ANT2408C ausgetauscht hatte, war von zu wenig Internet im Keller nichts mehr zu spüren. Die Antenne steht nun oben auf dem Billy-Regal, der Access Point selbst hängt an der Seite des Ikea-Regals.
Damit habe ich nun eine absolut stabile Internet-Verbindung im Keller, über die selbst die Trailer-Vorschau aus My Movies Pro ohne Unterbrechung und ohne Wartezeit funktioniert.
Ein weiteres nettes Detail des Access Points ist übrigens die mitgelieferte Stromversorgungs-Box. Mit der Box ist es möglich, den Access Point an Stellen zu installieren, an denen es keine Stromsteckdose gibt. Das einzige Kabel, dass dann zum Access Point führt, ist ein Netzwerk-Kabel, über das dann auch gleichzeitig die Stromversorgung geregelt wird.
Fazit: Die hier präsentierte Lösung bringt auch schwer zu erreichne Räume problemlos ins Internet und ermöglicht die volle Nutzung der Netzwerk-Funktionen moderner AV-Geräte. Dadurch, dass der Access Point nicht nur das WLAN erweitert, sondern auch noch einen 1-fach-Switch mitbringt (an den man natürlich weitere Switches dranhängen kann) finden auch kabelgebundene Geräte Anschluss. Für den Preis eine tolle Sache!
nachdem ich vor ein paar Wochen ja auf einen neuen AV-Receiver umgestiegen bin, dachte ich, dass es ja auch endlich mal an der Zeit wäre, im Keller eine funktionierende Internet-Verbindung zu haben.
Folgende Dinge sollten damit laufen:
1.) Musik-Streaming von der NAS zum AV-Receiver
2.) Internet-Radio
3.) Bedienung des AVR mit dem Android-Tablet (gerade bei NAS-Musik sehr übersichtlich)
4.) Komplette Filmverwaltung mit dem Android-Tablet und My Movies Pro
Jetzt haben wir ja an sich unseren WLAN-Router direkt im Wohnzimmer über dem Kino-Raum im Keller aufgestellt. Trotzdem drang über dieses eine Stockwerk kein brauchbares Signal mehr in den Keller.
Ich hatte daher nach einer Möglichkeit gesucht, das bestehende WLAN zu "verlängern". Die Lösung habe ich dabei im Access Point TL-WA801ND von TP-Link gefunden. Das kleine Ding kostet bei Amazon gerade mal € 30 und bietet neben der Verstärkung des WLAN-Signals auch noch einen kabelgebundenen Netzwerk-Anschluss. Den benötige ich, um den AV-Receiver anzuschließen, da der nur eine RJ45-Buchse hat.
 Was mir besonders gut gefallen hat, das war die kinderleichte Einrichtung des Access Points. Man schließt ihn per Kabel an den PC an, startet das Konfigurations-Programm von der beiliegenden CD und wird durch alle nötigen Schritte geführt. Nach wenigen Minuten ist der Access Point dann mit dem WLAN verbunden, das vom WLAN-Router bereitgestellt wird. Ob sich Geräte wie iPhone, Tablet oder was auch immer nun direkt über eine Verbindung zum Router oder über den Access Point mit dem Internet verbinden, das merkt man im täglichen Gebrauch nicht, man hat einfach "mehr Internet" im Haus.
Was mir besonders gut gefallen hat, das war die kinderleichte Einrichtung des Access Points. Man schließt ihn per Kabel an den PC an, startet das Konfigurations-Programm von der beiliegenden CD und wird durch alle nötigen Schritte geführt. Nach wenigen Minuten ist der Access Point dann mit dem WLAN verbunden, das vom WLAN-Router bereitgestellt wird. Ob sich Geräte wie iPhone, Tablet oder was auch immer nun direkt über eine Verbindung zum Router oder über den Access Point mit dem Internet verbinden, das merkt man im täglichen Gebrauch nicht, man hat einfach "mehr Internet" im Haus.So ist es zumindest gedacht - leider war das bei unserem Keller nicht ganz so einfach. Ich hatte nun zwar ein Signal bis ins Kino, welches aber immer wieder gerne abriss. Es reichte für absolute Kleinigkeiten, aber Musik-Streaming war nicht möglich.
Ich habe dann ein wenig rescherschiert und herausgefunden, dass gerade mit Rigips-Platten verschalte Räume extrem "gut" gegen WLAN abschirmen. Mir fiel aber auch auf, dass das Signal, wenn ich den Access Point oben aufs Billy-Regal stelle, durchaus brauchbar war. Nicht weltbewegend gut, aber zumindest war das Signal stabil.
Ich habe mich dann entschieden, eine der beiden Antennen des Access Points gegen eine verstärkte bidirektionale WLAN-Antenne auszutauschen. Auch hier wurde ich bei Amazon im Sortiment von TP-Link fündig.
 Meine Wahl fiel auf das Modell TL-ANT2408C (Kostenpunkt € 12). Diese Antenne ist ca. 30 cm hoch, steht auf einem stabilen Magnetfuß und hat ein ca. 1,5 m langes Kabel.
Meine Wahl fiel auf das Modell TL-ANT2408C (Kostenpunkt € 12). Diese Antenne ist ca. 30 cm hoch, steht auf einem stabilen Magnetfuß und hat ein ca. 1,5 m langes Kabel.Nachdem ich eine der Access Point Antennen nun gegen die TL-ANT2408C ausgetauscht hatte, war von zu wenig Internet im Keller nichts mehr zu spüren. Die Antenne steht nun oben auf dem Billy-Regal, der Access Point selbst hängt an der Seite des Ikea-Regals.
Damit habe ich nun eine absolut stabile Internet-Verbindung im Keller, über die selbst die Trailer-Vorschau aus My Movies Pro ohne Unterbrechung und ohne Wartezeit funktioniert.
Ein weiteres nettes Detail des Access Points ist übrigens die mitgelieferte Stromversorgungs-Box. Mit der Box ist es möglich, den Access Point an Stellen zu installieren, an denen es keine Stromsteckdose gibt. Das einzige Kabel, dass dann zum Access Point führt, ist ein Netzwerk-Kabel, über das dann auch gleichzeitig die Stromversorgung geregelt wird.
Fazit: Die hier präsentierte Lösung bringt auch schwer zu erreichne Räume problemlos ins Internet und ermöglicht die volle Nutzung der Netzwerk-Funktionen moderner AV-Geräte. Dadurch, dass der Access Point nicht nur das WLAN erweitert, sondern auch noch einen 1-fach-Switch mitbringt (an den man natürlich weitere Switches dranhängen kann) finden auch kabelgebundene Geräte Anschluss. Für den Preis eine tolle Sache!
Ausblick: Leinwandmaskierung
3. Dezember 2011- UPDATE 13. April 2013 -
Tja, obwohl ich das alles so schön geplant hatte, ist irgendwie docj nie etwas aus dem Projekt "Leinwandmaskierung" geworden. Seit letzte Woche habe ich jetzt eine neue Leinwand, die direkt eine Maskierung "eingebaut" hat. Eine sehr saubere und alltagstaugliche Lösung. Einziger Nachteil der Fertiglösung: es gibt "nur" 2 Formate, 16:9 und 21:9. Somit können extrem breite Filme wie die Monumentalstreifen der 1950er und 1960er nicht vollständig maskiert werden. So viele habe ich davon aber nicht in der Sammlung, ich kann's also verschmerzen.
----
Hallo zusammen,
anbei eine kleiner Ausblick auf ein Mini-Projekt, das ich zwischen Weihnachten und Neujahr in Angriff nehmen werde. Nachdem ich mich letzte Woche von den Vorteilen einer Leinwandmaskierung überzeugen konnte, habe ich beschlossen, mir eine solche nun auch zu gönnen.
Als Basis dienen Magnet- und Metall-Bänder, die die Maskierung in der Führung halten sollen. Die Maskierung wird dann manuell verschoben. So stelle ich mir das zumindest vor :)
Und so soll es dann aussehen:

Bitte nicht von dem braunen Holz irritieren lassen. Das ist nur in der Zeichnung so und wird nachher natürlich komplett schwarz sein. Als Maskierung wird verstärktes Sperrholz dienen, auf das dann schwarzes Filz-DC-Fix gezogen wird.
Bin schon gespannt, ob das alles so klappt, wie ich es mir vorstelle.
Viele Grüße
Markus
Tja, obwohl ich das alles so schön geplant hatte, ist irgendwie docj nie etwas aus dem Projekt "Leinwandmaskierung" geworden. Seit letzte Woche habe ich jetzt eine neue Leinwand, die direkt eine Maskierung "eingebaut" hat. Eine sehr saubere und alltagstaugliche Lösung. Einziger Nachteil der Fertiglösung: es gibt "nur" 2 Formate, 16:9 und 21:9. Somit können extrem breite Filme wie die Monumentalstreifen der 1950er und 1960er nicht vollständig maskiert werden. So viele habe ich davon aber nicht in der Sammlung, ich kann's also verschmerzen.
----
Hallo zusammen,
anbei eine kleiner Ausblick auf ein Mini-Projekt, das ich zwischen Weihnachten und Neujahr in Angriff nehmen werde. Nachdem ich mich letzte Woche von den Vorteilen einer Leinwandmaskierung überzeugen konnte, habe ich beschlossen, mir eine solche nun auch zu gönnen.
Als Basis dienen Magnet- und Metall-Bänder, die die Maskierung in der Führung halten sollen. Die Maskierung wird dann manuell verschoben. So stelle ich mir das zumindest vor :)
Und so soll es dann aussehen:

Bitte nicht von dem braunen Holz irritieren lassen. Das ist nur in der Zeichnung so und wird nachher natürlich komplett schwarz sein. Als Maskierung wird verstärktes Sperrholz dienen, auf das dann schwarzes Filz-DC-Fix gezogen wird.
Bin schon gespannt, ob das alles so klappt, wie ich es mir vorstelle.
Viele Grüße
Markus
Filme verwalten mit My Movies Pro
3. Dezember 2011Hallo zusammen,
nachdem es die letzten Monate ja eher leise um mein liebstes Hobby war (also, zumindest hier im Blog, im Keller war es schon das eine oder andere Mal laut ;-) ), möchte ich euch heute von einer Filmverwaltungs-Software berichten, die ich für mich neuentdeckt habe.
Die Software, um die es heute geht heißt
My Movies Pro (€ 11,99 für Mac, € 3,99 für iOS und Android)
Das Tolle an My Movies Pro ist, dass es die Software sowohl für Windows als auch Mac, aber auch für mobile Plattformen wie Android und iOS gibt. Alle Versionen greifen, sobald man seine Filme erfasst hat, auf eine überall verfügbare Bibliothek in der "Cloud" zu. Das bedeutet, dass grundlegende Daten zur Filmsammlung zwar schon lokal auf jedem verwendeten Gerät liegen (man muss also nicht online sein, um sich seine Sammlung anzuschauen), die Bibliothek an sich aber extern auf einem Server gespeichert ist. Großer Vorteil: man kann mit zig Geräten auf die einmal angelegte Bibliothek zugreifen.
Wie bin ich nun auf My Movies Pro gekommen? Nun, ich verwende seit Jahren DVDPedia für den Mac. Im Keller habe ich damit immer ein altes Apple Powerbook G3 verwendet, um zu schauen, in welchem Slot meiner vier Dacal CD-Libraries der gewünschte Film liegt. Das lief an sich sehr gut, war aber auch recht langsam und ich musste immer schauen, dass ich die Daten auf sämtichen Rechnern, auf denen DVDPedia läuft, abgleiche.
Was ich mir außerdem gewünscht hätte, wäre eine App für iOS oder Android, sodass ich nicht jedesmal das Powerbook hochfahren muss, nur um einen Film nachzuschlagen. Außerdem möchte meine Frau auch gerne immer wissen, welche Filme wir schon haben und da lag es nahe, dass sie die alle auf ihrem iPod touch, den sie immer mit dabei hat, sehen kann.
Und so sieht das ganze dann unter Mac OS aus:

Oder als Liste:
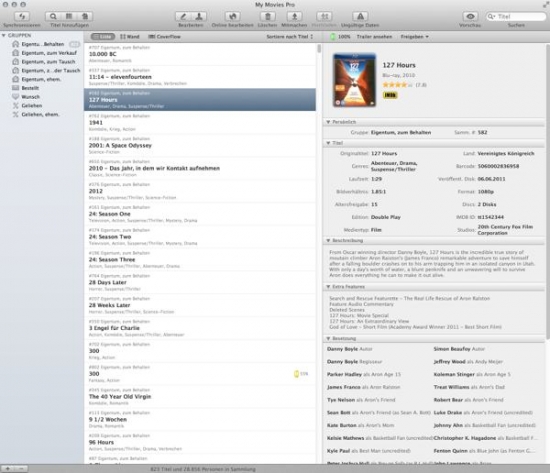
Oder als Coverflow-Ansicht:

Die Daten bei der Neuanlage eines Titels werden aus einer eigenen Datenbank von My Movies gefüllt. An deren Verbesserung kann man sich wie beim DVD Profiler auch gerne selbst beteiligen. Internationale Fassungen sind natürlich vorhanden, sodass man auch für Code-1-DVDs aus den USA die passenden Covers und Infos in seiner Bibliothek hat. Die Datenbank scheint gut gepflegt zu sein, denn ich musste nur bei wenigen Titeln selbst Hand anlegen.
Wenn man alle seine Filme eingetragen hat (falls man vorher bereits ein anderes Verwaltungsprogramm im Einsatz hatte, dann bietet My Movies Pro verschiedene Import-Optionen für bestehende Datensätze), kann man nach Lust und Laune in der Sammlung stöbern. Verschiedene Suchfilter (z.B. das Veröffentlichungsdatum der Filme, die Länge etc.) stehen zur Verfügung und können kombiniert werden.
Hat man einen Film gefunden und ausgewählt, dann kann man sich (falls bei YouTube vorhanden) den Trailer anzeigen lassen. Oder man klickt auf einen der Schauspieler und erhält die Biographie aus der IMDB. Oder man lässt sich alle Schauspieler in allen Filmen anzeigen und erhält dann bei Klick auf den Namen sämtliche Filme in der Sammlung, in denen die Person mitspielt.
Natürlich ist eine manuelle Bearbeitung der automatisch hinzugefügten Infos möglich, eine Möglichkeit, eigene Datenfelder hinzuzufügen, habe ich leider bisher nicht gefunden. Diesen Punkt kann ich aber durchaus verschmerzen, da die bereitgestellten Felder schon sehr vielfältig sind.
Wie sieht's denn mit den mobilen Version von My Movies Pro aus? Nicht viel anders!
Auch hier können sämtliche Funktionen genutzt werden, die Android und iOS App bieten z.B. auch die Nutzung der eingebauten Kamera zum Erfassen neuer Filme per Barcode-Scan an.
Und so sieht es dann auf dem iPad aus:
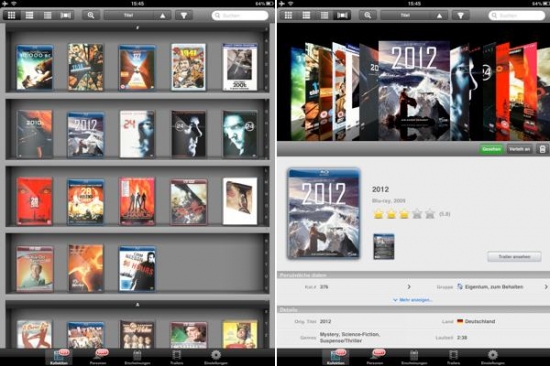
Fazit: Ich finde den Leistungsumfang von My Movies Pro sehr gut und durchdacht und ich denke, dass ich mir für die Filmverwaltung im Keller jetzt noch ein günstiges Android-Tabelt holen werde. Einziger Haken: Man muss My Movies Pro für jede Plattform, auf der man es nutzen möchte, neu kaufen. Soll heißen: man bezahlt für die Mac-Version (€ 11,99), für die iOS-Version (€ 3,99) und auch für die Android-Version (€ 3,99). Ein Bundle habe ich leider nicht gefunden. Davon aber abgesehen eine tolle Sache!
nachdem es die letzten Monate ja eher leise um mein liebstes Hobby war (also, zumindest hier im Blog, im Keller war es schon das eine oder andere Mal laut ;-) ), möchte ich euch heute von einer Filmverwaltungs-Software berichten, die ich für mich neuentdeckt habe.
Die Software, um die es heute geht heißt
My Movies Pro (€ 11,99 für Mac, € 3,99 für iOS und Android)
Das Tolle an My Movies Pro ist, dass es die Software sowohl für Windows als auch Mac, aber auch für mobile Plattformen wie Android und iOS gibt. Alle Versionen greifen, sobald man seine Filme erfasst hat, auf eine überall verfügbare Bibliothek in der "Cloud" zu. Das bedeutet, dass grundlegende Daten zur Filmsammlung zwar schon lokal auf jedem verwendeten Gerät liegen (man muss also nicht online sein, um sich seine Sammlung anzuschauen), die Bibliothek an sich aber extern auf einem Server gespeichert ist. Großer Vorteil: man kann mit zig Geräten auf die einmal angelegte Bibliothek zugreifen.
Wie bin ich nun auf My Movies Pro gekommen? Nun, ich verwende seit Jahren DVDPedia für den Mac. Im Keller habe ich damit immer ein altes Apple Powerbook G3 verwendet, um zu schauen, in welchem Slot meiner vier Dacal CD-Libraries der gewünschte Film liegt. Das lief an sich sehr gut, war aber auch recht langsam und ich musste immer schauen, dass ich die Daten auf sämtichen Rechnern, auf denen DVDPedia läuft, abgleiche.
Was ich mir außerdem gewünscht hätte, wäre eine App für iOS oder Android, sodass ich nicht jedesmal das Powerbook hochfahren muss, nur um einen Film nachzuschlagen. Außerdem möchte meine Frau auch gerne immer wissen, welche Filme wir schon haben und da lag es nahe, dass sie die alle auf ihrem iPod touch, den sie immer mit dabei hat, sehen kann.
Und so sieht das ganze dann unter Mac OS aus:

Oder als Liste:
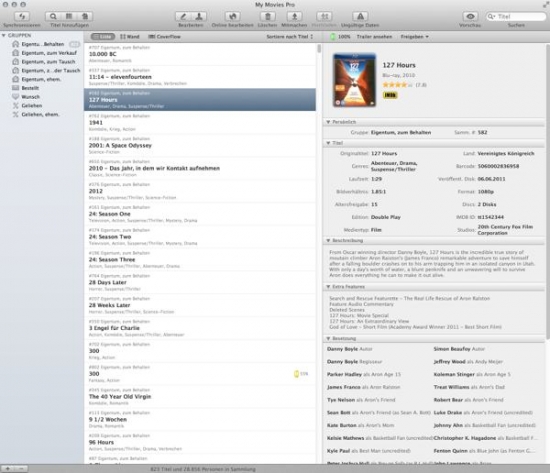
Oder als Coverflow-Ansicht:

Die Daten bei der Neuanlage eines Titels werden aus einer eigenen Datenbank von My Movies gefüllt. An deren Verbesserung kann man sich wie beim DVD Profiler auch gerne selbst beteiligen. Internationale Fassungen sind natürlich vorhanden, sodass man auch für Code-1-DVDs aus den USA die passenden Covers und Infos in seiner Bibliothek hat. Die Datenbank scheint gut gepflegt zu sein, denn ich musste nur bei wenigen Titeln selbst Hand anlegen.
Wenn man alle seine Filme eingetragen hat (falls man vorher bereits ein anderes Verwaltungsprogramm im Einsatz hatte, dann bietet My Movies Pro verschiedene Import-Optionen für bestehende Datensätze), kann man nach Lust und Laune in der Sammlung stöbern. Verschiedene Suchfilter (z.B. das Veröffentlichungsdatum der Filme, die Länge etc.) stehen zur Verfügung und können kombiniert werden.
Hat man einen Film gefunden und ausgewählt, dann kann man sich (falls bei YouTube vorhanden) den Trailer anzeigen lassen. Oder man klickt auf einen der Schauspieler und erhält die Biographie aus der IMDB. Oder man lässt sich alle Schauspieler in allen Filmen anzeigen und erhält dann bei Klick auf den Namen sämtliche Filme in der Sammlung, in denen die Person mitspielt.
Natürlich ist eine manuelle Bearbeitung der automatisch hinzugefügten Infos möglich, eine Möglichkeit, eigene Datenfelder hinzuzufügen, habe ich leider bisher nicht gefunden. Diesen Punkt kann ich aber durchaus verschmerzen, da die bereitgestellten Felder schon sehr vielfältig sind.
Wie sieht's denn mit den mobilen Version von My Movies Pro aus? Nicht viel anders!
Auch hier können sämtliche Funktionen genutzt werden, die Android und iOS App bieten z.B. auch die Nutzung der eingebauten Kamera zum Erfassen neuer Filme per Barcode-Scan an.
Und so sieht es dann auf dem iPad aus:
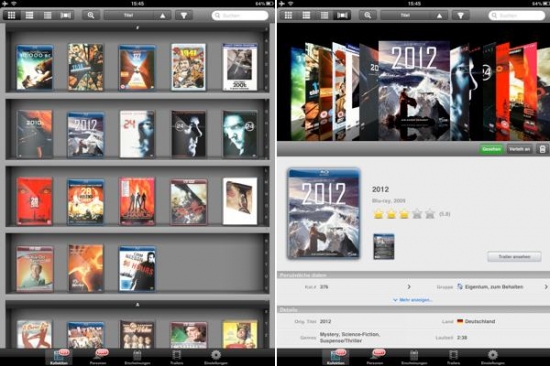
Fazit: Ich finde den Leistungsumfang von My Movies Pro sehr gut und durchdacht und ich denke, dass ich mir für die Filmverwaltung im Keller jetzt noch ein günstiges Android-Tabelt holen werde. Einziger Haken: Man muss My Movies Pro für jede Plattform, auf der man es nutzen möchte, neu kaufen. Soll heißen: man bezahlt für die Mac-Version (€ 11,99), für die iOS-Version (€ 3,99) und auch für die Android-Version (€ 3,99). Ein Bundle habe ich leider nicht gefunden. Davon aber abgesehen eine tolle Sache!
Hallo zusammen.
letzte Woche habe ich mir mal wieder ein neues Spielzeug für den Kinokeller gegönnt. Ich hatte schon immer mal lose mit dem Gedanken gespielt, eines unserer beiden Ikea Klippan Sofas mit einem Körperschallüberträger wie z.B. denen von Buttkicker oder iBeam auszurüsten. Letzte Woche war es dann soweit.
Einge werden sich jetzt sicherlich fragen: Was um alles in der Welt ist denn ein Buttkicker?!
Ganz einfach: der Buttkicker ist eine Art Lautsprecher, der das Signal des Subwooferkanals eines AV-Receivers nicht als tieffrequente Töne wiedergibt, sondern diese in Bewegungsenergie verwandelt. Befestigt man einen solchen Körperschallwandler z.B. an einem Sofa, dann versetzt er das Sofa synchron zum Subwoofer, den man ja hört, in Schwingungen, sodass man das Aufstampfen eines Dinosauriers bei Jurassic Park oder den Sternenzerstörer bei Star Wars nicht nur hört, sondern am eigenen Leib spürt.
Es gibt solche Geräte von verschiedenen Herstellern und ich hatte mich letztendlich für ein Produkt der in dieser Sparte seit Jahren tätigen Firma Buttkicker entschieden.
 Die Wahl fiel auf das Buttkicker-Komplet-Set BK-Kit-4. Das Set beinhaltet alles, was man braucht, um eine Couch auf einfache Art und Weise mit einem Buttkicker zu versehen, sogar ein Verstärker, der das Subwoofer-Signal vom AV-Receiver per Funk empfängt, ist mit dabei, was den Verkabelungsaufwand massiv vereinfacht.
Die Wahl fiel auf das Buttkicker-Komplet-Set BK-Kit-4. Das Set beinhaltet alles, was man braucht, um eine Couch auf einfache Art und Weise mit einem Buttkicker zu versehen, sogar ein Verstärker, der das Subwoofer-Signal vom AV-Receiver per Funk empfängt, ist mit dabei, was den Verkabelungsaufwand massiv vereinfacht.
Ansonsten wird ein kompletter Kabelsatz mitgeliefert, mit dem man neben dem bereits angeschlossenen Subwoofer den Buttkicker einschleifen kann. Der mitgelieferte Digital-Verstärker hat noch eine kleine Fernbedienung für die Lautstärke, An/Aus und die Wahl von 3 Equalizer-Kurven.
Was den schnellen Aufbau aber besonders einfach macht, das ist die mitgelieferte Montageplatte. Auf diese kann man den Buttkicker schrauben und die andere Seite der Platte kommt dann unter ein Bein des Sofas oder des Sessels. Damit die Höhe des nun etwas höher stehenden Sofas für die anderen Beine ausgeglichen werden kann, liegen auch noch 5 Gummidämpfer mit im Paket, die auch dafür sorgen, dass das Sofa nach Installation schwingen kann. Das muss es nämlich, denn das ist es, was der Buttkicker macht: das Sofa in Schwingungen versetzen.
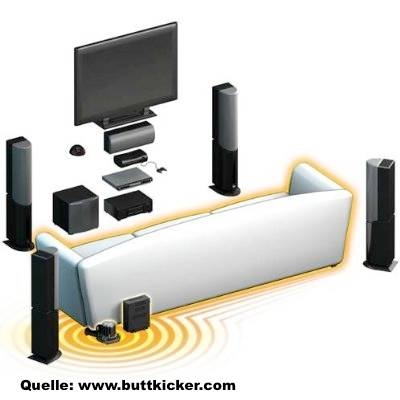 Das Funktionsprinzip kann man sehr schön an dem Bild rechts von der Hersteller-Seite des Buttkickers erkennen:
Das Funktionsprinzip kann man sehr schön an dem Bild rechts von der Hersteller-Seite des Buttkickers erkennen:
Unter einem Sofa-Bein steht die Platte mit Buttkicker, in der Nähe der Buttkicker-Verstärker, der mit Lautsprecherkabel am Buttkicker angeschlossen ist und sein Signal per Funk von einem kleinen Sender empfängt, der über ein Y-Kabel am AV-Receiver parallel zum Subwoofer angeschlossen ist. Alles ganz einfach und unkompliziert, der Aufbau dauert gerade mal 20 Minuten und dann kann man auch schon anfangen zu testen. In dem Paket ist tatsächlich alles drin, um den Buttkicker ohne Probleme in Betrieb zu nehmen.
Am Mittwoch hatte ich das dann auch allles genau so aufgebaut. Und war enttäuscht. Je nachdem, ob die Platte unter ein vorderes oder hinteres Bein gestellt wurde, spürte man leichtes Vibrieren entweder in der Sitzfläche oder im Rücken. Richtig "satt" fühlte sich das aber alles nicht an. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass die Vibration mit den Tönen des Subwoofers nicht in Phase spielten, sich also irgendwie auslöschten.
Das musste besser gehen, schließlich ist Buttkicker der Marktführer in dem Bereich. Ich kam also zu dem Schluss, dass es an der Konstruktion des Ikea Klippan liegen muss, dass die Vibrationen des Buttkickers nicht so richtig erdbeben-ähnlich rüberkommen wollen.
Heute habe ich dann das Sofa auf den Kopf gestellt und geschaut, was man da an der Kontruktion verstärken kann. Nicht viel, denn wenn man den Staubschutz auf der Unterseite entfernt, dann kommt Styropor zum Vorschein, Unmengen an Styropor, der eingerahmt wird von einem Holzrahmen.
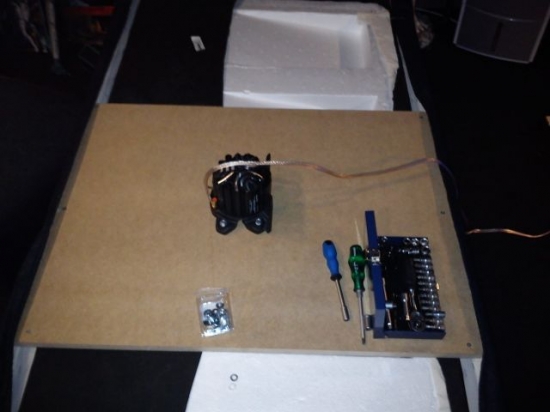 Meine Idee war dann eine Holzplatte zu montieren, die die beiden langen Seiten des Rahmens stabil miteinander verbindet, und den Buttkicker dann direkt mittig auf diese Platte zu schrauben.
Meine Idee war dann eine Holzplatte zu montieren, die die beiden langen Seiten des Rahmens stabil miteinander verbindet, und den Buttkicker dann direkt mittig auf diese Platte zu schrauben.
Gesagt, getan! Der Buttkicker regt jetzt also nicht mehr nur ein Bein des Sofas an, sondern direkt den Rahmen.
Nach diesem kleinen Upgrade (die Gummidämpfer werden auch hier wieder unter alle Beine des Sofas gestellt), machte ich den ersten Testlauf mit dem Anfang von Star Wars Episode 4: der Sternenzerstörer, der über den Zuschauer hinwegfliegt. Und es stellte sich ein breites zufriedenes Grinsen ein. Die ganze Couch vibriert sehr tief und differenziert. Es fängt dezent an und steigert sich, je näher der Sternenzerstörer kommt.
Ok, tief kann er also, der Buttkicker. Wie aber sieht es mit der Schnelligkeit aus? Dazu habe ich die erste Schlacht aus Master & Commander zum Testen herangezogen. Die Kanonschüsse kommen hier sehr schnell und druckvoll. Und auch hier kann der Buttkicker überzeugen und macht genau das, was sein Name suggeriert: er tritt einem bei jedem Schuss dermaßen in den Hintern, dass ich schon Angst um das gute alte Klippan hatte.
Weitere Tests mit verschiedenen Demo- und Trailer-DVDs zeigen das gleiche Bild: toll! Es ist teilweise unglaublich, wie viel tieffrequente Energie in einem Soundtrack steckt, die man bisher nur ansatzweise erlebt hat. Ich muss sagen, eine wirklche Bereicherung, gerade bei Action-Filmen.

Den Effekt kann man über die mitgelieferte Fernbedienung sehr schön regulieren und ich denke auch, dass ich den Buttkicker anfänglich stärker eingestellt habe, als es eigentlich nötig wäre. Aber es macht einfach zu viel Spaß, auszuloten, wie sehr das Sofa beben kann.
Rechts ein Bild des kleinen Ungetüms. Es besteht komplett aus Druckguss, hat stabile gefederte Klemmen fürs Lautsprecherkabel, die auch hohe Querschnitte aufnehmen. Der mitgelieferte BASH-Verstärker wird gerade mal handwarm und leistet 300 Watt. Er ist genau auf den mitgelieferten Buttkicker Advance abgestimmt, als ein rundes Paket.
Fazit: Für nicht gerade kleine € 500 erhält der Käufer des Buttkicker BK-4-Sets ein Rundum-Sorglos-Paket für den Einstieg in die Welt der Körperschallübertragung. Der zu erzielende Effekt ist sicherlich immer vom verwendeten Sofa abhängig, daher muss man ein wenig probieren, bis man den perfekten Effekt erzielt hat. Dann fügt der Buttkicker dem Filmeschauen aber eine neue bisher ungefühlte Dimension hinzu. Nach dem kleinen Modifikation der Couch war auch das zuvor festgestellt Auslöschen von Subwoofer und Buttkicker wie weggeblasen.
In diesem Sinne: wer es rütteln lassen möchte, der kann zugreifen!
Danke fürs Lesen und viele Grüße
Markus
letzte Woche habe ich mir mal wieder ein neues Spielzeug für den Kinokeller gegönnt. Ich hatte schon immer mal lose mit dem Gedanken gespielt, eines unserer beiden Ikea Klippan Sofas mit einem Körperschallüberträger wie z.B. denen von Buttkicker oder iBeam auszurüsten. Letzte Woche war es dann soweit.
Einge werden sich jetzt sicherlich fragen: Was um alles in der Welt ist denn ein Buttkicker?!
Ganz einfach: der Buttkicker ist eine Art Lautsprecher, der das Signal des Subwooferkanals eines AV-Receivers nicht als tieffrequente Töne wiedergibt, sondern diese in Bewegungsenergie verwandelt. Befestigt man einen solchen Körperschallwandler z.B. an einem Sofa, dann versetzt er das Sofa synchron zum Subwoofer, den man ja hört, in Schwingungen, sodass man das Aufstampfen eines Dinosauriers bei Jurassic Park oder den Sternenzerstörer bei Star Wars nicht nur hört, sondern am eigenen Leib spürt.
Es gibt solche Geräte von verschiedenen Herstellern und ich hatte mich letztendlich für ein Produkt der in dieser Sparte seit Jahren tätigen Firma Buttkicker entschieden.
 Die Wahl fiel auf das Buttkicker-Komplet-Set BK-Kit-4. Das Set beinhaltet alles, was man braucht, um eine Couch auf einfache Art und Weise mit einem Buttkicker zu versehen, sogar ein Verstärker, der das Subwoofer-Signal vom AV-Receiver per Funk empfängt, ist mit dabei, was den Verkabelungsaufwand massiv vereinfacht.
Die Wahl fiel auf das Buttkicker-Komplet-Set BK-Kit-4. Das Set beinhaltet alles, was man braucht, um eine Couch auf einfache Art und Weise mit einem Buttkicker zu versehen, sogar ein Verstärker, der das Subwoofer-Signal vom AV-Receiver per Funk empfängt, ist mit dabei, was den Verkabelungsaufwand massiv vereinfacht.Ansonsten wird ein kompletter Kabelsatz mitgeliefert, mit dem man neben dem bereits angeschlossenen Subwoofer den Buttkicker einschleifen kann. Der mitgelieferte Digital-Verstärker hat noch eine kleine Fernbedienung für die Lautstärke, An/Aus und die Wahl von 3 Equalizer-Kurven.
Was den schnellen Aufbau aber besonders einfach macht, das ist die mitgelieferte Montageplatte. Auf diese kann man den Buttkicker schrauben und die andere Seite der Platte kommt dann unter ein Bein des Sofas oder des Sessels. Damit die Höhe des nun etwas höher stehenden Sofas für die anderen Beine ausgeglichen werden kann, liegen auch noch 5 Gummidämpfer mit im Paket, die auch dafür sorgen, dass das Sofa nach Installation schwingen kann. Das muss es nämlich, denn das ist es, was der Buttkicker macht: das Sofa in Schwingungen versetzen.
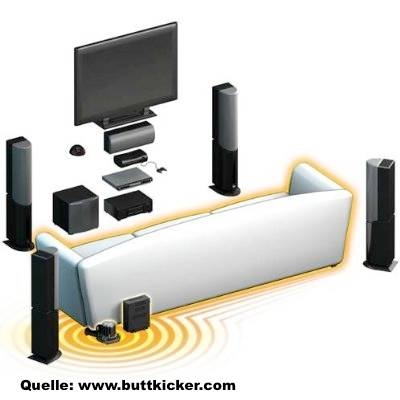 Das Funktionsprinzip kann man sehr schön an dem Bild rechts von der Hersteller-Seite des Buttkickers erkennen:
Das Funktionsprinzip kann man sehr schön an dem Bild rechts von der Hersteller-Seite des Buttkickers erkennen:Unter einem Sofa-Bein steht die Platte mit Buttkicker, in der Nähe der Buttkicker-Verstärker, der mit Lautsprecherkabel am Buttkicker angeschlossen ist und sein Signal per Funk von einem kleinen Sender empfängt, der über ein Y-Kabel am AV-Receiver parallel zum Subwoofer angeschlossen ist. Alles ganz einfach und unkompliziert, der Aufbau dauert gerade mal 20 Minuten und dann kann man auch schon anfangen zu testen. In dem Paket ist tatsächlich alles drin, um den Buttkicker ohne Probleme in Betrieb zu nehmen.
Am Mittwoch hatte ich das dann auch allles genau so aufgebaut. Und war enttäuscht. Je nachdem, ob die Platte unter ein vorderes oder hinteres Bein gestellt wurde, spürte man leichtes Vibrieren entweder in der Sitzfläche oder im Rücken. Richtig "satt" fühlte sich das aber alles nicht an. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass die Vibration mit den Tönen des Subwoofers nicht in Phase spielten, sich also irgendwie auslöschten.
Das musste besser gehen, schließlich ist Buttkicker der Marktführer in dem Bereich. Ich kam also zu dem Schluss, dass es an der Konstruktion des Ikea Klippan liegen muss, dass die Vibrationen des Buttkickers nicht so richtig erdbeben-ähnlich rüberkommen wollen.
Heute habe ich dann das Sofa auf den Kopf gestellt und geschaut, was man da an der Kontruktion verstärken kann. Nicht viel, denn wenn man den Staubschutz auf der Unterseite entfernt, dann kommt Styropor zum Vorschein, Unmengen an Styropor, der eingerahmt wird von einem Holzrahmen.
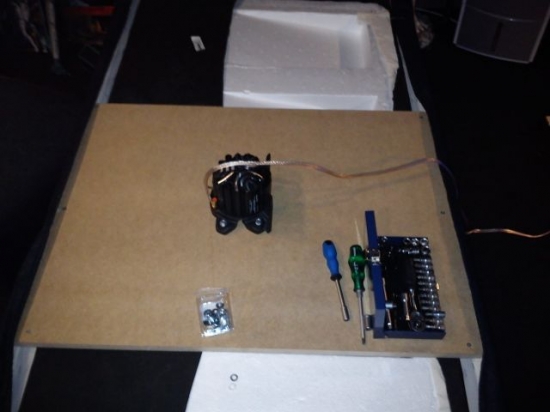 Meine Idee war dann eine Holzplatte zu montieren, die die beiden langen Seiten des Rahmens stabil miteinander verbindet, und den Buttkicker dann direkt mittig auf diese Platte zu schrauben.
Meine Idee war dann eine Holzplatte zu montieren, die die beiden langen Seiten des Rahmens stabil miteinander verbindet, und den Buttkicker dann direkt mittig auf diese Platte zu schrauben.Gesagt, getan! Der Buttkicker regt jetzt also nicht mehr nur ein Bein des Sofas an, sondern direkt den Rahmen.
Nach diesem kleinen Upgrade (die Gummidämpfer werden auch hier wieder unter alle Beine des Sofas gestellt), machte ich den ersten Testlauf mit dem Anfang von Star Wars Episode 4: der Sternenzerstörer, der über den Zuschauer hinwegfliegt. Und es stellte sich ein breites zufriedenes Grinsen ein. Die ganze Couch vibriert sehr tief und differenziert. Es fängt dezent an und steigert sich, je näher der Sternenzerstörer kommt.
Ok, tief kann er also, der Buttkicker. Wie aber sieht es mit der Schnelligkeit aus? Dazu habe ich die erste Schlacht aus Master & Commander zum Testen herangezogen. Die Kanonschüsse kommen hier sehr schnell und druckvoll. Und auch hier kann der Buttkicker überzeugen und macht genau das, was sein Name suggeriert: er tritt einem bei jedem Schuss dermaßen in den Hintern, dass ich schon Angst um das gute alte Klippan hatte.
Weitere Tests mit verschiedenen Demo- und Trailer-DVDs zeigen das gleiche Bild: toll! Es ist teilweise unglaublich, wie viel tieffrequente Energie in einem Soundtrack steckt, die man bisher nur ansatzweise erlebt hat. Ich muss sagen, eine wirklche Bereicherung, gerade bei Action-Filmen.

Den Effekt kann man über die mitgelieferte Fernbedienung sehr schön regulieren und ich denke auch, dass ich den Buttkicker anfänglich stärker eingestellt habe, als es eigentlich nötig wäre. Aber es macht einfach zu viel Spaß, auszuloten, wie sehr das Sofa beben kann.
Rechts ein Bild des kleinen Ungetüms. Es besteht komplett aus Druckguss, hat stabile gefederte Klemmen fürs Lautsprecherkabel, die auch hohe Querschnitte aufnehmen. Der mitgelieferte BASH-Verstärker wird gerade mal handwarm und leistet 300 Watt. Er ist genau auf den mitgelieferten Buttkicker Advance abgestimmt, als ein rundes Paket.
Fazit: Für nicht gerade kleine € 500 erhält der Käufer des Buttkicker BK-4-Sets ein Rundum-Sorglos-Paket für den Einstieg in die Welt der Körperschallübertragung. Der zu erzielende Effekt ist sicherlich immer vom verwendeten Sofa abhängig, daher muss man ein wenig probieren, bis man den perfekten Effekt erzielt hat. Dann fügt der Buttkicker dem Filmeschauen aber eine neue bisher ungefühlte Dimension hinzu. Nach dem kleinen Modifikation der Couch war auch das zuvor festgestellt Auslöschen von Subwoofer und Buttkicker wie weggeblasen.
In diesem Sinne: wer es rütteln lassen möchte, der kann zugreifen!
Danke fürs Lesen und viele Grüße
Markus
Wie die Zeit vergeht - AV-Receiver im Laufe der Jahre
15. Juli 2011Hallo zusammen,
ich weiß gar nicht, wie ich letzte Woche darauf kam, aber irgendwie fing ich an, einmal darüber nachzudenken, wie das denn alles mit Heimkino bei mir angefangen hat. Dabei fiel mir dann auf, dass ich den letzten Jahren doch eine ziemliche Anzahl an AV-Verstärker und -Receivern bei mir rumstehen hatte. Diese möchte ich euch heute, quasi im Wandel der Zeit, einmal vorstellen (Bildrechte liegen bei den Herstellern der Geräte).
1993 - Das Jahr, in dem alles anfing

Den Anfang machte damals ein JVC RX-705. Dabei handelte es sich um einen Dolby Pro-Logic Receiver, der zwar den passenden Dekoder, aber leider nicht die Endstufe für den Center-Kanal mitbrachte.
Was den JVC damals auszeichnete, dass war ein elektronischer grafischer 7-Band-Equalizer, der aber leider auf alle angeschlossenen Lautsprecher gleich wirkte. Nicht wirklich sinnvoll, aber damals war ich absolut begeistert.
1994 - Der Yamaha ist des JVCs Tod

Nachdem ich bei Saturn in Köln bei den "Yamaha Surround Tagen" den DSP-A970 gehört hatte, war es um mich geschehen. Klanglich und von der Verarbeitung her war er gar kein Vergleich zum JVC. Wo der am Anfang von "The Abyss" an der Stelle, an der die Boje von vorne nach hinten durchs Zimmer schießt, eine Rauschfahne produzierte, schälte der Yamaha den Effekt glasklar heraus. Selten hatte ich eine so offensichtliche Verbesserung gehört. Ich hatte Glück, mein JVC-Händler hatte auch Yamaha im Programm und nahm den JVC in Zahlung :-)
1996 - Dolby Digital muss es sein
 Nachdem sich zum DSP-A970 schnell auch ein erster und dann ein zweiter Laserdisc-Player hinzugesellt hatten, war 1996 der Zeitpunkt gekommen, um auf den Dolby Digital Zug aufzuspringen. Da ich damals sehr günstig an NTSC-LDs aus den USA rankam, lag es nahe den Multiformat-LD-Player mit einem AC3-RF-Ausgang auszustatten und den DSP-A970 gegen einen brandneuen Yamaha DSP-A3090 einzutauschen. Mannomann, habe ich auf dieses Gerät gewartet. Ich hatte schon in amerikanischen Magazinen darüber gelesen und konnte es kaum abwarten, bis der 3090 in Europa erhältlich war. Letztendlich habe ich dann den ersten 3090, der in den Niederlanden ausgeliefert wurde, bekomme. Preis: 3500 DM. Aber die erste AC-3-LD ("Clear and present Danger") und viele andere waren es wert!
Nachdem sich zum DSP-A970 schnell auch ein erster und dann ein zweiter Laserdisc-Player hinzugesellt hatten, war 1996 der Zeitpunkt gekommen, um auf den Dolby Digital Zug aufzuspringen. Da ich damals sehr günstig an NTSC-LDs aus den USA rankam, lag es nahe den Multiformat-LD-Player mit einem AC3-RF-Ausgang auszustatten und den DSP-A970 gegen einen brandneuen Yamaha DSP-A3090 einzutauschen. Mannomann, habe ich auf dieses Gerät gewartet. Ich hatte schon in amerikanischen Magazinen darüber gelesen und konnte es kaum abwarten, bis der 3090 in Europa erhältlich war. Letztendlich habe ich dann den ersten 3090, der in den Niederlanden ausgeliefert wurde, bekomme. Preis: 3500 DM. Aber die erste AC-3-LD ("Clear and present Danger") und viele andere waren es wert!
1999 - DTS muss her!
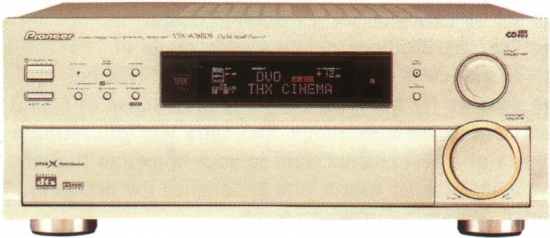 Leider hatte der DSP-A3090 aber noch keinen DTS-Dekoder und auch keine Möglichkeit, einen externen Dekoder anzuschließen. Daher folgte 1999 mein erster THX-Receiver, ein Pioneer VSX-908RDS. Tolles Gerät, toller Klang (die Rauschabstände waren jedoch ein wenig knapp). Leider hatte der Pioneer aber einen Serienfehler im Eingangsboard. Die Reparatur dauerte so lange, dass ich mir bei meinem Händler ein anderes Gerät aussuchen durfte.
Leider hatte der DSP-A3090 aber noch keinen DTS-Dekoder und auch keine Möglichkeit, einen externen Dekoder anzuschließen. Daher folgte 1999 mein erster THX-Receiver, ein Pioneer VSX-908RDS. Tolles Gerät, toller Klang (die Rauschabstände waren jedoch ein wenig knapp). Leider hatte der Pioneer aber einen Serienfehler im Eingangsboard. Die Reparatur dauerte so lange, dass ich mir bei meinem Händler ein anderes Gerät aussuchen durfte.
2001 - Eine kurze Denon-Episode

Meine Wahl viel auf den damals hochgelobten Denon AVR-3802. Hochgelobt, aber mir gefiel er leider überhaupt nicht. Ich hatte noch nie einen derart langweilig klingenden AV-Receiver gehört. Daher kam der Denon schnell wieder weg.
2002 - Eine zweite Chance für Pioneer
 Als Ersatz kam ein Pioneer VSX-D2011 ins Wohnzimmer. Der brachte die erste Version von Pioneers Einmesssystem MCACC mit und fühlte sich an wie ein kleiner AX10. Er war mit einem THX Select Zertifikat ausgestattet und hätte auch bereits Back-Surrounds befeuert, wenn ich diese denn damals schon benutzt hätte. Ein tolles Gerät und meiner Ansicht nach dem Denon um Welten überlegen. Aber die Geschmäcker sind ja unterschiedlich.
Als Ersatz kam ein Pioneer VSX-D2011 ins Wohnzimmer. Der brachte die erste Version von Pioneers Einmesssystem MCACC mit und fühlte sich an wie ein kleiner AX10. Er war mit einem THX Select Zertifikat ausgestattet und hätte auch bereits Back-Surrounds befeuert, wenn ich diese denn damals schon benutzt hätte. Ein tolles Gerät und meiner Ansicht nach dem Denon um Welten überlegen. Aber die Geschmäcker sind ja unterschiedlich.
2005 - Warum nicht mal wieder Yamaha?
 Obwohl ich an sich durchaus mit Pioneer zufrieden war, gab es 2005 in deren Line-Up nichts, was mich so wirklich angemacht hat, also schaute ich mal wieder über den Tellerrand und wurde bei Yamaha fündig. Der RX-V1600 sah sehr wertig aus und hatte einen sehr dynamischen Klang, ohne dabei auch die analytische Härte des alten 3090 aufzuweisen. Auch war der Yamaha mein erster Receiver mir HDMI-Anschlüssen und sollte nach dem Einsatz im Wohnzimmer auch im ersten Kinokeller in Oberhausen für guten Sound sorgen.
Obwohl ich an sich durchaus mit Pioneer zufrieden war, gab es 2005 in deren Line-Up nichts, was mich so wirklich angemacht hat, also schaute ich mal wieder über den Tellerrand und wurde bei Yamaha fündig. Der RX-V1600 sah sehr wertig aus und hatte einen sehr dynamischen Klang, ohne dabei auch die analytische Härte des alten 3090 aufzuweisen. Auch war der Yamaha mein erster Receiver mir HDMI-Anschlüssen und sollte nach dem Einsatz im Wohnzimmer auch im ersten Kinokeller in Oberhausen für guten Sound sorgen.
2008 - Hatte ich noch nie: einen Onkyo
 Nachdem im Keller nun endlich auch der schon lange im Schrank stehende Beamer zum Einsatz kam, machte ich mir über Videoverarbeitung im Receiver Gedanken. Nach der Lektüre eines dermaßen positiven Test-Berichts in der amerikanischen Widescreen Review (7 Seiten. OHNE Bilder) war für mich klar, dass der nächste Receiver ein Onkyo TX-SR875 mit HQV Reon Prozessor werden sollte. Der Onkyo hatte tatsächlich alles, was ich mir von einem Receiver wünsche: exzellentes Design, druckvollen Klang, einfache Bedienung. Der Onkyo durfte sich dann mit seinem THX Select 2 Cinema Modus auch direkt um 7 Lautsprecher kümmern, was er absolut souverän erledigte. Einziger Kritikpunkt war für mich immer die doch sehr starke Hitzeentwicklung trotz absolut freier Aufstellung.
Nachdem im Keller nun endlich auch der schon lange im Schrank stehende Beamer zum Einsatz kam, machte ich mir über Videoverarbeitung im Receiver Gedanken. Nach der Lektüre eines dermaßen positiven Test-Berichts in der amerikanischen Widescreen Review (7 Seiten. OHNE Bilder) war für mich klar, dass der nächste Receiver ein Onkyo TX-SR875 mit HQV Reon Prozessor werden sollte. Der Onkyo hatte tatsächlich alles, was ich mir von einem Receiver wünsche: exzellentes Design, druckvollen Klang, einfache Bedienung. Der Onkyo durfte sich dann mit seinem THX Select 2 Cinema Modus auch direkt um 7 Lautsprecher kümmern, was er absolut souverän erledigte. Einziger Kritikpunkt war für mich immer die doch sehr starke Hitzeentwicklung trotz absolut freier Aufstellung.
2010 - Eiskalt: Pioneer mit digitalen Endstufen
 Und so kam dann schließlich der Pioneer SC-LX72 in den Keller, der dritte Pioneer in 11 Jahren. Ich liebe dieses Gerät. Er bleibt selbst bei hohen Lautstärken handwarm und macht mit meinen B&W Lautsprechern eine sehr gute Figur. Das Einmesssystem MCACC ist eine Spielwiese für jeden Sound-Tüftler, wenn ich auch die Auslegung im Bassbereich (arbeitet hier erst ab 63 Hz) für nicht praxisgerecht halte. Da mein Subwoofer aber sein eigenes Einmesssystem mitbringt, macht das aber in meinem Fall keine Probleme. Und der Pioneer sieht einfach unverschämt gut aus, finde ich!
Und so kam dann schließlich der Pioneer SC-LX72 in den Keller, der dritte Pioneer in 11 Jahren. Ich liebe dieses Gerät. Er bleibt selbst bei hohen Lautstärken handwarm und macht mit meinen B&W Lautsprechern eine sehr gute Figur. Das Einmesssystem MCACC ist eine Spielwiese für jeden Sound-Tüftler, wenn ich auch die Auslegung im Bassbereich (arbeitet hier erst ab 63 Hz) für nicht praxisgerecht halte. Da mein Subwoofer aber sein eigenes Einmesssystem mitbringt, macht das aber in meinem Fall keine Probleme. Und der Pioneer sieht einfach unverschämt gut aus, finde ich!
2012 - Wird mal wieder Zeit: Yamaha kann's immer noch
 Da ja alle zwei Jahre ein neuer Receiver ansteht, ich aber nicht genau wusste, was es denn dieses Mal sein sollte, nahm ich bei einem Besuch bei meinem Hifi-Händler im Januar 2012 einen gerade als Auslaufmodell günstig erhältlichen Yamaha RX-V3067 mit. Dass es sich dabei um einen Spontankauf handelte, sollte ich schnell merken, denn so richtig machte er mich einfach nicht an.
Da ja alle zwei Jahre ein neuer Receiver ansteht, ich aber nicht genau wusste, was es denn dieses Mal sein sollte, nahm ich bei einem Besuch bei meinem Hifi-Händler im Januar 2012 einen gerade als Auslaufmodell günstig erhältlichen Yamaha RX-V3067 mit. Dass es sich dabei um einen Spontankauf handelte, sollte ich schnell merken, denn so richtig machte er mich einfach nicht an.
Davon einmal angesehen war der Yamaha aber wieder mal ein tolles Stück Technik, aber irgendwie sprang der Funke eben nicht wirklich über.
2012 - Liebe auf den ersten Blick: Marantz SR7005
 So folgte dann schon im August ein Marantz SR7005. In den hatte ich mich bei seiner Vorstellung schon verliebt und auch ihn konnte ich nun als Auslaufmodell extrem günstig erstehen.
So folgte dann schon im August ein Marantz SR7005. In den hatte ich mich bei seiner Vorstellung schon verliebt und auch ihn konnte ich nun als Auslaufmodell extrem günstig erstehen.
Optisch meiner Meinung nach eine Granate gefällt mir das Einmesssystem Audyssey MultEQ XT ein ganzes Stück besser als das YPAO des Yamaha, zumal Audyssey auch mit DynamicEQ über eine Schaltung verfügt, die beim Hören mit leiseren Pegeln dem Bass ein wenig unter die Arme greift. Ich hatte das damals in Form von THX Loudness Plus beim Pioneer SC-LX72 schätzen gelernt und beim Yamaha RX-V3067 schmerzlich vermisst. Auch Airplay ist etwas, von dem ich nicht wusste, dass ich es brauche, bevor ich es dann endlich ausprobieren konnte. Musik aus der Cloud direkt in den Keller streamen - klasse!
Das war er also, der Streifzug durch meine Heimkino-Jahre. Klanglich gab es tatsächlich Unterschiede zwischen den Geräten, wobei ich aber ab dem DSP-A3090 (vom Denon einmal abgesehen) der Meinung war, dass die Unterschiede zwar hörbar waren, man aber nicht pauschal sagen konnte, dass der eine besser oder schlechter klang, als der andere. Eben einfach nur etwas anders.
Fazit: Es ist unglaublich, was man heutzutage alles an Technik für sein Geld bekommt! Der Yamaha DSP-A970 hatte damals 1600 DM gekostet und hat im Grunde genommen nur einen Bruchteil dessen geleistet, was heute schon in der 500-EUR-Klasse an der Tagesordnung ist. Ob sich heutige Geräte in dieser Preisklasse auch im Stereo-Betrieb besser anhören, das fällt schwer einzuschätzen. Wundern würde es mich nicht. Was auch auffällt, das ist die Hitzeentwicklung. Der Yamaha DSP-A3090 wurde mit den gleichen Lautsprechern, die ich auch heute noch einsetze, nur handwarm. Wohlgemerkt OHNE Lüfter! Heutzutage fällt es leider schwerer ein Gerät z.B. in einen Schrank zu verfrachten, alleine schon aus dem Grund, dass die Kühlung dann verhältnismäßig aufwendig zu bewerkstelligen ist.
Ich hoffe, die, die es gelesen haben, hatten ein wenig Spaß. Ich hatte ihn zumindest beim Schreiben ;)
In diesem Sinne viele Grüße und ein schönes Wochenende
Markus
ich weiß gar nicht, wie ich letzte Woche darauf kam, aber irgendwie fing ich an, einmal darüber nachzudenken, wie das denn alles mit Heimkino bei mir angefangen hat. Dabei fiel mir dann auf, dass ich den letzten Jahren doch eine ziemliche Anzahl an AV-Verstärker und -Receivern bei mir rumstehen hatte. Diese möchte ich euch heute, quasi im Wandel der Zeit, einmal vorstellen (Bildrechte liegen bei den Herstellern der Geräte).
1993 - Das Jahr, in dem alles anfing

Den Anfang machte damals ein JVC RX-705. Dabei handelte es sich um einen Dolby Pro-Logic Receiver, der zwar den passenden Dekoder, aber leider nicht die Endstufe für den Center-Kanal mitbrachte.
Was den JVC damals auszeichnete, dass war ein elektronischer grafischer 7-Band-Equalizer, der aber leider auf alle angeschlossenen Lautsprecher gleich wirkte. Nicht wirklich sinnvoll, aber damals war ich absolut begeistert.
1994 - Der Yamaha ist des JVCs Tod

Nachdem ich bei Saturn in Köln bei den "Yamaha Surround Tagen" den DSP-A970 gehört hatte, war es um mich geschehen. Klanglich und von der Verarbeitung her war er gar kein Vergleich zum JVC. Wo der am Anfang von "The Abyss" an der Stelle, an der die Boje von vorne nach hinten durchs Zimmer schießt, eine Rauschfahne produzierte, schälte der Yamaha den Effekt glasklar heraus. Selten hatte ich eine so offensichtliche Verbesserung gehört. Ich hatte Glück, mein JVC-Händler hatte auch Yamaha im Programm und nahm den JVC in Zahlung :-)
1996 - Dolby Digital muss es sein
 Nachdem sich zum DSP-A970 schnell auch ein erster und dann ein zweiter Laserdisc-Player hinzugesellt hatten, war 1996 der Zeitpunkt gekommen, um auf den Dolby Digital Zug aufzuspringen. Da ich damals sehr günstig an NTSC-LDs aus den USA rankam, lag es nahe den Multiformat-LD-Player mit einem AC3-RF-Ausgang auszustatten und den DSP-A970 gegen einen brandneuen Yamaha DSP-A3090 einzutauschen. Mannomann, habe ich auf dieses Gerät gewartet. Ich hatte schon in amerikanischen Magazinen darüber gelesen und konnte es kaum abwarten, bis der 3090 in Europa erhältlich war. Letztendlich habe ich dann den ersten 3090, der in den Niederlanden ausgeliefert wurde, bekomme. Preis: 3500 DM. Aber die erste AC-3-LD ("Clear and present Danger") und viele andere waren es wert!
Nachdem sich zum DSP-A970 schnell auch ein erster und dann ein zweiter Laserdisc-Player hinzugesellt hatten, war 1996 der Zeitpunkt gekommen, um auf den Dolby Digital Zug aufzuspringen. Da ich damals sehr günstig an NTSC-LDs aus den USA rankam, lag es nahe den Multiformat-LD-Player mit einem AC3-RF-Ausgang auszustatten und den DSP-A970 gegen einen brandneuen Yamaha DSP-A3090 einzutauschen. Mannomann, habe ich auf dieses Gerät gewartet. Ich hatte schon in amerikanischen Magazinen darüber gelesen und konnte es kaum abwarten, bis der 3090 in Europa erhältlich war. Letztendlich habe ich dann den ersten 3090, der in den Niederlanden ausgeliefert wurde, bekomme. Preis: 3500 DM. Aber die erste AC-3-LD ("Clear and present Danger") und viele andere waren es wert!1999 - DTS muss her!
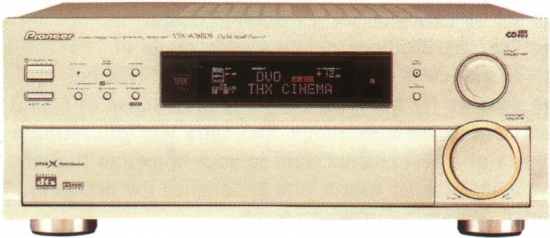 Leider hatte der DSP-A3090 aber noch keinen DTS-Dekoder und auch keine Möglichkeit, einen externen Dekoder anzuschließen. Daher folgte 1999 mein erster THX-Receiver, ein Pioneer VSX-908RDS. Tolles Gerät, toller Klang (die Rauschabstände waren jedoch ein wenig knapp). Leider hatte der Pioneer aber einen Serienfehler im Eingangsboard. Die Reparatur dauerte so lange, dass ich mir bei meinem Händler ein anderes Gerät aussuchen durfte.
Leider hatte der DSP-A3090 aber noch keinen DTS-Dekoder und auch keine Möglichkeit, einen externen Dekoder anzuschließen. Daher folgte 1999 mein erster THX-Receiver, ein Pioneer VSX-908RDS. Tolles Gerät, toller Klang (die Rauschabstände waren jedoch ein wenig knapp). Leider hatte der Pioneer aber einen Serienfehler im Eingangsboard. Die Reparatur dauerte so lange, dass ich mir bei meinem Händler ein anderes Gerät aussuchen durfte.2001 - Eine kurze Denon-Episode

Meine Wahl viel auf den damals hochgelobten Denon AVR-3802. Hochgelobt, aber mir gefiel er leider überhaupt nicht. Ich hatte noch nie einen derart langweilig klingenden AV-Receiver gehört. Daher kam der Denon schnell wieder weg.
2002 - Eine zweite Chance für Pioneer
 Als Ersatz kam ein Pioneer VSX-D2011 ins Wohnzimmer. Der brachte die erste Version von Pioneers Einmesssystem MCACC mit und fühlte sich an wie ein kleiner AX10. Er war mit einem THX Select Zertifikat ausgestattet und hätte auch bereits Back-Surrounds befeuert, wenn ich diese denn damals schon benutzt hätte. Ein tolles Gerät und meiner Ansicht nach dem Denon um Welten überlegen. Aber die Geschmäcker sind ja unterschiedlich.
Als Ersatz kam ein Pioneer VSX-D2011 ins Wohnzimmer. Der brachte die erste Version von Pioneers Einmesssystem MCACC mit und fühlte sich an wie ein kleiner AX10. Er war mit einem THX Select Zertifikat ausgestattet und hätte auch bereits Back-Surrounds befeuert, wenn ich diese denn damals schon benutzt hätte. Ein tolles Gerät und meiner Ansicht nach dem Denon um Welten überlegen. Aber die Geschmäcker sind ja unterschiedlich.2005 - Warum nicht mal wieder Yamaha?
 Obwohl ich an sich durchaus mit Pioneer zufrieden war, gab es 2005 in deren Line-Up nichts, was mich so wirklich angemacht hat, also schaute ich mal wieder über den Tellerrand und wurde bei Yamaha fündig. Der RX-V1600 sah sehr wertig aus und hatte einen sehr dynamischen Klang, ohne dabei auch die analytische Härte des alten 3090 aufzuweisen. Auch war der Yamaha mein erster Receiver mir HDMI-Anschlüssen und sollte nach dem Einsatz im Wohnzimmer auch im ersten Kinokeller in Oberhausen für guten Sound sorgen.
Obwohl ich an sich durchaus mit Pioneer zufrieden war, gab es 2005 in deren Line-Up nichts, was mich so wirklich angemacht hat, also schaute ich mal wieder über den Tellerrand und wurde bei Yamaha fündig. Der RX-V1600 sah sehr wertig aus und hatte einen sehr dynamischen Klang, ohne dabei auch die analytische Härte des alten 3090 aufzuweisen. Auch war der Yamaha mein erster Receiver mir HDMI-Anschlüssen und sollte nach dem Einsatz im Wohnzimmer auch im ersten Kinokeller in Oberhausen für guten Sound sorgen.2008 - Hatte ich noch nie: einen Onkyo
 Nachdem im Keller nun endlich auch der schon lange im Schrank stehende Beamer zum Einsatz kam, machte ich mir über Videoverarbeitung im Receiver Gedanken. Nach der Lektüre eines dermaßen positiven Test-Berichts in der amerikanischen Widescreen Review (7 Seiten. OHNE Bilder) war für mich klar, dass der nächste Receiver ein Onkyo TX-SR875 mit HQV Reon Prozessor werden sollte. Der Onkyo hatte tatsächlich alles, was ich mir von einem Receiver wünsche: exzellentes Design, druckvollen Klang, einfache Bedienung. Der Onkyo durfte sich dann mit seinem THX Select 2 Cinema Modus auch direkt um 7 Lautsprecher kümmern, was er absolut souverän erledigte. Einziger Kritikpunkt war für mich immer die doch sehr starke Hitzeentwicklung trotz absolut freier Aufstellung.
Nachdem im Keller nun endlich auch der schon lange im Schrank stehende Beamer zum Einsatz kam, machte ich mir über Videoverarbeitung im Receiver Gedanken. Nach der Lektüre eines dermaßen positiven Test-Berichts in der amerikanischen Widescreen Review (7 Seiten. OHNE Bilder) war für mich klar, dass der nächste Receiver ein Onkyo TX-SR875 mit HQV Reon Prozessor werden sollte. Der Onkyo hatte tatsächlich alles, was ich mir von einem Receiver wünsche: exzellentes Design, druckvollen Klang, einfache Bedienung. Der Onkyo durfte sich dann mit seinem THX Select 2 Cinema Modus auch direkt um 7 Lautsprecher kümmern, was er absolut souverän erledigte. Einziger Kritikpunkt war für mich immer die doch sehr starke Hitzeentwicklung trotz absolut freier Aufstellung.2010 - Eiskalt: Pioneer mit digitalen Endstufen
 Und so kam dann schließlich der Pioneer SC-LX72 in den Keller, der dritte Pioneer in 11 Jahren. Ich liebe dieses Gerät. Er bleibt selbst bei hohen Lautstärken handwarm und macht mit meinen B&W Lautsprechern eine sehr gute Figur. Das Einmesssystem MCACC ist eine Spielwiese für jeden Sound-Tüftler, wenn ich auch die Auslegung im Bassbereich (arbeitet hier erst ab 63 Hz) für nicht praxisgerecht halte. Da mein Subwoofer aber sein eigenes Einmesssystem mitbringt, macht das aber in meinem Fall keine Probleme. Und der Pioneer sieht einfach unverschämt gut aus, finde ich!
Und so kam dann schließlich der Pioneer SC-LX72 in den Keller, der dritte Pioneer in 11 Jahren. Ich liebe dieses Gerät. Er bleibt selbst bei hohen Lautstärken handwarm und macht mit meinen B&W Lautsprechern eine sehr gute Figur. Das Einmesssystem MCACC ist eine Spielwiese für jeden Sound-Tüftler, wenn ich auch die Auslegung im Bassbereich (arbeitet hier erst ab 63 Hz) für nicht praxisgerecht halte. Da mein Subwoofer aber sein eigenes Einmesssystem mitbringt, macht das aber in meinem Fall keine Probleme. Und der Pioneer sieht einfach unverschämt gut aus, finde ich!2012 - Wird mal wieder Zeit: Yamaha kann's immer noch
 Da ja alle zwei Jahre ein neuer Receiver ansteht, ich aber nicht genau wusste, was es denn dieses Mal sein sollte, nahm ich bei einem Besuch bei meinem Hifi-Händler im Januar 2012 einen gerade als Auslaufmodell günstig erhältlichen Yamaha RX-V3067 mit. Dass es sich dabei um einen Spontankauf handelte, sollte ich schnell merken, denn so richtig machte er mich einfach nicht an.
Da ja alle zwei Jahre ein neuer Receiver ansteht, ich aber nicht genau wusste, was es denn dieses Mal sein sollte, nahm ich bei einem Besuch bei meinem Hifi-Händler im Januar 2012 einen gerade als Auslaufmodell günstig erhältlichen Yamaha RX-V3067 mit. Dass es sich dabei um einen Spontankauf handelte, sollte ich schnell merken, denn so richtig machte er mich einfach nicht an.Davon einmal angesehen war der Yamaha aber wieder mal ein tolles Stück Technik, aber irgendwie sprang der Funke eben nicht wirklich über.
2012 - Liebe auf den ersten Blick: Marantz SR7005
 So folgte dann schon im August ein Marantz SR7005. In den hatte ich mich bei seiner Vorstellung schon verliebt und auch ihn konnte ich nun als Auslaufmodell extrem günstig erstehen.
So folgte dann schon im August ein Marantz SR7005. In den hatte ich mich bei seiner Vorstellung schon verliebt und auch ihn konnte ich nun als Auslaufmodell extrem günstig erstehen.Optisch meiner Meinung nach eine Granate gefällt mir das Einmesssystem Audyssey MultEQ XT ein ganzes Stück besser als das YPAO des Yamaha, zumal Audyssey auch mit DynamicEQ über eine Schaltung verfügt, die beim Hören mit leiseren Pegeln dem Bass ein wenig unter die Arme greift. Ich hatte das damals in Form von THX Loudness Plus beim Pioneer SC-LX72 schätzen gelernt und beim Yamaha RX-V3067 schmerzlich vermisst. Auch Airplay ist etwas, von dem ich nicht wusste, dass ich es brauche, bevor ich es dann endlich ausprobieren konnte. Musik aus der Cloud direkt in den Keller streamen - klasse!
Das war er also, der Streifzug durch meine Heimkino-Jahre. Klanglich gab es tatsächlich Unterschiede zwischen den Geräten, wobei ich aber ab dem DSP-A3090 (vom Denon einmal abgesehen) der Meinung war, dass die Unterschiede zwar hörbar waren, man aber nicht pauschal sagen konnte, dass der eine besser oder schlechter klang, als der andere. Eben einfach nur etwas anders.
Fazit: Es ist unglaublich, was man heutzutage alles an Technik für sein Geld bekommt! Der Yamaha DSP-A970 hatte damals 1600 DM gekostet und hat im Grunde genommen nur einen Bruchteil dessen geleistet, was heute schon in der 500-EUR-Klasse an der Tagesordnung ist. Ob sich heutige Geräte in dieser Preisklasse auch im Stereo-Betrieb besser anhören, das fällt schwer einzuschätzen. Wundern würde es mich nicht. Was auch auffällt, das ist die Hitzeentwicklung. Der Yamaha DSP-A3090 wurde mit den gleichen Lautsprechern, die ich auch heute noch einsetze, nur handwarm. Wohlgemerkt OHNE Lüfter! Heutzutage fällt es leider schwerer ein Gerät z.B. in einen Schrank zu verfrachten, alleine schon aus dem Grund, dass die Kühlung dann verhältnismäßig aufwendig zu bewerkstelligen ist.
Ich hoffe, die, die es gelesen haben, hatten ein wenig Spaß. Ich hatte ihn zumindest beim Schreiben ;)
In diesem Sinne viele Grüße und ein schönes Wochenende
Markus
Neuer Beamer: Vom Epson EH-TW3200 zum Sanyo PLV-Z4000
10. Juli 2011Guten Morgen zusammen,
nachdem ich mir ja im März den Epson EH-TW3200 als Ersatz für meinen Sony VPL-HS60 zugelegt hatte, hielt nach gerade mal knapp 3 Monaten und ca. 60 Betriebsstunden schon ein neuer Beamer im Keller Einzug.
Bei dem Neuzugang handelt es sich um den momentan günstig zu bekommenden PLV-Z4000 von Sanyo. Manche von euch erinnern sich sicherlich noch daran, dass dieses Modell, das einen Listenpreis von € 2500 hat, im April bei Amazon für gerade einmal € 1000 verkauft wurde.
Ich hatte damals leider nicht direkt zugeschlagen, war dann aber im Nachhinein doch sehr daran interessiert zu erfahren, ob sich die Z4000 mit seinem Mehrpreis von € 1500 im Vergleich zum TW3200 auch qualitativ deutlich vom Epson absetzen kann.
Da mittlerweile Rücksendungen aus der Amazon-Aktion in der Amazon-Resterampe "Warehouse Deals" zu bekommen waren, habe ich auf gut Glück einfach ein Exemplar (beschrieben als "Zustand Sehr gut") bestellt.
Nach nur einem Tag war er dann auch schon da, der Sanyo PLV-Z4000. EIn erster Check zeigt, dass der ursprüngliche Besteller das Gerät 2 Stunden in Betrieb hatte. Diesbezüglich war also alles im grünen Bereich (ich hatte schon damit gerechnet ein Gerät zu erhalten, dass 2 Wochen lang ausgiebig getestet wurde).
Der Epson wurde also von der Decke genommen und der Sanyo an die Halterung geschraubt. Die Tronje P3025 passt auch hier sehr gut, ich kann diese Halterung wirklich uneingeschränkt empfehlen.
 Generelle Eindrücke
Generelle Eindrücke
Insgesamt ist der Sanyo ein ganzes Stück kleiner als der Epson, wobei der Epson aber aufgrund seines weißen Gehäuses besser an die in diesem Teil des Kellers ebenso weiße Decke passte. Der Sanyo präsentiert sich in Anthrazit, was an sich gut aussieht aber an der weißen Decke mehr auffällt.
Der Sanyo verfügt im Gegensatz zum Epson über einen motorisch arbeitenden Objektivschutz. Schaltet man den Beamer an, so fährt die Klappe recht geräuschvoll zur Seite und gibt den Blick aufs Objektiv frei. So ist das Objektiv im ausgeschalteten Zustand immer gut geschützt, wobei das an sich keine große Rolle spielt, wenn der Beamer an der Decke hängt. Aber schaden kann es ja nicht.
Die Ausrichtung
Der Sanyo verfügt wie der Epson über ein (manuelles) 2-fach Zoom-Objektiv und einen horizontalen und vertikalen Lenseshift. D.h. man kann den Sanyo wirklich sehr flexibel auf die Leinwand ausrichten und es ist nicht nötig, das Gerät präzise an eine fest vorgegebene Position an die Decke zu schrauben. Nach 5 Minuten hängt der Beamer, füllt die Leinwand aus und mit dem integrierten Testbild ist der Fokus schnell scharf gestellt.
 Anschlüsse
Anschlüsse
Auch hier sind sich der Epson und der Sanyo durchaus ähnlich. Es gibt 2 HDMI-Eingänge, RGB, S-Video und 2x Componente. Damit sollte an sich jeder Einsatzbereich abgedeckt sein. Ich habe den Beamer über HDMI angeschlossen, daher beziehen sich alle Kommentare hier auch nur auf diese Anschlussart. Man findet auf der Rückseite außerdem noch den Anschluss fürs Netzkabel und einen "richtigen" Netzschalter. Dieser steht in meinem Setup immer auf "an", da die gesamte Anlage über den Belkin PF50 Power Conditioner geschaltet wird. Wie sich der Sanyo dann verhält, wenn er über eine Mehrfachsteckdose geschaltet wird, das kann per Menü eingestellt werden.
Erste Eindruck Bild
Mein erster Eindruck vom Bild in den vielen Standard-Presets war erst einmal nicht so positiv. Wo der Epson schon direkt mit den Standardsettings und kurzer Einstellung von Helligkeit und Kontrast tolle Farben präsentiert, wirkt das Bild des Sanyo gelb-grün-stichig. Gerade in Gesichtern und Naturaufnahmen fällt das auf. SO grün ist ein Rasen einfach nicht.
Der Sanyo bietet nun eine wirklich fast unüberschaubare Anzahl ein Reglern, um das Bild so einzustellen, dass es einem per Augenmaß oder per Messgerät gefällt. Ich habe beide Varianten probiert.
Zuerst einmal sei gesagt, dass der Sanyo wie der Epson einen Cinema-Filter hat, der bei Auswahl der entsprechenden Bildmodi automatisch in den Lichtweg geschoben wird. Nachteile: der Filter kostet enorm viel Helligkeit, außerdem kann man die Lampe dann nicht mehr im Eco-Modus laufen lassen. Man kann schon, aber dann ist das Bild einfach nur noch dunkel. Für meine 2m breite Leinwand reicht es nicht mehr.
Ich habe daher als Basis den "Lebendig"-Modus (ohne Cinema-Filter) genommen und in diesem dann die Lampe auf den Eco-Modus gestellt. Der Lüfter ist dann so leise, dass man ihn schon dann nicht mehr hört, wenn einfach nur in einem Film gesprochen wird. Ich war teilweise schon irritiert und dachte, der Lüfter hätte seinen Dienst eingestellt.
Basierend auf diesen Einstellungen habe ich den Beamer dann mit der Software ColorHCFR und einem Spyder3 Messkopf kalibriert.
Der Sanyo bringt zum Kalibrieren der Graustufen für jede Grundfarbe einen Equalizer mit. Aber wozu die Graustufen kalibrieren wenn man doch sowieso so gut wie immer Farbfilme schaut? Ganz einfach: es geht darum, den Graustufen in verschiedenen Helligkeitsstufen (von ganz dunkel bis ganz hell) evtl. vorhandene Farbstiche auszutreiben.
Obwohl ich hier von "Graustufen" spreche, stellen diese grauen Bilder in unterschiedlichen Abstufungen an sich einfach verschiedene Helligkeitsstufen dar und Helligkeit ist nun mal ein Bestandteil eines jeden Videobildes. Somit färben Farbstiche, die bei einzelnen Helligkeiten auftreten auch Farbbilder mit ein. Wenn z.B. eine dunkle Graustufe einen Tick rötlich aussieht, dann wird das Weltall in einem SciFi-Film auch diesen Farbstich aufweisen. Und das soll natürlich nicht so nicht sein!
Wie gesagt stellt sich der RGB-Equalizer als adäquates Tool heraus, um diese Einstellungen zu machen. Von einer Testbild-DVD (z.B. von Peter Finzel) spielt man nacheinander verschieden helle Graustufen-Fenster zu (die unterschiedlich hellen Bilder werden auch immer wieder als "IRE-0" bis "IRE-10" bezeichnet. "0" ist dabei ganz dunkle, "10" ganz hell). Welche Regler nun für das jeweilige Fenster genutzt werden, das zeigt einem der Sanyo dadurch, dass er bei Auswahl des richtigen Reglers das Fenster kurz blinken lässt. Dann weiß man, an welcher "Schraube" man drehen muss und kontrolliert das Ergebnis mit der ColoHCFR-Software.
Nach getaner Arbeit und einem abschließenden manuellen Einstellen von Farbsättigung und -ton erhält man ein wirklich angenehmes BIld mit natürlichen Farben.
Unterschiede Sanyo - Epson
Was sind den nun nach erfolgter Einstellung der Farben die Unterschiede zwischen Sanyo und Epson? Da gibt es ein paar:
- Schwarzwert und Kontrast: wo der Epson in dunklen Szenen eher ein dunkles Grau darstellt, schafft es der Sanyo, ein tiefes Schwarz darzustellen. Der Kontrast des Sanyo liegt auf einem viel höheren Niveau als das des Epson. Gerade SciFi-Filme in Weltall machen auf dem Sanyo einfach mehr Spaß.
- Lautstärke: der Lüfter des Sanyo ist ein ganzes Stück leiser als der des Epson. Beide Beamer verfügen über eine dynamische Iris (also quasi eine Blende, die je nach Lichtbedarf des Bildes das Objektiv schließt oder öffnet). Diese arbeitet beim Epson deutlich hör- und sichtbar, beim Epson sieht man nur das Ergebnis (weniger Licht bei dunklen Szenen), man hört und sieht aber nicht die Arbeitsweise.
- Farben: die halte ich selbst nach er Kalibrierung des Sanyo beim Epson für natürlicher.
- Helligkeit: der Sanyo ist gerade im Eco-Modus eher für den dunklen Kino-Keller gedacht. Der Epson lieferte selbst im Eco-Modus noch Bilder, deren Helligkeit einen blendet. Sollte man also in einem Raum mit Restlicht oder sogar Tageslicht projezieren wollen, dann ist der Epson eindeutig die bessere Wahl. Fürs Kino bevorzuge ich aber ganz klar den Sanyo.
Fazit - Welcher Beamer ist denn nun der Bessere?
Das kommt drauf an :-) Generell hat der Sanyo schon die besseren Möglichkeiten, wenn es darum geht, in einem dedizierten Kinoraum Filme zu schauen. Man muss aber selbst Hand anlegen, um den Sanyo ein gutes Bild zu entlocken. Lässt man sich darauf ein, dann belohnt er seinen Besitzer mit farbenfrohen Bildern und einem Kontrast, der seines Gleichen sucht.
Der Epson ist ein Beamer, den man auspackt, anschließt und dann direkt ein sehr gutes Ergebnis liefert. Hat man dann noch vor, den Beamer im Wohnzimmer zu nutzen, um z.B. nachmittags auch mal ein Fußballspiel zu schauen, dann führt kein Weg am Epson vorbei.
Da der Beamer bei uns ja im Keller hängt, ist hier der Sanyo die bessere Alternative.
In diesem Sinne: es gibt noch so viel zu den einzelnen Einstellmöglichkeiten des Sanyo zu sagen, dass es den Rahmen dieses Blogs sprengen würde. Meldet euch einfach, wenn ihr Fragen habt.
Viele Grüße
Markus
nachdem ich mir ja im März den Epson EH-TW3200 als Ersatz für meinen Sony VPL-HS60 zugelegt hatte, hielt nach gerade mal knapp 3 Monaten und ca. 60 Betriebsstunden schon ein neuer Beamer im Keller Einzug.
Bei dem Neuzugang handelt es sich um den momentan günstig zu bekommenden PLV-Z4000 von Sanyo. Manche von euch erinnern sich sicherlich noch daran, dass dieses Modell, das einen Listenpreis von € 2500 hat, im April bei Amazon für gerade einmal € 1000 verkauft wurde.
Ich hatte damals leider nicht direkt zugeschlagen, war dann aber im Nachhinein doch sehr daran interessiert zu erfahren, ob sich die Z4000 mit seinem Mehrpreis von € 1500 im Vergleich zum TW3200 auch qualitativ deutlich vom Epson absetzen kann.
Da mittlerweile Rücksendungen aus der Amazon-Aktion in der Amazon-Resterampe "Warehouse Deals" zu bekommen waren, habe ich auf gut Glück einfach ein Exemplar (beschrieben als "Zustand Sehr gut") bestellt.
Nach nur einem Tag war er dann auch schon da, der Sanyo PLV-Z4000. EIn erster Check zeigt, dass der ursprüngliche Besteller das Gerät 2 Stunden in Betrieb hatte. Diesbezüglich war also alles im grünen Bereich (ich hatte schon damit gerechnet ein Gerät zu erhalten, dass 2 Wochen lang ausgiebig getestet wurde).
Der Epson wurde also von der Decke genommen und der Sanyo an die Halterung geschraubt. Die Tronje P3025 passt auch hier sehr gut, ich kann diese Halterung wirklich uneingeschränkt empfehlen.
 Generelle Eindrücke
Generelle EindrückeInsgesamt ist der Sanyo ein ganzes Stück kleiner als der Epson, wobei der Epson aber aufgrund seines weißen Gehäuses besser an die in diesem Teil des Kellers ebenso weiße Decke passte. Der Sanyo präsentiert sich in Anthrazit, was an sich gut aussieht aber an der weißen Decke mehr auffällt.
Der Sanyo verfügt im Gegensatz zum Epson über einen motorisch arbeitenden Objektivschutz. Schaltet man den Beamer an, so fährt die Klappe recht geräuschvoll zur Seite und gibt den Blick aufs Objektiv frei. So ist das Objektiv im ausgeschalteten Zustand immer gut geschützt, wobei das an sich keine große Rolle spielt, wenn der Beamer an der Decke hängt. Aber schaden kann es ja nicht.
Die Ausrichtung
Der Sanyo verfügt wie der Epson über ein (manuelles) 2-fach Zoom-Objektiv und einen horizontalen und vertikalen Lenseshift. D.h. man kann den Sanyo wirklich sehr flexibel auf die Leinwand ausrichten und es ist nicht nötig, das Gerät präzise an eine fest vorgegebene Position an die Decke zu schrauben. Nach 5 Minuten hängt der Beamer, füllt die Leinwand aus und mit dem integrierten Testbild ist der Fokus schnell scharf gestellt.
 Anschlüsse
AnschlüsseAuch hier sind sich der Epson und der Sanyo durchaus ähnlich. Es gibt 2 HDMI-Eingänge, RGB, S-Video und 2x Componente. Damit sollte an sich jeder Einsatzbereich abgedeckt sein. Ich habe den Beamer über HDMI angeschlossen, daher beziehen sich alle Kommentare hier auch nur auf diese Anschlussart. Man findet auf der Rückseite außerdem noch den Anschluss fürs Netzkabel und einen "richtigen" Netzschalter. Dieser steht in meinem Setup immer auf "an", da die gesamte Anlage über den Belkin PF50 Power Conditioner geschaltet wird. Wie sich der Sanyo dann verhält, wenn er über eine Mehrfachsteckdose geschaltet wird, das kann per Menü eingestellt werden.
Erste Eindruck Bild
Mein erster Eindruck vom Bild in den vielen Standard-Presets war erst einmal nicht so positiv. Wo der Epson schon direkt mit den Standardsettings und kurzer Einstellung von Helligkeit und Kontrast tolle Farben präsentiert, wirkt das Bild des Sanyo gelb-grün-stichig. Gerade in Gesichtern und Naturaufnahmen fällt das auf. SO grün ist ein Rasen einfach nicht.
Der Sanyo bietet nun eine wirklich fast unüberschaubare Anzahl ein Reglern, um das Bild so einzustellen, dass es einem per Augenmaß oder per Messgerät gefällt. Ich habe beide Varianten probiert.
Zuerst einmal sei gesagt, dass der Sanyo wie der Epson einen Cinema-Filter hat, der bei Auswahl der entsprechenden Bildmodi automatisch in den Lichtweg geschoben wird. Nachteile: der Filter kostet enorm viel Helligkeit, außerdem kann man die Lampe dann nicht mehr im Eco-Modus laufen lassen. Man kann schon, aber dann ist das Bild einfach nur noch dunkel. Für meine 2m breite Leinwand reicht es nicht mehr.
Ich habe daher als Basis den "Lebendig"-Modus (ohne Cinema-Filter) genommen und in diesem dann die Lampe auf den Eco-Modus gestellt. Der Lüfter ist dann so leise, dass man ihn schon dann nicht mehr hört, wenn einfach nur in einem Film gesprochen wird. Ich war teilweise schon irritiert und dachte, der Lüfter hätte seinen Dienst eingestellt.
Basierend auf diesen Einstellungen habe ich den Beamer dann mit der Software ColorHCFR und einem Spyder3 Messkopf kalibriert.
Der Sanyo bringt zum Kalibrieren der Graustufen für jede Grundfarbe einen Equalizer mit. Aber wozu die Graustufen kalibrieren wenn man doch sowieso so gut wie immer Farbfilme schaut? Ganz einfach: es geht darum, den Graustufen in verschiedenen Helligkeitsstufen (von ganz dunkel bis ganz hell) evtl. vorhandene Farbstiche auszutreiben.
Obwohl ich hier von "Graustufen" spreche, stellen diese grauen Bilder in unterschiedlichen Abstufungen an sich einfach verschiedene Helligkeitsstufen dar und Helligkeit ist nun mal ein Bestandteil eines jeden Videobildes. Somit färben Farbstiche, die bei einzelnen Helligkeiten auftreten auch Farbbilder mit ein. Wenn z.B. eine dunkle Graustufe einen Tick rötlich aussieht, dann wird das Weltall in einem SciFi-Film auch diesen Farbstich aufweisen. Und das soll natürlich nicht so nicht sein!
Wie gesagt stellt sich der RGB-Equalizer als adäquates Tool heraus, um diese Einstellungen zu machen. Von einer Testbild-DVD (z.B. von Peter Finzel) spielt man nacheinander verschieden helle Graustufen-Fenster zu (die unterschiedlich hellen Bilder werden auch immer wieder als "IRE-0" bis "IRE-10" bezeichnet. "0" ist dabei ganz dunkle, "10" ganz hell). Welche Regler nun für das jeweilige Fenster genutzt werden, das zeigt einem der Sanyo dadurch, dass er bei Auswahl des richtigen Reglers das Fenster kurz blinken lässt. Dann weiß man, an welcher "Schraube" man drehen muss und kontrolliert das Ergebnis mit der ColoHCFR-Software.
Nach getaner Arbeit und einem abschließenden manuellen Einstellen von Farbsättigung und -ton erhält man ein wirklich angenehmes BIld mit natürlichen Farben.
Unterschiede Sanyo - Epson
Was sind den nun nach erfolgter Einstellung der Farben die Unterschiede zwischen Sanyo und Epson? Da gibt es ein paar:
- Schwarzwert und Kontrast: wo der Epson in dunklen Szenen eher ein dunkles Grau darstellt, schafft es der Sanyo, ein tiefes Schwarz darzustellen. Der Kontrast des Sanyo liegt auf einem viel höheren Niveau als das des Epson. Gerade SciFi-Filme in Weltall machen auf dem Sanyo einfach mehr Spaß.
- Lautstärke: der Lüfter des Sanyo ist ein ganzes Stück leiser als der des Epson. Beide Beamer verfügen über eine dynamische Iris (also quasi eine Blende, die je nach Lichtbedarf des Bildes das Objektiv schließt oder öffnet). Diese arbeitet beim Epson deutlich hör- und sichtbar, beim Epson sieht man nur das Ergebnis (weniger Licht bei dunklen Szenen), man hört und sieht aber nicht die Arbeitsweise.
- Farben: die halte ich selbst nach er Kalibrierung des Sanyo beim Epson für natürlicher.
- Helligkeit: der Sanyo ist gerade im Eco-Modus eher für den dunklen Kino-Keller gedacht. Der Epson lieferte selbst im Eco-Modus noch Bilder, deren Helligkeit einen blendet. Sollte man also in einem Raum mit Restlicht oder sogar Tageslicht projezieren wollen, dann ist der Epson eindeutig die bessere Wahl. Fürs Kino bevorzuge ich aber ganz klar den Sanyo.
Fazit - Welcher Beamer ist denn nun der Bessere?
Das kommt drauf an :-) Generell hat der Sanyo schon die besseren Möglichkeiten, wenn es darum geht, in einem dedizierten Kinoraum Filme zu schauen. Man muss aber selbst Hand anlegen, um den Sanyo ein gutes Bild zu entlocken. Lässt man sich darauf ein, dann belohnt er seinen Besitzer mit farbenfrohen Bildern und einem Kontrast, der seines Gleichen sucht.
Der Epson ist ein Beamer, den man auspackt, anschließt und dann direkt ein sehr gutes Ergebnis liefert. Hat man dann noch vor, den Beamer im Wohnzimmer zu nutzen, um z.B. nachmittags auch mal ein Fußballspiel zu schauen, dann führt kein Weg am Epson vorbei.
Da der Beamer bei uns ja im Keller hängt, ist hier der Sanyo die bessere Alternative.
In diesem Sinne: es gibt noch so viel zu den einzelnen Einstellmöglichkeiten des Sanyo zu sagen, dass es den Rahmen dieses Blogs sprengen würde. Meldet euch einfach, wenn ihr Fragen habt.
Viele Grüße
Markus
Erfahrungsbericht: Philips BDP9600
1. Juni 2011Hallo zusammen,
heute möchte ich gerne etwas zu meinen neuen Blu-ray-Player, den Philips BDP9600, schreiben. Der Philips ersetzt in meinem Setup den Pioneer BDP-51FD, den ich in den letzte 15 Monaten als einen ungemein zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Player kennengelernt hatte.
Warum nun der Wechsel zum Philips? Nun, ich gebe zu, ich hatte einfach mal wieder Lust auf etwas Neues. Der Philips ist mir in den letzten Monaten in verschiedenen Magazinen aufgefallen, in denen er immer mit Bestnoten abgeschnitten hatte. Also habe ich ihn mir genauer angeschaut.
Verarbeitung und Material
Nachdem ich den Player dann live gesehen hatte, war ich zumindest von Materialanmutung und Verarbeitung schon einmal sehr beeindruckt.

Das Gehäuse des Philips besteht aus dicken Aluminium und vermittelt schon beim ersten Anheben den Eindruck, dass es sich hier nicht um eines der heute üblichen Geräte vom Typ "Immer flacher, immer leichter" handelt. Der Philips wiegt 4 1/2 Kilogramm und das ist schon was. Das Gewicht geht aber nicht ausschließlich aufs Konto des Gehäuses, auch die Innereien wissen zu gefallen. Ich habe ihn jetzt nicht selbst aufgeschraubt, Bilder vom Inneren zeigen aber einen eigenen Ringkerntrafo für die analoge Audiosektion, sowie eine komplette Ausnutzung des Platzes für Laufwerk und Platinen.
Auf der Rückseite setzt sich der gute Eindruck fort.

Hier findet sich eine Armada von vergoldeten Cinch-Buchsen. Es gibt einen analogen 7.1-Ausgang (mit Burr-Brown DACs), separate Stereo-Ausgänge, einen YUV-Ausgang, sowieso jeweils einen koaxialen und optischen Digitalausgang. Komplettiert werden die Anschlüsse durch einen ebenfalls vergoldeten HDMI-Ausgang und eine RJ45-Buchse zum Anschluss eines Netzwerkkabels.
Apropos "Netzwerkkabel": der Philips verfügt über ein eingebautes WLAN-Modul, sodass zur Nutzung von BD Live und dem Herunterladen von Firmware-Updates keine Verkabelung notwendig ist.
Ausstattung
Insgesamt bietet der Philips ein extrem dickes Ausstattungspaket, auf das ich aber nicht näher eingehen werde, da ich den Player ausschließlich zur Wiedergabe von BDs und DVDs verwende. Die anderen "Spielereien" sind mir egal, daher hier nur der Hinweis, dass der Player DLNA-zertifiziert ist, er kann also übers Netzwerk bereitgestellte Mediadaten (Musik, Filme, Fotos) abspielen, außerdem bietet er die Möglichkeit, Video-on-Demand-Dienste sowieso das Internet zu nutzen.
Wie gesagt, das ist für meinen Einsatzzweck alles unerheblich, was er für mich können muss, das ist das hochqualitative und zuverlässige Abspielen meiner Filmesammlung.
Qdeo-Chipsatz
Aus diesem Grund war für mich der Einsatz eines Qdeo-Chipsatzes vom Hersteller Marvell von Interesse. Der Chipsatz werkelt auch im Oppo BDP-93 und anderen hochwertigen Playern und bietet neben den Standardaufgaben wie Scaling und Deinterlacing vielfältige Möglichkeiten, das Bild von BD und DVD zu optimieren.
Hierzu stehen beim Philips folgende Optionen zur Verfügung:
1. Helligkeit
2. Kontrast
3. Sättigung
4. Artefaktunterdrückung
5. Rauschreduzierung
6. ACE
7. Schärfe
8. Farbe
All diese Punkte kann man in verschiedenen Stufen einstellen, teilweise gibt es auch den Punkt "Automatisch", bei dem der Prozessor dann anhand der Bildinformationen versucht, die optimale Einstellung selbst zu ermitteln.
Die Punkte 1., 2., 3., 7., 8. sind an sich selbsterklärend, interessanter (gerade für den Einsatz mit DVDs) sind 4. und 5. Hier hat man tatsächlich die Möglichkeit, die Bildqualität von schlechteren DVDs massiv zu verbessern. "Automatisch" macht hier einen guten Job und mit der Schärfefunktion lässt sich auch der Detailgrad von SD-Filmen noch ein wenig aufpolieren.
Was mir besonders gefallen hat, ist die ACE-Funktion. Diese hebt in dunklen Szenen die Helligkeit von Details ein wenig an, ohne aber ein dunkles Bild dadurch heller zu machen. Gerade im Zusammenspiel mit meinem Beamer Epson EH-TW3200, der sich nicht unbedingt durch einen guten Schwarzwert auszeichnet, ergibt sich nun ein dunkleres Bild, in dem aber Details nicht "absaufen".
Bildeindruck BD
Wie sieht nun das Bild aus, das der BDP9600 auf die Leinwand bringt? Nun, wenn die zuvor genannten Regler alle auf "0" stehen oder abgeschaltet sind, dann sehe ich bei BDs keine wirklichen Unterschiede zum Pioneer BDP-51FD. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich das nicht erwartet hatte. Meiner Ansicht nach sind die Unterschiede aktueller BD-Player bei BD-Wiedergabe so gering, dass man sie mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Wie sieht es aber mit DVDs aus?
Bildeindruck DVD
Hier kann der Player zwar überzeugen, wenn auch aber nicht 100%ig. Ich habe die Tests der HQV Benchmark DVD V1.4 durchlaufen lassen, und der Philips legt in keinem Test ernsthafte Patzer hin. Ich kreide ihm an, dass er bei DVDs ohne Progressive-Flag sich etwas langsam auf den Film-Mode einstellt. Außerdem versagt er beim Progressive-Test der Peter Finzel Test-DVD schon bei Stufe 2. Auch habe ich bei einer Szene aus "Die Mumie" , mit der ich seit Jahren den Film-Mode von DVD-Playern teste, leichtes Zittern in Details beobachtet. Im Gegensatz dazu meistert der Player tatsächlich die Szenen, die von der "Audiovision" immer zum Testen herangezogen werden ("Space Cowboys", "7 Tage, 7 Nächte"). Ein fest einstellbarer Film-Mode hätte mir jedoch besser gefallen, dann wären auch die o.g. Ausreißer nicht vorhanden gewesen.
Bildeindruck mit zugeschalteter Optimierung
Was den Player aber ohne Zweifel auszeichnet, das sind die zuvor genannten einstellbaren Video-Parameter. Gerade die ACE-Funktion hat bei mir das Bild deutlich sowohl im BD- als auch im DVD-Betrieb verbessert und die Schärfefunktion lässt selbst bei kleinster Einstellung DVDs schon sehr HD-like aussehen.
Im Betrieb
Ganz egal, ob er jetzt DVDs oder BDs wiedergibt, mein BDP9600 gibt im Betrieb nur ein ganz leises Säuseln von sich. Wie ich in verschiedenen Foren gelesen habe, scheint es hier aber starke Qualitätsschwankungen zu geben, sodass die Aussage zur Lautstärke des Laufwerks sich nur auf meinen Player beziehen kann.
Die Navigation geht flott und das Einlesen von Medien erfolgt zügig (wobei ich aber vom Pioneer auch geduldiges Warten gewohnt war).
Fernbedienung
 Die Fernbedienung ist verhältnismäßig klein und kommt mit wenigen Tasten daher. Die Tasten sindaus Gummi und fühlen sich etwas schwammig an. Generell geht die Bedienung der Grundfunktionen und der Einstellungen über die FB gut von der Hand, wobei ich aber die Farb- und Zahlentasten definitiv für zu schmal halte. Wer diese öfters verwendet, der sollte über die Nutzung einer Universalfernbedienung nachdenken.
Die Fernbedienung ist verhältnismäßig klein und kommt mit wenigen Tasten daher. Die Tasten sindaus Gummi und fühlen sich etwas schwammig an. Generell geht die Bedienung der Grundfunktionen und der Einstellungen über die FB gut von der Hand, wobei ich aber die Farb- und Zahlentasten definitiv für zu schmal halte. Wer diese öfters verwendet, der sollte über die Nutzung einer Universalfernbedienung nachdenken.
Stichwort "Universalfernbedienung":
Mir ist es bisher noch nicht gelungen eine in der Datenbank meiner Nevo Q50 (bzw. in der Datendank von URC) fehlende Taste der Philips-FB korrekt anzulernen. Eine Logitech Harmony 885 hat keine Problem damit, doch bei der Nevo muss ich immer erst eine andere Taste drücken, bevor die angelernte Taste wieder genutzt werden kann.
Fazit
Ich halte den Philips BDP9600 für einen durchaus guten BD-Player. Verarbeitung und Materialanmutung heben ihn vom Gros der momentan erhältlichen Player ab und lassen ihn fast schon wie ein Gerät der Oberklasse wirken.
Nicht ganz überzeugen kann mich das Deinterlacing von DVDs, die irgendwie nicht so ganz zu den Testergebnissen sämtlicher Magazine passen will. Aber vielleicht sind meine Test-Kriterien einfach kritischer.
Insgesamt also ein tolles Gerät, das meiner Meinung nach einfach nicht wirklich dem Referenz-Status, den es in vielen Magazinen erlangt hat, gerecht wird. Hier wurden von der Presse einfach Erwartungen geschürt, die der Player dann nicht wirklich erfüllt.
Für einen Marktpreis von € 500 (Listenpreis liegt bei € 750) erhält man jedenfalls einen Player, der viel Spaß macht. Ich würde ihn noch mal kaufen!
heute möchte ich gerne etwas zu meinen neuen Blu-ray-Player, den Philips BDP9600, schreiben. Der Philips ersetzt in meinem Setup den Pioneer BDP-51FD, den ich in den letzte 15 Monaten als einen ungemein zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Player kennengelernt hatte.
Warum nun der Wechsel zum Philips? Nun, ich gebe zu, ich hatte einfach mal wieder Lust auf etwas Neues. Der Philips ist mir in den letzten Monaten in verschiedenen Magazinen aufgefallen, in denen er immer mit Bestnoten abgeschnitten hatte. Also habe ich ihn mir genauer angeschaut.
Verarbeitung und Material
Nachdem ich den Player dann live gesehen hatte, war ich zumindest von Materialanmutung und Verarbeitung schon einmal sehr beeindruckt.

Das Gehäuse des Philips besteht aus dicken Aluminium und vermittelt schon beim ersten Anheben den Eindruck, dass es sich hier nicht um eines der heute üblichen Geräte vom Typ "Immer flacher, immer leichter" handelt. Der Philips wiegt 4 1/2 Kilogramm und das ist schon was. Das Gewicht geht aber nicht ausschließlich aufs Konto des Gehäuses, auch die Innereien wissen zu gefallen. Ich habe ihn jetzt nicht selbst aufgeschraubt, Bilder vom Inneren zeigen aber einen eigenen Ringkerntrafo für die analoge Audiosektion, sowie eine komplette Ausnutzung des Platzes für Laufwerk und Platinen.
Auf der Rückseite setzt sich der gute Eindruck fort.

Hier findet sich eine Armada von vergoldeten Cinch-Buchsen. Es gibt einen analogen 7.1-Ausgang (mit Burr-Brown DACs), separate Stereo-Ausgänge, einen YUV-Ausgang, sowieso jeweils einen koaxialen und optischen Digitalausgang. Komplettiert werden die Anschlüsse durch einen ebenfalls vergoldeten HDMI-Ausgang und eine RJ45-Buchse zum Anschluss eines Netzwerkkabels.
Apropos "Netzwerkkabel": der Philips verfügt über ein eingebautes WLAN-Modul, sodass zur Nutzung von BD Live und dem Herunterladen von Firmware-Updates keine Verkabelung notwendig ist.
Ausstattung
Insgesamt bietet der Philips ein extrem dickes Ausstattungspaket, auf das ich aber nicht näher eingehen werde, da ich den Player ausschließlich zur Wiedergabe von BDs und DVDs verwende. Die anderen "Spielereien" sind mir egal, daher hier nur der Hinweis, dass der Player DLNA-zertifiziert ist, er kann also übers Netzwerk bereitgestellte Mediadaten (Musik, Filme, Fotos) abspielen, außerdem bietet er die Möglichkeit, Video-on-Demand-Dienste sowieso das Internet zu nutzen.
Wie gesagt, das ist für meinen Einsatzzweck alles unerheblich, was er für mich können muss, das ist das hochqualitative und zuverlässige Abspielen meiner Filmesammlung.
Qdeo-Chipsatz
Aus diesem Grund war für mich der Einsatz eines Qdeo-Chipsatzes vom Hersteller Marvell von Interesse. Der Chipsatz werkelt auch im Oppo BDP-93 und anderen hochwertigen Playern und bietet neben den Standardaufgaben wie Scaling und Deinterlacing vielfältige Möglichkeiten, das Bild von BD und DVD zu optimieren.
Hierzu stehen beim Philips folgende Optionen zur Verfügung:
1. Helligkeit
2. Kontrast
3. Sättigung
4. Artefaktunterdrückung
5. Rauschreduzierung
6. ACE
7. Schärfe
8. Farbe
All diese Punkte kann man in verschiedenen Stufen einstellen, teilweise gibt es auch den Punkt "Automatisch", bei dem der Prozessor dann anhand der Bildinformationen versucht, die optimale Einstellung selbst zu ermitteln.
Die Punkte 1., 2., 3., 7., 8. sind an sich selbsterklärend, interessanter (gerade für den Einsatz mit DVDs) sind 4. und 5. Hier hat man tatsächlich die Möglichkeit, die Bildqualität von schlechteren DVDs massiv zu verbessern. "Automatisch" macht hier einen guten Job und mit der Schärfefunktion lässt sich auch der Detailgrad von SD-Filmen noch ein wenig aufpolieren.
Was mir besonders gefallen hat, ist die ACE-Funktion. Diese hebt in dunklen Szenen die Helligkeit von Details ein wenig an, ohne aber ein dunkles Bild dadurch heller zu machen. Gerade im Zusammenspiel mit meinem Beamer Epson EH-TW3200, der sich nicht unbedingt durch einen guten Schwarzwert auszeichnet, ergibt sich nun ein dunkleres Bild, in dem aber Details nicht "absaufen".
Bildeindruck BD
Wie sieht nun das Bild aus, das der BDP9600 auf die Leinwand bringt? Nun, wenn die zuvor genannten Regler alle auf "0" stehen oder abgeschaltet sind, dann sehe ich bei BDs keine wirklichen Unterschiede zum Pioneer BDP-51FD. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich das nicht erwartet hatte. Meiner Ansicht nach sind die Unterschiede aktueller BD-Player bei BD-Wiedergabe so gering, dass man sie mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Wie sieht es aber mit DVDs aus?
Bildeindruck DVD
Hier kann der Player zwar überzeugen, wenn auch aber nicht 100%ig. Ich habe die Tests der HQV Benchmark DVD V1.4 durchlaufen lassen, und der Philips legt in keinem Test ernsthafte Patzer hin. Ich kreide ihm an, dass er bei DVDs ohne Progressive-Flag sich etwas langsam auf den Film-Mode einstellt. Außerdem versagt er beim Progressive-Test der Peter Finzel Test-DVD schon bei Stufe 2. Auch habe ich bei einer Szene aus "Die Mumie" , mit der ich seit Jahren den Film-Mode von DVD-Playern teste, leichtes Zittern in Details beobachtet. Im Gegensatz dazu meistert der Player tatsächlich die Szenen, die von der "Audiovision" immer zum Testen herangezogen werden ("Space Cowboys", "7 Tage, 7 Nächte"). Ein fest einstellbarer Film-Mode hätte mir jedoch besser gefallen, dann wären auch die o.g. Ausreißer nicht vorhanden gewesen.
Bildeindruck mit zugeschalteter Optimierung
Was den Player aber ohne Zweifel auszeichnet, das sind die zuvor genannten einstellbaren Video-Parameter. Gerade die ACE-Funktion hat bei mir das Bild deutlich sowohl im BD- als auch im DVD-Betrieb verbessert und die Schärfefunktion lässt selbst bei kleinster Einstellung DVDs schon sehr HD-like aussehen.
Im Betrieb
Ganz egal, ob er jetzt DVDs oder BDs wiedergibt, mein BDP9600 gibt im Betrieb nur ein ganz leises Säuseln von sich. Wie ich in verschiedenen Foren gelesen habe, scheint es hier aber starke Qualitätsschwankungen zu geben, sodass die Aussage zur Lautstärke des Laufwerks sich nur auf meinen Player beziehen kann.
Die Navigation geht flott und das Einlesen von Medien erfolgt zügig (wobei ich aber vom Pioneer auch geduldiges Warten gewohnt war).
Fernbedienung
 Die Fernbedienung ist verhältnismäßig klein und kommt mit wenigen Tasten daher. Die Tasten sindaus Gummi und fühlen sich etwas schwammig an. Generell geht die Bedienung der Grundfunktionen und der Einstellungen über die FB gut von der Hand, wobei ich aber die Farb- und Zahlentasten definitiv für zu schmal halte. Wer diese öfters verwendet, der sollte über die Nutzung einer Universalfernbedienung nachdenken.
Die Fernbedienung ist verhältnismäßig klein und kommt mit wenigen Tasten daher. Die Tasten sindaus Gummi und fühlen sich etwas schwammig an. Generell geht die Bedienung der Grundfunktionen und der Einstellungen über die FB gut von der Hand, wobei ich aber die Farb- und Zahlentasten definitiv für zu schmal halte. Wer diese öfters verwendet, der sollte über die Nutzung einer Universalfernbedienung nachdenken.Stichwort "Universalfernbedienung":
Mir ist es bisher noch nicht gelungen eine in der Datenbank meiner Nevo Q50 (bzw. in der Datendank von URC) fehlende Taste der Philips-FB korrekt anzulernen. Eine Logitech Harmony 885 hat keine Problem damit, doch bei der Nevo muss ich immer erst eine andere Taste drücken, bevor die angelernte Taste wieder genutzt werden kann.
Fazit
Ich halte den Philips BDP9600 für einen durchaus guten BD-Player. Verarbeitung und Materialanmutung heben ihn vom Gros der momentan erhältlichen Player ab und lassen ihn fast schon wie ein Gerät der Oberklasse wirken.
Nicht ganz überzeugen kann mich das Deinterlacing von DVDs, die irgendwie nicht so ganz zu den Testergebnissen sämtlicher Magazine passen will. Aber vielleicht sind meine Test-Kriterien einfach kritischer.
Insgesamt also ein tolles Gerät, das meiner Meinung nach einfach nicht wirklich dem Referenz-Status, den es in vielen Magazinen erlangt hat, gerecht wird. Hier wurden von der Presse einfach Erwartungen geschürt, die der Player dann nicht wirklich erfüllt.
Für einen Marktpreis von € 500 (Listenpreis liegt bei € 750) erhält man jedenfalls einen Player, der viel Spaß macht. Ich würde ihn noch mal kaufen!
Gibt es eigentlich noch "Bild" ohne "3D"...?
27. März 2011Hallo zusammen,
heute mal kein sonderlich konstruktiver Beitrag, sondern einfach nur mal eine Beobachtung der letzten Zeit, die ich gerne kommentieren möchte.
Als ich vor ein paar Wochen dabei war, mir meinen neuen Beamer zu kaufen, fiel mir auf, dass die deutschen Magazine "Heimkino" und "Audiovision" mir da nicht die geringste Hilfestellung leisten konnten.
Warum? Ganz einfach:
Wenn ein Beamer es wert sein soll, dass man über ihn berichtet, dann muss er 3D-fähig sein.
Anscheinend geht die deutsche Presse davon aus, dass alle Leute, die ein größeres Interesse an Heimkino haben und sich daher die entsprechende Magazine kaufen, immer nur über das "Neueste" und das "Beste" lesen wollen...
Ist das wirklich so? Ist ein Beamer wie der in der aktuellen AV getestete Sony VW 90, der im 3D-Betrieb faktisch nur so viel Licht bereit stellt, um eine Bildbreite von 55 cm adäquat zu beleuchten, wirklich ein erstrebenswertes Gerät? Möchte der Heimkino-Enthusiast mit solchen Kompromissen wirklich leben, nur um effekthaschend ein paar wenige Filme in 3D zu schauen?
Meiner Ansicht nach ist es nicht so! Stattdessen gibt es sicherlich eine umso größere Zahl von ernsthaften Heimkino-Fans, die 3D liebend gerne gegen natürliche Farben und einen hohen Kontrast samt vernünftiger Helligkeit einlösen würden. Oder wie wäre es einfach mal wieder mit ein paar Tests von Beamern in der Klasse bis € 3000, die in 2D für ihren Preis besonders viel leisten?
Ich habe im Moment den Eindruck, dass die deutsche Presse an der Mehrzahl der Kunden vorbeiberichterstattet. Nur, weil etwas gerade "hipp" ist, heißt es nicht, dass es besser ist. Nur weil die Gerätehersteller einen Technik wie 3D pushen wollen, heißt es nicht, dass sie im Moment schon gehobenen Ansprüchen in Sachen Bildqualität gerecht wird. Da muss man sich dann schon mal die Frage erlauben dürfen, was denn ein reiner 2D-Beamer zum Preis von € 6000 alles im Stande zu leisten ist.
Mein Fazit: Wenn schon unbedingt alles auf die 3D-Schiene gebracht werden muss, dann doch bitte auf TV-Geräte konzentrieren, denn hier bekomme ich ein brauchbares Bild mittlerweile schon in der € 1500 Klasse. Wenn aber ein Beamer für über € 6000 im Moment mit der tollen neuen Technik eher mehr Kompromisse als kompromisslose Begeisterung produziert, dann sollte man sich fragen, ob solche Geräte für die Käufer von High-End-Geräten heute überhaupt schon von Interesse sind.
Daher mein Aufruf: Es gibt erstens noch genug tolle 2D-Geräte und zweitens auch genug Heimkino-Fans, die im Moment auf 3D pfeifen. Anstatt den verhaltenen Hype um 3D künstlich zu unterstützen, bitte auch mal praktisch Nutzbares schreiben, auch wenn es sich nicht so spektakulär liest, denn ein wahrer Heimkino-Fan definiert sich nicht dadurch, dass er jedem Trend blind hinterher läuft.
Just my 2 cents, musste ich einfach mal loswerden!
Viele Grüße
Markus
heute mal kein sonderlich konstruktiver Beitrag, sondern einfach nur mal eine Beobachtung der letzten Zeit, die ich gerne kommentieren möchte.
Als ich vor ein paar Wochen dabei war, mir meinen neuen Beamer zu kaufen, fiel mir auf, dass die deutschen Magazine "Heimkino" und "Audiovision" mir da nicht die geringste Hilfestellung leisten konnten.
Warum? Ganz einfach:
Wenn ein Beamer es wert sein soll, dass man über ihn berichtet, dann muss er 3D-fähig sein.
Anscheinend geht die deutsche Presse davon aus, dass alle Leute, die ein größeres Interesse an Heimkino haben und sich daher die entsprechende Magazine kaufen, immer nur über das "Neueste" und das "Beste" lesen wollen...
Ist das wirklich so? Ist ein Beamer wie der in der aktuellen AV getestete Sony VW 90, der im 3D-Betrieb faktisch nur so viel Licht bereit stellt, um eine Bildbreite von 55 cm adäquat zu beleuchten, wirklich ein erstrebenswertes Gerät? Möchte der Heimkino-Enthusiast mit solchen Kompromissen wirklich leben, nur um effekthaschend ein paar wenige Filme in 3D zu schauen?
Meiner Ansicht nach ist es nicht so! Stattdessen gibt es sicherlich eine umso größere Zahl von ernsthaften Heimkino-Fans, die 3D liebend gerne gegen natürliche Farben und einen hohen Kontrast samt vernünftiger Helligkeit einlösen würden. Oder wie wäre es einfach mal wieder mit ein paar Tests von Beamern in der Klasse bis € 3000, die in 2D für ihren Preis besonders viel leisten?
Ich habe im Moment den Eindruck, dass die deutsche Presse an der Mehrzahl der Kunden vorbeiberichterstattet. Nur, weil etwas gerade "hipp" ist, heißt es nicht, dass es besser ist. Nur weil die Gerätehersteller einen Technik wie 3D pushen wollen, heißt es nicht, dass sie im Moment schon gehobenen Ansprüchen in Sachen Bildqualität gerecht wird. Da muss man sich dann schon mal die Frage erlauben dürfen, was denn ein reiner 2D-Beamer zum Preis von € 6000 alles im Stande zu leisten ist.
Mein Fazit: Wenn schon unbedingt alles auf die 3D-Schiene gebracht werden muss, dann doch bitte auf TV-Geräte konzentrieren, denn hier bekomme ich ein brauchbares Bild mittlerweile schon in der € 1500 Klasse. Wenn aber ein Beamer für über € 6000 im Moment mit der tollen neuen Technik eher mehr Kompromisse als kompromisslose Begeisterung produziert, dann sollte man sich fragen, ob solche Geräte für die Käufer von High-End-Geräten heute überhaupt schon von Interesse sind.
Daher mein Aufruf: Es gibt erstens noch genug tolle 2D-Geräte und zweitens auch genug Heimkino-Fans, die im Moment auf 3D pfeifen. Anstatt den verhaltenen Hype um 3D künstlich zu unterstützen, bitte auch mal praktisch Nutzbares schreiben, auch wenn es sich nicht so spektakulär liest, denn ein wahrer Heimkino-Fan definiert sich nicht dadurch, dass er jedem Trend blind hinterher läuft.
Just my 2 cents, musste ich einfach mal loswerden!
Viele Grüße
Markus
Epson EH-TW3200 - Wieviel Beamer bekommt man für € 1000?
20. März 2011Hallo zusammen,
nachdem ich ja gezwungen war, mir ungeplant einen neuen neuen Beamer zuzulegen, möchte ich euch heute nach 2 Wochen Testzeit ein paar Eindrücke meines neuen Epson EH-TW3200 geben.
Um eins vorweg zu nehmen: Man bekommt auch für € 1000 echtes HD-Feeling, wenn auch mit leichten Einschränkungen.
(kleine Anmerkung für die, die auch im hifi-forum lesen: Teile dieses Blogeintrags habe ich auch dort schon gepostet, ich gehe aber hier noch mehr auf Details ein).
Auspacken
 Obwohl der Epson ein Riesen-Teil ist, ist der Karton verhältnismäßig klein. Ist es eigentlich heutzutage tatsächlich zu viel verlangt, dass einem solchen Gerät eine gedruckte Anleitung beiliegt?! Anscheinend ja, denn es liegt nur eine wirkliche Kurzanleitung mit in der Box, die richtige Anleitung befindet sich als PDF auf einer CD. Na ja, immer noch besser, als wenn man sie sich erst noch runterladen muss.
Obwohl der Epson ein Riesen-Teil ist, ist der Karton verhältnismäßig klein. Ist es eigentlich heutzutage tatsächlich zu viel verlangt, dass einem solchen Gerät eine gedruckte Anleitung beiliegt?! Anscheinend ja, denn es liegt nur eine wirkliche Kurzanleitung mit in der Box, die richtige Anleitung befindet sich als PDF auf einer CD. Na ja, immer noch besser, als wenn man sie sich erst noch runterladen muss.
Der Epson macht von der Haptik her einen guten ersten und auch zweiten Eindruck. Das Gehäuse ist glänzend weiß, somit macht er sich gut an einer gleichfarbigen Zimmerdecke. Mit 2 HDMI-Eingängen ist er gut ausgestattet und er hat sogar einen "richtigen" Netzschalter.
Montage + Halterung
Da die Abstände der Montageschrauben beim Epson sehr groß sind (35cm) musste ich mir leider eine neue Deckenhalterung kaufen. Nach einiger Sucherei habe ich mich für das Modell Tronje P3025 entschieden, die es bei Amazon für € 36 gibt. Sie bietet auf der einen Seite die Möglichkeit, den Beamer direkt (in ca. 10 bis 12 cm Abstand) unter der Decke zu montieren, man kann den Abstand mittels der beiliegenden Rohre aber auch relativ flexibel vergrößern. Der Beamer wird mit "Winkeln" an die große Platte (links im BIld) geschraubt, die dann mit einem Kugelgelenk versehen wird. Die gesamte Konstruktion wird dann in eine stabile Befestigungsplatte geschoben, die man vorher an der Decke befestigt hat, und dort verschraubt.
Sie bietet auf der einen Seite die Möglichkeit, den Beamer direkt (in ca. 10 bis 12 cm Abstand) unter der Decke zu montieren, man kann den Abstand mittels der beiliegenden Rohre aber auch relativ flexibel vergrößern. Der Beamer wird mit "Winkeln" an die große Platte (links im BIld) geschraubt, die dann mit einem Kugelgelenk versehen wird. Die gesamte Konstruktion wird dann in eine stabile Befestigungsplatte geschoben, die man vorher an der Decke befestigt hat, und dort verschraubt.
 Nach Montage macht das alles einen sehr robusten Eidruck und man kann den Beamer dank des Kugelgelenks ausrichten. Das Kugelgelenk ist etwas "störrisch", aber da man die Ausrichtung ja nur 1x macht, geht das schon in Ordnung. So kann man auch ohne Angst haben zu müssen, etwas zu verstellen, am Fokus, am Zoom und am Lense-Shift etwas einstellen.Da der Beamer so groß ist, fällt die Halterung gerade bei der deckennahen Installation so gut wie gar nicht auf.
Nach Montage macht das alles einen sehr robusten Eidruck und man kann den Beamer dank des Kugelgelenks ausrichten. Das Kugelgelenk ist etwas "störrisch", aber da man die Ausrichtung ja nur 1x macht, geht das schon in Ordnung. So kann man auch ohne Angst haben zu müssen, etwas zu verstellen, am Fokus, am Zoom und am Lense-Shift etwas einstellen.Da der Beamer so groß ist, fällt die Halterung gerade bei der deckennahen Installation so gut wie gar nicht auf.
EInstellen
Der Epson hat einen Zoom mit Faktor 2.1. Damit bietet er einen weiten Spielraum für eine flexible Aufstellung. Außerdem verfügt er über einen Lenseshift, der die komplette Optik nach oben und nach unten sowie nach links und rechts verschiebt. Man muss also den Beamer bei der Installation nicht 100%ig auf die Leinwand ausrichten, sondern erledigt das einfach mit dem Lenseshift. Sehr praktische Sache, einziger Nachteil ist, dass man sich den Funktionsbereich des Lenseshift kreisförmig vorstellen muss: Wenn man ihn als aus der Mittelstellung heraus ganz nach oben dreht, dann hat man nach links und rechts nur noch wenig Spielraum. Da man den Lenseshift aber sowieso nicht bis in die Grenzbereiche nutzen sollte (da kann es sein, dass es zu Konvergenzfehlern kommt), ist dieses Problem eher theoretischer Natur.
Jetzt also ein paar konkrete Eindrücke und Vergleiche mit meinen bisherigen Beamern, dem Sony VPL-HS60 und dem Epson EMP-TW200H:
Schwarzwert
Was mir direkt beim ersten Einschalten auffiel, war der im Vergleich zum Sony etwas schlechtere Schwarzwert. Der Sony hat z.B. Widescreen-Balken dunkler dargestellt. Dieser Eindruck hat sich auch noch Einstellung des Epson mit Testbildern nicht geändert. Trotzdem wirkt das Bild des Epson nicht "vernebelt", wenn die Darstellung dunkler Szenen gefragt ist.
Kontrast
Der Im-Bild-Kontrast ist gefühlt sehr hoch. Wenn man als schwarze Stellen in einer Bildkomposition hat, dann sind die auch sehr schwarz und das Weiß ist blendend weiß.
Helligkeit
Bei mir beleuchtet der 3200er eine Rahmenleinwand mit 2m Bildbreite. Selbst im von mir genutzten Cinema-Eco-Modus blenden einen helle Szenen buchstäblich. Das kannte ich vom Sony nicht. Da hatte man selbst bei hellen Szenen immer den Eindruck, dass der Himmel bedeckt ist. Beim Epson scheint im wahrsten Sinne des Wortes die Sonne.
Iris
Mit der Iris wird je nach Helligkeit des Blldmaterials der Lichtstrom der Lampe gedrosselt. Wenn man also einen SciFi-Film mit dunklen Weltraumbildern schaut, dann verkleinert die Iris den Lichtaustritt von der Lampe zum LCD-Panel und erzeugt somit ein besseres Scharz. Wird bei Tageslichtszenen mehr Licht gebraucht, dann öffnet die Iris sich und lässt mehr Licht durch.
Die Iris beim Sony war leiser (hat man nur gehört. wenn wirklich von komplett schwarz auf komplett weiß gewechselt wurde) und irgendwie "intelligenter" programmiert. Ich habe beim Epson den Eindruck, dass die Iris hier weniger Abstufungen hat, sagen wir mal insgesamt zwischen "Geschlossen" und "Offen" gibt es 5 Abstufungen in 20% Schritten. Beim Sony kam es mir so vor, als ob es feinere Abstufungen gab.
Lautstärke
Ist an sich in Ordnung. "An sich"? Na ja, ich habe den Beamer kopfüber an der Decke hängen. Wenn man den Beamer dementsprechend einstellt, dann legt der Lüfter im Vergleich zum angenehmen Eco-Modus wieder ein paar Umdrehungen zu und die hört man dann durchaus. Ich habe gestern aber mal einen leiseren Film geschaut und nach ein paar Minuten nimmt man den Lüfter nicht mehr war.
Bei der Lautstärke der Iris bin ich noch hin und her gerissen. Ich sitze ca. 1,8m schräg unten hinter dem Beamer und in leisen Szenen hört man schon das Nachregeln (also das Öffnen und Schließen der Iris). Ich würde das Geräusch mit dem Vergleichen, das eine Festplatte im Zugriff verursacht, insofern denke ich mal, dass mir das nur auffällt, weil die Sony-Iris eben im Filmbetrieb komplett leise war.
Konvergenz
Geht in Ordnung. Ich benutze den vertikalen Lense-Shift recht stark (Bildunterkante etwas bei 60 cm, Decke ist 2,30m hoch und der Beamer hängt ca. 10cm von der Decke) und da sieht man im unteren Viertel des Bilder schon leichte Farbsäume. Wenn ich 50 cm vor der Leinwand stehe. Im Filmbetrieb fällt davon rein gar nichts auf. Insofern passt das für mich sehr gut.
Graustufen
Ich habe bisher nur kurz mit Graustufen-Testbildern rumprobiert und konnte da keine Einfärbungen feststellen. Das war damals beim TW200 auch schon so und ich war danach vom Sony etwas enttäuscht, da der gerade in den oberen Bildecken deutlich rot eingefärbt war (angeblich lag das aber innerhalb der Spezifikationen). Beim 3200er ist nun alles grau und nicht bunt. Ich hatte bisher die BD vom "Psycho" geschaut und das Bild war schwarz-weiß, ohne Einfärbung. So muss es sein.
Uniformität der Ausleuchtung
Wenn ich ein reinen Schwarzbild auf die Leinwand werfe, dann fällt auf, dass das rechte Fünftel des Bildes leicht, aber auch nur ganz leicht heller ist als der Rest. Ich konnte das beim Filmschauen selbst bei Weltraumszenen aber nicht erkennen.
Fazit
Auch wenn sich das eine oder andere jetzt vielleicht kritisch anhört, muss man sich zuallererst einmal vor Augen halten, dass es sich bei einem FullHD-Beamer für € 1000 um ein Einsteigergerät handelt. In dieser Preisklasse ist leider die Serienstreuung groß und man kann auch nicht die Qualität erwarten, die ein Gerät für € 2000 aufwärts bietet.
Was man aber erwarten kann, das ist ein gutes BIld und genau das liefert der Epson auch. Wenn ich mir einen Film anschaue, dann möchte ich ihn genießen und nicht von irgendwelchen Bildfehlern etc. abgelenkt werden. Genau das schafft der Epson. Sicher, wenn ich es darauf anlege, dann kann ich mit Testbildern theoretische Probleme feststellen. Theoretisch deshalb, weil sie beim Anschauen eines Films nicht auffallen.
So bleibt für mich im Moment wenn überhaupt, der einzige größere Kritikpunkt die Lautstärke und Funktionsweise der Iris. Die hat beim Sony vor ein paar Jahren besser funktioniert, aber der Sony spielte auch in einer anderen Preis-Liga (vor 4 Jahren hat der noch € 2500 gekostet). Heute bekommt man also für € 1000 schon ein FullHD-Bild, aber trotzdem können die Hersteller keine Wunder vollbringen, irgendwo muss bei diesem Preis gespart werden und zwar nicht nur bei der eingangs erwähnten Anleitung in PDF-Form.
In diesem Sinne vielen Dank fürs Lesen und viele Grüße
Markus
nachdem ich ja gezwungen war, mir ungeplant einen neuen neuen Beamer zuzulegen, möchte ich euch heute nach 2 Wochen Testzeit ein paar Eindrücke meines neuen Epson EH-TW3200 geben.
Um eins vorweg zu nehmen: Man bekommt auch für € 1000 echtes HD-Feeling, wenn auch mit leichten Einschränkungen.
(kleine Anmerkung für die, die auch im hifi-forum lesen: Teile dieses Blogeintrags habe ich auch dort schon gepostet, ich gehe aber hier noch mehr auf Details ein).
Auspacken
 Obwohl der Epson ein Riesen-Teil ist, ist der Karton verhältnismäßig klein. Ist es eigentlich heutzutage tatsächlich zu viel verlangt, dass einem solchen Gerät eine gedruckte Anleitung beiliegt?! Anscheinend ja, denn es liegt nur eine wirkliche Kurzanleitung mit in der Box, die richtige Anleitung befindet sich als PDF auf einer CD. Na ja, immer noch besser, als wenn man sie sich erst noch runterladen muss.
Obwohl der Epson ein Riesen-Teil ist, ist der Karton verhältnismäßig klein. Ist es eigentlich heutzutage tatsächlich zu viel verlangt, dass einem solchen Gerät eine gedruckte Anleitung beiliegt?! Anscheinend ja, denn es liegt nur eine wirkliche Kurzanleitung mit in der Box, die richtige Anleitung befindet sich als PDF auf einer CD. Na ja, immer noch besser, als wenn man sie sich erst noch runterladen muss.Der Epson macht von der Haptik her einen guten ersten und auch zweiten Eindruck. Das Gehäuse ist glänzend weiß, somit macht er sich gut an einer gleichfarbigen Zimmerdecke. Mit 2 HDMI-Eingängen ist er gut ausgestattet und er hat sogar einen "richtigen" Netzschalter.
Montage + Halterung
Da die Abstände der Montageschrauben beim Epson sehr groß sind (35cm) musste ich mir leider eine neue Deckenhalterung kaufen. Nach einiger Sucherei habe ich mich für das Modell Tronje P3025 entschieden, die es bei Amazon für € 36 gibt.
 Sie bietet auf der einen Seite die Möglichkeit, den Beamer direkt (in ca. 10 bis 12 cm Abstand) unter der Decke zu montieren, man kann den Abstand mittels der beiliegenden Rohre aber auch relativ flexibel vergrößern. Der Beamer wird mit "Winkeln" an die große Platte (links im BIld) geschraubt, die dann mit einem Kugelgelenk versehen wird. Die gesamte Konstruktion wird dann in eine stabile Befestigungsplatte geschoben, die man vorher an der Decke befestigt hat, und dort verschraubt.
Sie bietet auf der einen Seite die Möglichkeit, den Beamer direkt (in ca. 10 bis 12 cm Abstand) unter der Decke zu montieren, man kann den Abstand mittels der beiliegenden Rohre aber auch relativ flexibel vergrößern. Der Beamer wird mit "Winkeln" an die große Platte (links im BIld) geschraubt, die dann mit einem Kugelgelenk versehen wird. Die gesamte Konstruktion wird dann in eine stabile Befestigungsplatte geschoben, die man vorher an der Decke befestigt hat, und dort verschraubt. Nach Montage macht das alles einen sehr robusten Eidruck und man kann den Beamer dank des Kugelgelenks ausrichten. Das Kugelgelenk ist etwas "störrisch", aber da man die Ausrichtung ja nur 1x macht, geht das schon in Ordnung. So kann man auch ohne Angst haben zu müssen, etwas zu verstellen, am Fokus, am Zoom und am Lense-Shift etwas einstellen.Da der Beamer so groß ist, fällt die Halterung gerade bei der deckennahen Installation so gut wie gar nicht auf.
Nach Montage macht das alles einen sehr robusten Eidruck und man kann den Beamer dank des Kugelgelenks ausrichten. Das Kugelgelenk ist etwas "störrisch", aber da man die Ausrichtung ja nur 1x macht, geht das schon in Ordnung. So kann man auch ohne Angst haben zu müssen, etwas zu verstellen, am Fokus, am Zoom und am Lense-Shift etwas einstellen.Da der Beamer so groß ist, fällt die Halterung gerade bei der deckennahen Installation so gut wie gar nicht auf.EInstellen
Der Epson hat einen Zoom mit Faktor 2.1. Damit bietet er einen weiten Spielraum für eine flexible Aufstellung. Außerdem verfügt er über einen Lenseshift, der die komplette Optik nach oben und nach unten sowie nach links und rechts verschiebt. Man muss also den Beamer bei der Installation nicht 100%ig auf die Leinwand ausrichten, sondern erledigt das einfach mit dem Lenseshift. Sehr praktische Sache, einziger Nachteil ist, dass man sich den Funktionsbereich des Lenseshift kreisförmig vorstellen muss: Wenn man ihn als aus der Mittelstellung heraus ganz nach oben dreht, dann hat man nach links und rechts nur noch wenig Spielraum. Da man den Lenseshift aber sowieso nicht bis in die Grenzbereiche nutzen sollte (da kann es sein, dass es zu Konvergenzfehlern kommt), ist dieses Problem eher theoretischer Natur.
Jetzt also ein paar konkrete Eindrücke und Vergleiche mit meinen bisherigen Beamern, dem Sony VPL-HS60 und dem Epson EMP-TW200H:
Schwarzwert
Was mir direkt beim ersten Einschalten auffiel, war der im Vergleich zum Sony etwas schlechtere Schwarzwert. Der Sony hat z.B. Widescreen-Balken dunkler dargestellt. Dieser Eindruck hat sich auch noch Einstellung des Epson mit Testbildern nicht geändert. Trotzdem wirkt das Bild des Epson nicht "vernebelt", wenn die Darstellung dunkler Szenen gefragt ist.
Kontrast
Der Im-Bild-Kontrast ist gefühlt sehr hoch. Wenn man als schwarze Stellen in einer Bildkomposition hat, dann sind die auch sehr schwarz und das Weiß ist blendend weiß.
Helligkeit
Bei mir beleuchtet der 3200er eine Rahmenleinwand mit 2m Bildbreite. Selbst im von mir genutzten Cinema-Eco-Modus blenden einen helle Szenen buchstäblich. Das kannte ich vom Sony nicht. Da hatte man selbst bei hellen Szenen immer den Eindruck, dass der Himmel bedeckt ist. Beim Epson scheint im wahrsten Sinne des Wortes die Sonne.
Iris
Mit der Iris wird je nach Helligkeit des Blldmaterials der Lichtstrom der Lampe gedrosselt. Wenn man also einen SciFi-Film mit dunklen Weltraumbildern schaut, dann verkleinert die Iris den Lichtaustritt von der Lampe zum LCD-Panel und erzeugt somit ein besseres Scharz. Wird bei Tageslichtszenen mehr Licht gebraucht, dann öffnet die Iris sich und lässt mehr Licht durch.
Die Iris beim Sony war leiser (hat man nur gehört. wenn wirklich von komplett schwarz auf komplett weiß gewechselt wurde) und irgendwie "intelligenter" programmiert. Ich habe beim Epson den Eindruck, dass die Iris hier weniger Abstufungen hat, sagen wir mal insgesamt zwischen "Geschlossen" und "Offen" gibt es 5 Abstufungen in 20% Schritten. Beim Sony kam es mir so vor, als ob es feinere Abstufungen gab.
Lautstärke
Ist an sich in Ordnung. "An sich"? Na ja, ich habe den Beamer kopfüber an der Decke hängen. Wenn man den Beamer dementsprechend einstellt, dann legt der Lüfter im Vergleich zum angenehmen Eco-Modus wieder ein paar Umdrehungen zu und die hört man dann durchaus. Ich habe gestern aber mal einen leiseren Film geschaut und nach ein paar Minuten nimmt man den Lüfter nicht mehr war.
Bei der Lautstärke der Iris bin ich noch hin und her gerissen. Ich sitze ca. 1,8m schräg unten hinter dem Beamer und in leisen Szenen hört man schon das Nachregeln (also das Öffnen und Schließen der Iris). Ich würde das Geräusch mit dem Vergleichen, das eine Festplatte im Zugriff verursacht, insofern denke ich mal, dass mir das nur auffällt, weil die Sony-Iris eben im Filmbetrieb komplett leise war.
Konvergenz
Geht in Ordnung. Ich benutze den vertikalen Lense-Shift recht stark (Bildunterkante etwas bei 60 cm, Decke ist 2,30m hoch und der Beamer hängt ca. 10cm von der Decke) und da sieht man im unteren Viertel des Bilder schon leichte Farbsäume. Wenn ich 50 cm vor der Leinwand stehe. Im Filmbetrieb fällt davon rein gar nichts auf. Insofern passt das für mich sehr gut.
Graustufen
Ich habe bisher nur kurz mit Graustufen-Testbildern rumprobiert und konnte da keine Einfärbungen feststellen. Das war damals beim TW200 auch schon so und ich war danach vom Sony etwas enttäuscht, da der gerade in den oberen Bildecken deutlich rot eingefärbt war (angeblich lag das aber innerhalb der Spezifikationen). Beim 3200er ist nun alles grau und nicht bunt. Ich hatte bisher die BD vom "Psycho" geschaut und das Bild war schwarz-weiß, ohne Einfärbung. So muss es sein.
Uniformität der Ausleuchtung
Wenn ich ein reinen Schwarzbild auf die Leinwand werfe, dann fällt auf, dass das rechte Fünftel des Bildes leicht, aber auch nur ganz leicht heller ist als der Rest. Ich konnte das beim Filmschauen selbst bei Weltraumszenen aber nicht erkennen.
Fazit
Auch wenn sich das eine oder andere jetzt vielleicht kritisch anhört, muss man sich zuallererst einmal vor Augen halten, dass es sich bei einem FullHD-Beamer für € 1000 um ein Einsteigergerät handelt. In dieser Preisklasse ist leider die Serienstreuung groß und man kann auch nicht die Qualität erwarten, die ein Gerät für € 2000 aufwärts bietet.
Was man aber erwarten kann, das ist ein gutes BIld und genau das liefert der Epson auch. Wenn ich mir einen Film anschaue, dann möchte ich ihn genießen und nicht von irgendwelchen Bildfehlern etc. abgelenkt werden. Genau das schafft der Epson. Sicher, wenn ich es darauf anlege, dann kann ich mit Testbildern theoretische Probleme feststellen. Theoretisch deshalb, weil sie beim Anschauen eines Films nicht auffallen.
So bleibt für mich im Moment wenn überhaupt, der einzige größere Kritikpunkt die Lautstärke und Funktionsweise der Iris. Die hat beim Sony vor ein paar Jahren besser funktioniert, aber der Sony spielte auch in einer anderen Preis-Liga (vor 4 Jahren hat der noch € 2500 gekostet). Heute bekommt man also für € 1000 schon ein FullHD-Bild, aber trotzdem können die Hersteller keine Wunder vollbringen, irgendwo muss bei diesem Preis gespart werden und zwar nicht nur bei der eingangs erwähnten Anleitung in PDF-Form.
In diesem Sinne vielen Dank fürs Lesen und viele Grüße
Markus
One For All Xsight Touch - Nevo C3 zum Sparpreis
12. Februar 2011Hallo zusammen,
nachdem unsere gute alte Logitech Harmony 885 im Wohnzimmer nach 5 Jahren so langsam den Geist aufgibt (Akku ist hinüber und ein oder zwei Stürze auf den Fliesenboden waren ihrer Gesundheit auch nicht förderlich), hatte ich mich in den letzten Wochen nach neuen Alternativen umgesehen.
Nevo fürs Wohnzimmer? Die C2 und die C3
Wie ja schon in einem früheren Blog-Eintrag geschrieben, bin ich ganz begeistert von meiner Nevo Q50, die im Keller ihren Dienst verrichtet. Jetzt ist die Q50 sicherlich fürs Wohnzimmer reichlich überdimensioniert, es gibt aber ja auch noch die "Konsumer-Reihe" von Nevo, die Modell C2 und C3. Das sind beides Geräte im klassischen Fernbedienungsformat, die neben normalen Tasten im oberen Bereich auch noch einen Touchscreen haben. Hauptunterschied zwischen der C2 und der C3 ist, dass die C3 Befehle auch per Funk senden kann und so z.B. mit Funksteckdosen auf 433 Mhz-Basis sowie einem separat erhältlichen RF-Extender zusammenarbeitet. Damit ist dann auch die Steuerung von Geräten möglich, die nicht in Sichtweite der Fernbedienung liegen.
Obwohl es sich bei der C2 und der C3 um die "Billig-Serie" von Nevo handelt, kostet die C3 regulär immer noch € 250 und in diesem Preis ist der RF-Extender noch nicht mit dabei. Das war mir dann doch ein wenig zu teuer fürs Wohnzimmer.
Nevo für € 69 - von One For All
Durch Zufall bin ich dann vor 2 Wochen darauf aufmerksam geworden, dass die One For All Xsight Touch baugleich mit der Nevo C3 ist. Beide Marken (Nevo und One For All) gehören zu einem Hersteller, Universal Electronics, und der verkauft ein und das selbe Gerät unter unterschiedlichen Namen an unterschiedliche Zielgruppen. Gravierender Unterschied zwischen Nevo und One For All: € 150!
 Tatsächlich kann man die Xsight Touch (Bild-Copyright bei www.oneforall.de) sogar noch viel günstiger bekommen. Ich habe z.B. bei Mediamarkt in Krefeld magere € 69 bezahlt. Die mit der Nevo C2 baugleiche Xsight Colour kostet dort läppische € 49.
Tatsächlich kann man die Xsight Touch (Bild-Copyright bei www.oneforall.de) sogar noch viel günstiger bekommen. Ich habe z.B. bei Mediamarkt in Krefeld magere € 69 bezahlt. Die mit der Nevo C2 baugleiche Xsight Colour kostet dort läppische € 49.
Ich habe nun die letzten 2 Wochen die One For All Xsight Touch zusammen mit dem RF-Extender URC 8600 (kostet um die € 50) für den Einsatz in unserem Wohnzimmer programmiert und bin nach anfänglichen Umstellungsproblemen durchaus von der Fernbedienung selbst, ihrer Zuverlässigkeit und der Programmierung angetan.
Sind Xsight oder C3 "echte" Nevos?
Eines vorne weg: die Programmierung der Xsight Touch bzw. der C3 hat nichts, aber auch rein gar nichts mit der Flexibilität gemein, die ich von der Software der Nevo Q50 gewohnt bin. Die Programmierung über den PC ist sehr an den unerfahrenen Nutzer angepasst, bietet nicht übermäßig viele Möglichkeiten zum Anpassen, verwirrt daher aber auch nicht unnötig.
Wichtiger Unterschied zur Harmony-Serie: die One For All merkt sich nicht, ob sie ein Gerät ein- oder ausgeschaltet hat. Dadurch muss man sich bei der Programmierung von "Aktivitäten" vorher einige Gedanken darüber machen, wie dieses gestaltet werden sollen.
Die Programmierung - Ein wenig aufwendig
Wie programmiert man die Xsight Touch nun? Es gibt da 3 Möglichkeiten: entweder direkt über die Fernbedienung, per PC-Software oder mit einer Kombination aus beiden Möglichkeiten. Ich habe mich für letztere Alternative entschieden.
Man fügt also erst einmal die benötigten Geräte per Assistent über die PC-Software hinzu. Da Universal Electronics über eine sehr große Datenbank an Geräte-Codes verfügt, stehen die Chance gut, das die hinzuzufügenden Geräte direkt in der Datenbank sind.
Während des Hinzufügens der Geräte fällt dann auch schnell auf, ob alle Codes der Original-Fernbedienung vorhanden sind. Sollte dies nicht der Fall sein, dann macht man folgendes: die Fernbedienung wird mit der PC-Software synchronisiert und erhält so den aktuellen Stand der Programmierung, wie man ihn bis zu diesem Zeitpunkt am PC erstellt hat.
Dann fügt man direkt über die Fernbedienung per Lernfunktion die noch fehlenden Tasten hinzu und synchronisiert erneut mit dem PC. Hierbei kopiert man nun den Stand der Fernbedienung (inkl. der neu gelernten Befehle) auf den PC zurück.
Sobald man das getan hat, kann man sich an die Programmierung von Makros (Befehlsfolgen) und Aktivitäten machen.
Einschränkungen
Dabei muss man sich auf ein paar Beschränkungen einlassen. Z.B. kann man die Tastenbelegung einer Aktivität nicht komplett frei wählen. Die Software teilt die Tasten der Fernbedienung in einzelne Zonen ein, z.B. Touchscreen, Steuerkreuz, Farbtasten, Laufwerkstasten.
Innerhalb einer Aktivität kann man diesen Zonen nun die Belegung eines Gerätes zuweisen. Das bedeutet, dass man bei der Aktivität "DVD schauen" den Lauwerkstasten die Funktionen zuweist, die sie unter dem Geräte "DVD-Player" haben, logisch. Wie sieht es aber aus, wenn ich neben der Lautstärke (einzustellen über den "AV-Receiver") und die Laufwerkstasten (entsprechen der Belegung des Gerätes "DVD-Player") noch ein oder zwei Funktionen eines anderen Gerätes (z.B. eines Audio-Delays) verwenden möchte und diese auf dem Touchscreen erscheinen sollen? Wenn ich mich damit abfinden kann, dass mir die Xsight dann in der Aktivität "DVD schauen" auf dem Display neben den zwei gewünschten Tasten zig andere Funktionen des Audio-Delays anzeigt, dann ist alles in Ordnung. Wenn ich aber auf dem Display nur die Funktionen sehen möchte, die für "DVD schauen" benötigt werden, dann wird es komplizierter. Ich muss dann das Gerät "Audio-Delay" bearbeiten und all das löschen, was ich bei "DVD schauen" nicht auf dem Display sehen möchte. Leider komme ich dann aber auch nicht mehr per Geräteauswahl "Audio-Delay" an die seltener benötigten Funktionen dieses Gerätes heran.
Ich bin im Endeffekt dazu über gegangen, für das Gerät "DVD-Player" auf das Display all das zu legen, was ich während der Aktivität "DVD schauen" benötige. auf Geräteebene ist es nämlich möglich, die Belegung aller Tasten frei zu wählen.
Eine andere Einschränkung ist die bereits erwähnte nicht vorhandene Speicherung der Einschaltzustände der Geräte. Das ist so lange kein Problem, wie man nur Geräte hat, die jeweils einen eigenen Befehl fürs An- und Ausschalten haben. Wenn man aber Geräte hat, die nur einen Wechselschalter "An/Aus" haben, dann muss man wieder ein wenig überlegen, wie man das lösen kann.
Alles per Funk steuern? Klappt super!
Wenn man die Xsight Touch mit dem URC 8600 RF-Extender (Bild-Copyright bei www.oneforall.de) erweitert, dann kann man alle Geräte auch steuern, wenn sie nicht in Sichtweite der Fernbedienung stehen.
 Aber auch wenn die Fernbedienung normalerweise direkt auf die Geräte gerichtet ist, bietet die Steuerung über Funk einen dicken Vorteil: wenn man eine Aktivität startet und die Fernbedienung während des Starts eine Vielzahl von Befehlen an zig Geräte sendet ("TV an", "AV-Receiver an", "Am TV HDMI 1 wählen", "Am AV-Receiver DVD wählen" etc.), dann ist es verdammt bequem, wenn man nur einfach die Aktivität-Taste drückt und die Fernbedienung dann einfach irgendwo hinlegen kann. Ohne Funk müsste man jetzt da sitzen und die Fernbedienung so lange auf die Geräte gerichtet halten, bis die Aktivität gestartet ist. Auch im täglichen Einsatz ist es einfach nur bequem, sich nicht darum kümmern zu müssen, die Fernbedienung in Richtung Gerätepark zu halten.
Aber auch wenn die Fernbedienung normalerweise direkt auf die Geräte gerichtet ist, bietet die Steuerung über Funk einen dicken Vorteil: wenn man eine Aktivität startet und die Fernbedienung während des Starts eine Vielzahl von Befehlen an zig Geräte sendet ("TV an", "AV-Receiver an", "Am TV HDMI 1 wählen", "Am AV-Receiver DVD wählen" etc.), dann ist es verdammt bequem, wenn man nur einfach die Aktivität-Taste drückt und die Fernbedienung dann einfach irgendwo hinlegen kann. Ohne Funk müsste man jetzt da sitzen und die Fernbedienung so lange auf die Geräte gerichtet halten, bis die Aktivität gestartet ist. Auch im täglichen Einsatz ist es einfach nur bequem, sich nicht darum kümmern zu müssen, die Fernbedienung in Richtung Gerätepark zu halten.
Der RF-Extender kommt mit 6 Infrarot-Augen, die auf die IR-Empfänger der zu steuernden Geräte geklebt werden. Der Klinkenstecker am anderen Ende der IR-Augen wird dann in den RF-Extender gesteckt. Damit dann alles läuft, muss man nur im Menü der Xsight Touch die Funkfunktion aktivieren. Fertig, das war's schon.
Fazit
Hier ein kurzes Stichwortfazit der positiven und negativen Punkte:
+ Wertige Hardware
+ Nützliche Funk-Integration zur Steuerung von Steckdosen und Geräten
+ Präziser Druckpunkt der "normalen" Tasten
+ Keine Batterien dank Akku
+ Steuerung auch beim Laden in der Ladeschale möglich
+ Direkte Senderwahl über Logos im Display möglich
+ Verschiedene Senderlisten für mehrere Benutzer
+ Preis!!
- Teilweise unflexible (aber dafür einfache) Programmierung
- Keine Speicherung der Einschaltzustände von Geräten
- Datenbank nicht so umfangreich wie die von Logitech Harmony
- EZ-RC-Software läuft nur unter Windows und Internet Explorer
Im Großen und Ganzen kommen sowohl meine Frau als auch ich gut mit der Xsight Touch klar. Wir mussten uns ein wenig umstellen, nachdem die Harmony 885 fünf Jahre ihren Dienst im Wohnzimmer getan hatte, sind aber alles andere als enttäuscht.
In diesem Sinne viele Grüße aus Krefeld! Solltet ihr Fragen haben, dann einfach melden :)
Gruß
Markus
nachdem unsere gute alte Logitech Harmony 885 im Wohnzimmer nach 5 Jahren so langsam den Geist aufgibt (Akku ist hinüber und ein oder zwei Stürze auf den Fliesenboden waren ihrer Gesundheit auch nicht förderlich), hatte ich mich in den letzten Wochen nach neuen Alternativen umgesehen.
Nevo fürs Wohnzimmer? Die C2 und die C3
Wie ja schon in einem früheren Blog-Eintrag geschrieben, bin ich ganz begeistert von meiner Nevo Q50, die im Keller ihren Dienst verrichtet. Jetzt ist die Q50 sicherlich fürs Wohnzimmer reichlich überdimensioniert, es gibt aber ja auch noch die "Konsumer-Reihe" von Nevo, die Modell C2 und C3. Das sind beides Geräte im klassischen Fernbedienungsformat, die neben normalen Tasten im oberen Bereich auch noch einen Touchscreen haben. Hauptunterschied zwischen der C2 und der C3 ist, dass die C3 Befehle auch per Funk senden kann und so z.B. mit Funksteckdosen auf 433 Mhz-Basis sowie einem separat erhältlichen RF-Extender zusammenarbeitet. Damit ist dann auch die Steuerung von Geräten möglich, die nicht in Sichtweite der Fernbedienung liegen.
Obwohl es sich bei der C2 und der C3 um die "Billig-Serie" von Nevo handelt, kostet die C3 regulär immer noch € 250 und in diesem Preis ist der RF-Extender noch nicht mit dabei. Das war mir dann doch ein wenig zu teuer fürs Wohnzimmer.
Nevo für € 69 - von One For All
Durch Zufall bin ich dann vor 2 Wochen darauf aufmerksam geworden, dass die One For All Xsight Touch baugleich mit der Nevo C3 ist. Beide Marken (Nevo und One For All) gehören zu einem Hersteller, Universal Electronics, und der verkauft ein und das selbe Gerät unter unterschiedlichen Namen an unterschiedliche Zielgruppen. Gravierender Unterschied zwischen Nevo und One For All: € 150!
 Tatsächlich kann man die Xsight Touch (Bild-Copyright bei www.oneforall.de) sogar noch viel günstiger bekommen. Ich habe z.B. bei Mediamarkt in Krefeld magere € 69 bezahlt. Die mit der Nevo C2 baugleiche Xsight Colour kostet dort läppische € 49.
Tatsächlich kann man die Xsight Touch (Bild-Copyright bei www.oneforall.de) sogar noch viel günstiger bekommen. Ich habe z.B. bei Mediamarkt in Krefeld magere € 69 bezahlt. Die mit der Nevo C2 baugleiche Xsight Colour kostet dort läppische € 49.Ich habe nun die letzten 2 Wochen die One For All Xsight Touch zusammen mit dem RF-Extender URC 8600 (kostet um die € 50) für den Einsatz in unserem Wohnzimmer programmiert und bin nach anfänglichen Umstellungsproblemen durchaus von der Fernbedienung selbst, ihrer Zuverlässigkeit und der Programmierung angetan.
Sind Xsight oder C3 "echte" Nevos?
Eines vorne weg: die Programmierung der Xsight Touch bzw. der C3 hat nichts, aber auch rein gar nichts mit der Flexibilität gemein, die ich von der Software der Nevo Q50 gewohnt bin. Die Programmierung über den PC ist sehr an den unerfahrenen Nutzer angepasst, bietet nicht übermäßig viele Möglichkeiten zum Anpassen, verwirrt daher aber auch nicht unnötig.
Wichtiger Unterschied zur Harmony-Serie: die One For All merkt sich nicht, ob sie ein Gerät ein- oder ausgeschaltet hat. Dadurch muss man sich bei der Programmierung von "Aktivitäten" vorher einige Gedanken darüber machen, wie dieses gestaltet werden sollen.
Die Programmierung - Ein wenig aufwendig
Wie programmiert man die Xsight Touch nun? Es gibt da 3 Möglichkeiten: entweder direkt über die Fernbedienung, per PC-Software oder mit einer Kombination aus beiden Möglichkeiten. Ich habe mich für letztere Alternative entschieden.
Man fügt also erst einmal die benötigten Geräte per Assistent über die PC-Software hinzu. Da Universal Electronics über eine sehr große Datenbank an Geräte-Codes verfügt, stehen die Chance gut, das die hinzuzufügenden Geräte direkt in der Datenbank sind.
Während des Hinzufügens der Geräte fällt dann auch schnell auf, ob alle Codes der Original-Fernbedienung vorhanden sind. Sollte dies nicht der Fall sein, dann macht man folgendes: die Fernbedienung wird mit der PC-Software synchronisiert und erhält so den aktuellen Stand der Programmierung, wie man ihn bis zu diesem Zeitpunkt am PC erstellt hat.
Dann fügt man direkt über die Fernbedienung per Lernfunktion die noch fehlenden Tasten hinzu und synchronisiert erneut mit dem PC. Hierbei kopiert man nun den Stand der Fernbedienung (inkl. der neu gelernten Befehle) auf den PC zurück.
Sobald man das getan hat, kann man sich an die Programmierung von Makros (Befehlsfolgen) und Aktivitäten machen.
Einschränkungen
Dabei muss man sich auf ein paar Beschränkungen einlassen. Z.B. kann man die Tastenbelegung einer Aktivität nicht komplett frei wählen. Die Software teilt die Tasten der Fernbedienung in einzelne Zonen ein, z.B. Touchscreen, Steuerkreuz, Farbtasten, Laufwerkstasten.
Innerhalb einer Aktivität kann man diesen Zonen nun die Belegung eines Gerätes zuweisen. Das bedeutet, dass man bei der Aktivität "DVD schauen" den Lauwerkstasten die Funktionen zuweist, die sie unter dem Geräte "DVD-Player" haben, logisch. Wie sieht es aber aus, wenn ich neben der Lautstärke (einzustellen über den "AV-Receiver") und die Laufwerkstasten (entsprechen der Belegung des Gerätes "DVD-Player") noch ein oder zwei Funktionen eines anderen Gerätes (z.B. eines Audio-Delays) verwenden möchte und diese auf dem Touchscreen erscheinen sollen? Wenn ich mich damit abfinden kann, dass mir die Xsight dann in der Aktivität "DVD schauen" auf dem Display neben den zwei gewünschten Tasten zig andere Funktionen des Audio-Delays anzeigt, dann ist alles in Ordnung. Wenn ich aber auf dem Display nur die Funktionen sehen möchte, die für "DVD schauen" benötigt werden, dann wird es komplizierter. Ich muss dann das Gerät "Audio-Delay" bearbeiten und all das löschen, was ich bei "DVD schauen" nicht auf dem Display sehen möchte. Leider komme ich dann aber auch nicht mehr per Geräteauswahl "Audio-Delay" an die seltener benötigten Funktionen dieses Gerätes heran.
Ich bin im Endeffekt dazu über gegangen, für das Gerät "DVD-Player" auf das Display all das zu legen, was ich während der Aktivität "DVD schauen" benötige. auf Geräteebene ist es nämlich möglich, die Belegung aller Tasten frei zu wählen.
Eine andere Einschränkung ist die bereits erwähnte nicht vorhandene Speicherung der Einschaltzustände der Geräte. Das ist so lange kein Problem, wie man nur Geräte hat, die jeweils einen eigenen Befehl fürs An- und Ausschalten haben. Wenn man aber Geräte hat, die nur einen Wechselschalter "An/Aus" haben, dann muss man wieder ein wenig überlegen, wie man das lösen kann.
Alles per Funk steuern? Klappt super!
Wenn man die Xsight Touch mit dem URC 8600 RF-Extender (Bild-Copyright bei www.oneforall.de) erweitert, dann kann man alle Geräte auch steuern, wenn sie nicht in Sichtweite der Fernbedienung stehen.
 Aber auch wenn die Fernbedienung normalerweise direkt auf die Geräte gerichtet ist, bietet die Steuerung über Funk einen dicken Vorteil: wenn man eine Aktivität startet und die Fernbedienung während des Starts eine Vielzahl von Befehlen an zig Geräte sendet ("TV an", "AV-Receiver an", "Am TV HDMI 1 wählen", "Am AV-Receiver DVD wählen" etc.), dann ist es verdammt bequem, wenn man nur einfach die Aktivität-Taste drückt und die Fernbedienung dann einfach irgendwo hinlegen kann. Ohne Funk müsste man jetzt da sitzen und die Fernbedienung so lange auf die Geräte gerichtet halten, bis die Aktivität gestartet ist. Auch im täglichen Einsatz ist es einfach nur bequem, sich nicht darum kümmern zu müssen, die Fernbedienung in Richtung Gerätepark zu halten.
Aber auch wenn die Fernbedienung normalerweise direkt auf die Geräte gerichtet ist, bietet die Steuerung über Funk einen dicken Vorteil: wenn man eine Aktivität startet und die Fernbedienung während des Starts eine Vielzahl von Befehlen an zig Geräte sendet ("TV an", "AV-Receiver an", "Am TV HDMI 1 wählen", "Am AV-Receiver DVD wählen" etc.), dann ist es verdammt bequem, wenn man nur einfach die Aktivität-Taste drückt und die Fernbedienung dann einfach irgendwo hinlegen kann. Ohne Funk müsste man jetzt da sitzen und die Fernbedienung so lange auf die Geräte gerichtet halten, bis die Aktivität gestartet ist. Auch im täglichen Einsatz ist es einfach nur bequem, sich nicht darum kümmern zu müssen, die Fernbedienung in Richtung Gerätepark zu halten.Der RF-Extender kommt mit 6 Infrarot-Augen, die auf die IR-Empfänger der zu steuernden Geräte geklebt werden. Der Klinkenstecker am anderen Ende der IR-Augen wird dann in den RF-Extender gesteckt. Damit dann alles läuft, muss man nur im Menü der Xsight Touch die Funkfunktion aktivieren. Fertig, das war's schon.
Fazit
Hier ein kurzes Stichwortfazit der positiven und negativen Punkte:
+ Wertige Hardware
+ Nützliche Funk-Integration zur Steuerung von Steckdosen und Geräten
+ Präziser Druckpunkt der "normalen" Tasten
+ Keine Batterien dank Akku
+ Steuerung auch beim Laden in der Ladeschale möglich
+ Direkte Senderwahl über Logos im Display möglich
+ Verschiedene Senderlisten für mehrere Benutzer
+ Preis!!
- Teilweise unflexible (aber dafür einfache) Programmierung
- Keine Speicherung der Einschaltzustände von Geräten
- Datenbank nicht so umfangreich wie die von Logitech Harmony
- EZ-RC-Software läuft nur unter Windows und Internet Explorer
Im Großen und Ganzen kommen sowohl meine Frau als auch ich gut mit der Xsight Touch klar. Wir mussten uns ein wenig umstellen, nachdem die Harmony 885 fünf Jahre ihren Dienst im Wohnzimmer getan hatte, sind aber alles andere als enttäuscht.
In diesem Sinne viele Grüße aus Krefeld! Solltet ihr Fragen haben, dann einfach melden :)
Gruß
Markus
Noch mal kurz: Optimierung der Raumakustik Teil 2
5. Dezember 2010Hallo zusammen und viele Grüße aus dem verschneiten Krefeld :-)
Aufgrund einiger Anfragen nehme ich heute noch mal das Thema "Optimierung der Raumakustik" auf. Mir war beim letzten Eintrag zu diesem Thema gar nicht bewusst, dass es einen zweiten Teil geben würde ;-)
Die Fragen bezogen sich im Grunde genommen auf ein einziges Problem:
Wie finde ich die Stellen im Raum, an denen ich Absorber anbringen soll?
Genau diese Frage stelle ich mir auch, hatte aber leider irgendwie beim Durchstöbern zahlreicher Beiträge im Web keine befriedigende Antwort bekommen. Ich habe dann versucht, das angelesene Wissen mit eigenen Versuchen & Erfahrungen zu kombinieren.
Hier nun meine Erkenntnisse, vielleicht helfen sie dem einen oder anderen:
1. Raum vor der Optimierung genau anhören
Hört sich vielleicht blöd an, ist aber eine unbedingt notwendige erste Bestandsaufnahme. Die Töne, die man am Hörplatz hört, entstehen ja nicht nur dadurch, dass von den Lautsprechern etwas abgegeben wird, was dann irgendwann auf die Ohren trifft.
Bis es soweit ist, hat die Akustik des Raums die von den Lautsprechern ausgegebenen Signale schon mehr oder weniger stark beeinflusst. Ziel ist es nun, die Quellen dieser Beeinflussungen zu finden und evtl. abzuschwächen.
Also: geht mit eurer Frau oder einem Kumpel in den Kinoraum und führt eine Unterhaltung. Ganz normal, nicht schreien, nicht flüstern, einfach nur ganz normal unterhalten.
Wie hört sich das an? Könnt ihr euch gegenseitig gut verstehen? Verändert den Abstand voneinander und hört wieder genau hin. Hört ihr NUR den Gesprächspartner oder hört sich die Stimme irgendwie an wie aus dem Karton? Macht die Augen zu und versucht, die Position des anderen genau zu lokalisieren.
All das gibt euch schon einmal einen ersten Anhaltspunkt über die akustische Beschaffenheit des Raums.
2. Wo aber kommen denn nun die Absorber genau hin?
Stellt euch vor die Front-Lautsprecher (also LCR) haltet eine Hand in die Nähe der Lautsprecher (am besten davor) und schnippst mit den Fingern. Ihr hört nun das Schnippsen selbst und aller Wahrscheinlichkeit nach in einem unbehandelten Raum einen Nachhall, der aus dem hinteren Bereich des Raums zu euch zurückgeworfen wird. Bei mir kam diese Reflexion genau aus den Ecken.
Dies wiederholt ihr vor jedem der Frontlautsprecher und merkt euch oder markiert die Stellen, von denen die Reflexionen zu kommen scheinen.
Stellt oder hängt dann an diese Stellen erst einmal provisorisch jeweils einen Absorber und wiederholt das Schnippsen. Ich bin mir sicher, dass sich das Schnippsen jetzt schon viel präziser anhört, ihr hört nun überwiegend nur noch den Schall, der von euren Fingern erzeugt wird.
Bei mir hat schon ein Absorber an der Rückwand eine hörbare Verbesserung gebracht, das hätte ich nicht gedacht. Man kann den positiven Effekt quasi ein- und ausschalten, wenn man den Absorber wieder abhängt.
3. Ok, jetzt habe ich die Rückwand optimiert. Wie sieht's denn nun vorne aus?
Hier habe ich auf einen Artikel aus der Sound & Vision zurückgegriffen. Dieser empfahl, hinter jeden der Frontlautsprecher in Höhe der Hoch- und Mitteltöner jeweils einen Absorber anzubringen, um so die Reflexionen zu dämpfen, die dadurch entstehen, dass Töne eines Lautsprechers auch von der Wand hinter ihm reflektiert werden.
4. Aber ich will den Raum ja nicht überdämpfen? Wann merke ich, dass genug Absorber installiert sind?
Aus genau diesem Grund habe ich die Seitenwände und Teile der Decke meines Raums unbehandelt gelassen. Auf diese Weise wirkt der Raum nicht akustisch tot und es gibt immer noch genug reflektierende Flächen.
Generell sollte man immer einen Absorber nach dem anderen anbringen und dann immer wieder die unter 1. und 2. genannten Tests machen.
5. Schnippsen und Quatschen ist ja schön und gut, aber mit welchem Musik- oder Filmaterial teste ich das Ergebnis bzw. Zwischenergebnis denn am besten?
Das ist sicherlich eine Geschmacksfrage. Ich habe aber für mich herausgefunden, dass es Sinn macht, sich erst einmal auf die Hauptlautsprecher zu konzentrieren. Am AV-Receiver oder an der Vorstufe also erst einmal STEREO einstellen. Als Musikbeispiele haben sich bei mir Aufnahmen großer Orchester als ideal herausgestellt. Da ich nicht sooo der Klassikfan bin, habe ich mich auf das Antesten mit Film-Soundtracks konzentriert, die von großen Orchestern eingespielt wurden. Es gibt viele gute CDs vom Label Telarc von Dirigent Erich Kunzel (einfach mal bei Amazon schauen), die für diesen Zweck sehr gut geeignet sind.
Von denen sucht man sich dann ein Stück aus, mit dem man sich durch wiederholtes Anhören vertraut macht.
Mir ist bei diesen Tests dann aufgefallen, wie viel Räumlichkeit doch in einer Stereo-Aufnahme stecken kann. Mit den Absorbern hatte es auf einmal den Anschein, dass ich die Akustik des Aufnahmeortes höre und dass die Akustik meines Kellers in den Hintergrund rückt. Die Positionen einzelner Instrumente sind sehr gut auszumachen, man kann quasi, wenn man die Augen zumacht, mit dem Finger auf eine virtuelle Stelle im Raum zeigen.
Ich habe die Absorber dann noch einmal entfernt, um noch mal einen Test ohne Optimierung zu machen. Ergebnis: verwaschenes Klangbild, keine Lokalisierung (bzw. nur sehr schwer) möglich.
Generell würde ich auch empfehlen, während der Optimierung NUR mit Tonmaterial und nicht mit Filmen zu testen. So konzentriert man sich NUR auf den Klang und wird nicht vom BIld abgelenkt. Wenn man dann mit dem Sound basierend auf Musikmaterial zufrieden ist, dann ist das Ergebnis beim ersten Filmtest auf keinen Fall schlechter ;-) Ganz im Gegenteil, ihr werdet überaus positiv überrascht sein.
So, das wars erst einmal für heute :-) Vielen Dank an alle, die sich bis zum Ende des Artikels durchgekämpft haben!
Wenn es die Zeit erlaubt, werde ich demnächst einmal auf ein paar Probleme bei der Aufstellung des Subwoofers eingehen.
Viele Grüße und einen schönen Rest-Sonntag
Markus
Aufgrund einiger Anfragen nehme ich heute noch mal das Thema "Optimierung der Raumakustik" auf. Mir war beim letzten Eintrag zu diesem Thema gar nicht bewusst, dass es einen zweiten Teil geben würde ;-)
Die Fragen bezogen sich im Grunde genommen auf ein einziges Problem:
Wie finde ich die Stellen im Raum, an denen ich Absorber anbringen soll?
Genau diese Frage stelle ich mir auch, hatte aber leider irgendwie beim Durchstöbern zahlreicher Beiträge im Web keine befriedigende Antwort bekommen. Ich habe dann versucht, das angelesene Wissen mit eigenen Versuchen & Erfahrungen zu kombinieren.
Hier nun meine Erkenntnisse, vielleicht helfen sie dem einen oder anderen:
1. Raum vor der Optimierung genau anhören
Hört sich vielleicht blöd an, ist aber eine unbedingt notwendige erste Bestandsaufnahme. Die Töne, die man am Hörplatz hört, entstehen ja nicht nur dadurch, dass von den Lautsprechern etwas abgegeben wird, was dann irgendwann auf die Ohren trifft.
Bis es soweit ist, hat die Akustik des Raums die von den Lautsprechern ausgegebenen Signale schon mehr oder weniger stark beeinflusst. Ziel ist es nun, die Quellen dieser Beeinflussungen zu finden und evtl. abzuschwächen.
Also: geht mit eurer Frau oder einem Kumpel in den Kinoraum und führt eine Unterhaltung. Ganz normal, nicht schreien, nicht flüstern, einfach nur ganz normal unterhalten.
Wie hört sich das an? Könnt ihr euch gegenseitig gut verstehen? Verändert den Abstand voneinander und hört wieder genau hin. Hört ihr NUR den Gesprächspartner oder hört sich die Stimme irgendwie an wie aus dem Karton? Macht die Augen zu und versucht, die Position des anderen genau zu lokalisieren.
All das gibt euch schon einmal einen ersten Anhaltspunkt über die akustische Beschaffenheit des Raums.
2. Wo aber kommen denn nun die Absorber genau hin?
Stellt euch vor die Front-Lautsprecher (also LCR) haltet eine Hand in die Nähe der Lautsprecher (am besten davor) und schnippst mit den Fingern. Ihr hört nun das Schnippsen selbst und aller Wahrscheinlichkeit nach in einem unbehandelten Raum einen Nachhall, der aus dem hinteren Bereich des Raums zu euch zurückgeworfen wird. Bei mir kam diese Reflexion genau aus den Ecken.
Dies wiederholt ihr vor jedem der Frontlautsprecher und merkt euch oder markiert die Stellen, von denen die Reflexionen zu kommen scheinen.
Stellt oder hängt dann an diese Stellen erst einmal provisorisch jeweils einen Absorber und wiederholt das Schnippsen. Ich bin mir sicher, dass sich das Schnippsen jetzt schon viel präziser anhört, ihr hört nun überwiegend nur noch den Schall, der von euren Fingern erzeugt wird.
Bei mir hat schon ein Absorber an der Rückwand eine hörbare Verbesserung gebracht, das hätte ich nicht gedacht. Man kann den positiven Effekt quasi ein- und ausschalten, wenn man den Absorber wieder abhängt.
3. Ok, jetzt habe ich die Rückwand optimiert. Wie sieht's denn nun vorne aus?
Hier habe ich auf einen Artikel aus der Sound & Vision zurückgegriffen. Dieser empfahl, hinter jeden der Frontlautsprecher in Höhe der Hoch- und Mitteltöner jeweils einen Absorber anzubringen, um so die Reflexionen zu dämpfen, die dadurch entstehen, dass Töne eines Lautsprechers auch von der Wand hinter ihm reflektiert werden.
4. Aber ich will den Raum ja nicht überdämpfen? Wann merke ich, dass genug Absorber installiert sind?
Aus genau diesem Grund habe ich die Seitenwände und Teile der Decke meines Raums unbehandelt gelassen. Auf diese Weise wirkt der Raum nicht akustisch tot und es gibt immer noch genug reflektierende Flächen.
Generell sollte man immer einen Absorber nach dem anderen anbringen und dann immer wieder die unter 1. und 2. genannten Tests machen.
5. Schnippsen und Quatschen ist ja schön und gut, aber mit welchem Musik- oder Filmaterial teste ich das Ergebnis bzw. Zwischenergebnis denn am besten?
Das ist sicherlich eine Geschmacksfrage. Ich habe aber für mich herausgefunden, dass es Sinn macht, sich erst einmal auf die Hauptlautsprecher zu konzentrieren. Am AV-Receiver oder an der Vorstufe also erst einmal STEREO einstellen. Als Musikbeispiele haben sich bei mir Aufnahmen großer Orchester als ideal herausgestellt. Da ich nicht sooo der Klassikfan bin, habe ich mich auf das Antesten mit Film-Soundtracks konzentriert, die von großen Orchestern eingespielt wurden. Es gibt viele gute CDs vom Label Telarc von Dirigent Erich Kunzel (einfach mal bei Amazon schauen), die für diesen Zweck sehr gut geeignet sind.
Von denen sucht man sich dann ein Stück aus, mit dem man sich durch wiederholtes Anhören vertraut macht.
Mir ist bei diesen Tests dann aufgefallen, wie viel Räumlichkeit doch in einer Stereo-Aufnahme stecken kann. Mit den Absorbern hatte es auf einmal den Anschein, dass ich die Akustik des Aufnahmeortes höre und dass die Akustik meines Kellers in den Hintergrund rückt. Die Positionen einzelner Instrumente sind sehr gut auszumachen, man kann quasi, wenn man die Augen zumacht, mit dem Finger auf eine virtuelle Stelle im Raum zeigen.
Ich habe die Absorber dann noch einmal entfernt, um noch mal einen Test ohne Optimierung zu machen. Ergebnis: verwaschenes Klangbild, keine Lokalisierung (bzw. nur sehr schwer) möglich.
Generell würde ich auch empfehlen, während der Optimierung NUR mit Tonmaterial und nicht mit Filmen zu testen. So konzentriert man sich NUR auf den Klang und wird nicht vom BIld abgelenkt. Wenn man dann mit dem Sound basierend auf Musikmaterial zufrieden ist, dann ist das Ergebnis beim ersten Filmtest auf keinen Fall schlechter ;-) Ganz im Gegenteil, ihr werdet überaus positiv überrascht sein.
So, das wars erst einmal für heute :-) Vielen Dank an alle, die sich bis zum Ende des Artikels durchgekämpft haben!
Wenn es die Zeit erlaubt, werde ich demnächst einmal auf ein paar Probleme bei der Aufstellung des Subwoofers eingehen.
Viele Grüße und einen schönen Rest-Sonntag
Markus
Wohin mit den ganzen Filmen? - Dacal CD-Library II
28. November 2010Hallo zusammen,
nachdem wir ja im Mai in unsere neues Eigenheim von Oberhausen nach Krefeld gezogen sind, stellte sich relativ schnell eine Frage:
Wo bringt man fast 800 DVDs und Blu-rays unter, wenn man von einem Haus mit 140qm Nutzfläche in eines mit "nur" 100qm zieht?
Klar, man trennt sich bei einem solchen Umzug natürlich von dem einen oder anderen (vermeintlich) unnützen Gegenstand, aber irgendwie hat man dann doch zu wenig Platz.
Bei mir waren es also nun die seit 1997 gesammelten Filme, die einen nicht unbeträchtlichen Raum in Regalen und Schränken in Anspruch genommen haben. Was also tun? Der Kinoraum war von ehemals 35qm auf nun noch 20qm geschrumpft. Da war also schon mal kein Platz mehr für eine klassische Aufbewahrung. Na ja, und im Rest des Hauses irgendwie auch nicht. Abgesehen davon will man ja nicht durchs ganze Haus laufen, um irgendwo die Filme herzuholen, die man dann im Keller schauen möchte.
Durch Zufall bin ich dann auf ein Gerät aufmerksam geworden, dass sich Dacal CD-Library II nennt.
Die CD-Library II ist eine Box, in deren Inneren sich ein Karussell befindet, dass 150 Scheiben (also DVDs, CDs, Blu-rays) aufnehmen kann.

Wie funktioniert das nun? Ganz einfach!
Erst einmal muss man sich von dem Wunsch verabschieden, alle Filme in ihren Boxen zu lagern. Es hat mich einiges an Überwindung gekostet, aber ich habe tatsächlich letztendlich sämtliche Boxen in die Gelbe Tonne geworfen.
Jede eingelegte Scheibe kommt dann in einen eigenen Slot des Karussells, wobei die Slots durchnummeriert sind von 1 bis 150.
Man kann natürlich ein Blatt Papier in die Hand nehmen und für jeden Film den Slot aufschreiben, in dem die jeweilige DVD drin steckt. Um dann wieder an den Film ranzukommen wenn er einmal im Karussell steckt, gibt man auf der Zehnertastatur der CD-Library einfach die entsprechende Slot-Nummer ein und drückt auf OK. Das Karussell wird dann automatisch an die richtige Stelle gedreht und die Scheibe wird motorisiert ausgeworfen. Einfach rausnehmen, in den DVD- oder Blu-ray-Player legen und dann nach Anschauen wieder in die CD-Library packen (nach dem Herausnehmen schließt sich die CD-Library automatisch. Wenn man den Film dann wieder ins Karussell legen möchte, dann drückt man einfach noch einmal auf OK, woraufhin sich der Slot an der Front der CD-Library wieder öffnet und man die Scheibe wieder einlegen kann).
Wenn man aber nun schon so eine tolles Gerät hat, dann möchte man natürlich nicht auch noch seine Filme per Hand auf einem Blatt Papier verwalten. Hier kommen dann die USB-Anschlüsse der CD-Library ins Spiel.
Schließt man das Gerät nämlich per USB an einen PC, dann kann man die CD-Library mit der Software Movie Collector steuern. Man fügt dann über die Software eine neue DVD zu seiner Bibliothek hinzu und die Software teilt dem Film dann automatisch einen freien Slot der CD-Library zu. Das Karussell dreht sich, öffnet sich und man legt den Film ein. Möchte man den Film dann irgendwann schauen, dann gibt man im Suchfeld von Movie Collector einfach z.B. "Star Wars" ein. Daraufhin erhält man als Suchergebnis alle Star Wars Filme der eigenen Bibliothek und ein Doppelklick auf "Episode IV" lässt die CD-Library dann automatisch den gewünschten Teil der alten SW-Trilogie auswerfen.
So weit so gut. Aber ich hatte ja zuvor von USB-AnschlüsseN geschrieben. Man kann nun wenn man möchte bis zu 127 CD-Libraries miteinander verbinden. Wenn man nur eine CD-Library im Einsatz hat, dann weiß Movie Collector, dass die Slots 1 bis 150 zur Verfügung stehen. Wenn man aber 2 CD-Libraries zusammenschließt, dann erhält man Slot 1 bis 300 usw. Die Software steuert dann je nach Film, den man sucht, genau die richtige CD-Library an.
Um unseren ganzen Filmen in normalen Amaray-Boxen Herr zu werden, habe ich mir letztendlich nun 4 Dacal CD-Libraries gekauft. 2 stehen jeweils links und rechts von unsere zweiten Sitzreihe in Hifi-Regalen und werden dann per PC gesteuert. Super praktisch und super einfach!
EIne Dacal CD-Library II ist mit einem Preis von € 80 nicht ganz billig, aber mein Platzproblem konnte ich auf elegante Art und Weise lösen. Selbst meine Frau ist begeistert :-) Die ganzen Collector's Editions stehen natürlich weiterhin in Regal und Vitrine.
Viele Grüße
Markus
nachdem wir ja im Mai in unsere neues Eigenheim von Oberhausen nach Krefeld gezogen sind, stellte sich relativ schnell eine Frage:
Wo bringt man fast 800 DVDs und Blu-rays unter, wenn man von einem Haus mit 140qm Nutzfläche in eines mit "nur" 100qm zieht?
Klar, man trennt sich bei einem solchen Umzug natürlich von dem einen oder anderen (vermeintlich) unnützen Gegenstand, aber irgendwie hat man dann doch zu wenig Platz.
Bei mir waren es also nun die seit 1997 gesammelten Filme, die einen nicht unbeträchtlichen Raum in Regalen und Schränken in Anspruch genommen haben. Was also tun? Der Kinoraum war von ehemals 35qm auf nun noch 20qm geschrumpft. Da war also schon mal kein Platz mehr für eine klassische Aufbewahrung. Na ja, und im Rest des Hauses irgendwie auch nicht. Abgesehen davon will man ja nicht durchs ganze Haus laufen, um irgendwo die Filme herzuholen, die man dann im Keller schauen möchte.
Durch Zufall bin ich dann auf ein Gerät aufmerksam geworden, dass sich Dacal CD-Library II nennt.
Die CD-Library II ist eine Box, in deren Inneren sich ein Karussell befindet, dass 150 Scheiben (also DVDs, CDs, Blu-rays) aufnehmen kann.

Wie funktioniert das nun? Ganz einfach!
Erst einmal muss man sich von dem Wunsch verabschieden, alle Filme in ihren Boxen zu lagern. Es hat mich einiges an Überwindung gekostet, aber ich habe tatsächlich letztendlich sämtliche Boxen in die Gelbe Tonne geworfen.
Jede eingelegte Scheibe kommt dann in einen eigenen Slot des Karussells, wobei die Slots durchnummeriert sind von 1 bis 150.
Man kann natürlich ein Blatt Papier in die Hand nehmen und für jeden Film den Slot aufschreiben, in dem die jeweilige DVD drin steckt. Um dann wieder an den Film ranzukommen wenn er einmal im Karussell steckt, gibt man auf der Zehnertastatur der CD-Library einfach die entsprechende Slot-Nummer ein und drückt auf OK. Das Karussell wird dann automatisch an die richtige Stelle gedreht und die Scheibe wird motorisiert ausgeworfen. Einfach rausnehmen, in den DVD- oder Blu-ray-Player legen und dann nach Anschauen wieder in die CD-Library packen (nach dem Herausnehmen schließt sich die CD-Library automatisch. Wenn man den Film dann wieder ins Karussell legen möchte, dann drückt man einfach noch einmal auf OK, woraufhin sich der Slot an der Front der CD-Library wieder öffnet und man die Scheibe wieder einlegen kann).
Wenn man aber nun schon so eine tolles Gerät hat, dann möchte man natürlich nicht auch noch seine Filme per Hand auf einem Blatt Papier verwalten. Hier kommen dann die USB-Anschlüsse der CD-Library ins Spiel.
Schließt man das Gerät nämlich per USB an einen PC, dann kann man die CD-Library mit der Software Movie Collector steuern. Man fügt dann über die Software eine neue DVD zu seiner Bibliothek hinzu und die Software teilt dem Film dann automatisch einen freien Slot der CD-Library zu. Das Karussell dreht sich, öffnet sich und man legt den Film ein. Möchte man den Film dann irgendwann schauen, dann gibt man im Suchfeld von Movie Collector einfach z.B. "Star Wars" ein. Daraufhin erhält man als Suchergebnis alle Star Wars Filme der eigenen Bibliothek und ein Doppelklick auf "Episode IV" lässt die CD-Library dann automatisch den gewünschten Teil der alten SW-Trilogie auswerfen.
So weit so gut. Aber ich hatte ja zuvor von USB-AnschlüsseN geschrieben. Man kann nun wenn man möchte bis zu 127 CD-Libraries miteinander verbinden. Wenn man nur eine CD-Library im Einsatz hat, dann weiß Movie Collector, dass die Slots 1 bis 150 zur Verfügung stehen. Wenn man aber 2 CD-Libraries zusammenschließt, dann erhält man Slot 1 bis 300 usw. Die Software steuert dann je nach Film, den man sucht, genau die richtige CD-Library an.
Um unseren ganzen Filmen in normalen Amaray-Boxen Herr zu werden, habe ich mir letztendlich nun 4 Dacal CD-Libraries gekauft. 2 stehen jeweils links und rechts von unsere zweiten Sitzreihe in Hifi-Regalen und werden dann per PC gesteuert. Super praktisch und super einfach!
EIne Dacal CD-Library II ist mit einem Preis von € 80 nicht ganz billig, aber mein Platzproblem konnte ich auf elegante Art und Weise lösen. Selbst meine Frau ist begeistert :-) Die ganzen Collector's Editions stehen natürlich weiterhin in Regal und Vitrine.
Viele Grüße
Markus
So langsam wird das neue Kino fertig
27. November 2010Hallo zusammen,
nachdem ich ja bereits im Mai erste Schritte in unserem zukünftigen Kinoraum unternommen hatte (streichen, Podest bauen, Teppich verlegen, Elektroinstallation), sieht es nun tatsächlich so aus, als ob wir Ende diesen Jahres wieder einen "richtigen" Kinoraum haben werden. Ich freue mich :-)
Für alle, die es interessiert habe ich daher heute im Bilderbereich unter "Heimkino" die aktuellsten Fotos hochgeladen. Die Bilder vom alten Kino habe ich gelöscht.
Es müssen nun noch ein paar Kleinigkeiten gemacht werden, aber an sich läuft schon alles und zwar sogar überwiegend so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Folgende Hauptpunkte hatte ich mir auf die Wunschliste gesetzt:
- Steuerung der kompletten Anlage inkl. Licht per Z-Wave-Funk => ERLEDIGT
- Hauptsitzplatz in der Mitte des Raumes => NICHT ERLEDIGT, weil der Subwoofer sich da überhaupt nicht gut angehört hat, ganz egal, wo ich ihn hingestellt habe
- Platzsparende Aufbewahrung unserer Filme => ERLEDIGT (mit 4x Dacal CD-Library II)
- Akustische Optimierung des Raumes => ERLEDIGT
- Vom Sitzplatz aus unsichtbare Aufstellung der Elektronik => ERLEDIGT
Ich würde also sagen: Mission erfolgreich abgeschlossen :-) Zumindest halbwegs.
In diesem Sinne viele Grüße und ein schönes Restwochenende
Markus
nachdem ich ja bereits im Mai erste Schritte in unserem zukünftigen Kinoraum unternommen hatte (streichen, Podest bauen, Teppich verlegen, Elektroinstallation), sieht es nun tatsächlich so aus, als ob wir Ende diesen Jahres wieder einen "richtigen" Kinoraum haben werden. Ich freue mich :-)
Für alle, die es interessiert habe ich daher heute im Bilderbereich unter "Heimkino" die aktuellsten Fotos hochgeladen. Die Bilder vom alten Kino habe ich gelöscht.
Es müssen nun noch ein paar Kleinigkeiten gemacht werden, aber an sich läuft schon alles und zwar sogar überwiegend so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Folgende Hauptpunkte hatte ich mir auf die Wunschliste gesetzt:
- Steuerung der kompletten Anlage inkl. Licht per Z-Wave-Funk => ERLEDIGT
- Hauptsitzplatz in der Mitte des Raumes => NICHT ERLEDIGT, weil der Subwoofer sich da überhaupt nicht gut angehört hat, ganz egal, wo ich ihn hingestellt habe
- Platzsparende Aufbewahrung unserer Filme => ERLEDIGT (mit 4x Dacal CD-Library II)
- Akustische Optimierung des Raumes => ERLEDIGT
- Vom Sitzplatz aus unsichtbare Aufstellung der Elektronik => ERLEDIGT
Ich würde also sagen: Mission erfolgreich abgeschlossen :-) Zumindest halbwegs.
In diesem Sinne viele Grüße und ein schönes Restwochenende
Markus
Gar nicht so schwer: Optimierung der Raumakustik
18. November 2010Hallo zusammen,
ich möchte euch heute gerne ein wenig darüber erzählen, wie ich die Akustik im neuen Kinokeller mit wenig Aufwand deutlich verbessern konnte.
Unser Kinokeller misst 3,3m x 4,9m, wobei im vorderen Bereich noch eine Nische von 1m x 1,9m vorhanden ist. Der Raum ist also leicht L-förmig.
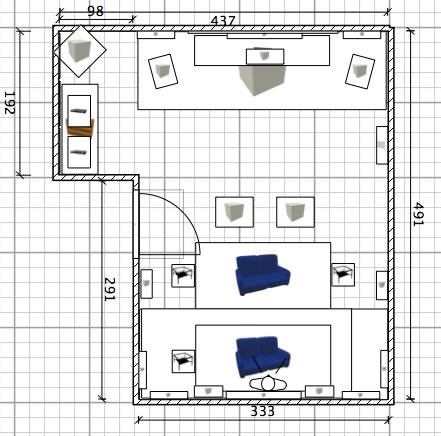
Nach einem Ton-Test im unbehandelten Raum, der nur mit relativ hochflorigem Teppich, dem Podet und den beiden Sofas ausgestattet war, stellte sich schnell heraus, dass der Raum eine sehr lange Nachhallzeit hatte und Flatterechos zu hören waren. Stellte man sich z.B. in die vordere Raumhälfte und schnipste mit den Fingern, dann konnte man quasi noch ewig den Nachhall, der in der hinteren Raumhälfte erzeugt wurde, hören.

Auch beim Test mit Filmmaterial zeigte sich ein unbefriedigendes Bild. Stimmen aus dem Center waren unpräzise und nicht "auf den Punkt". Es fehlte generell eine klar definierte Abbildung der akustischen Geschehnisse.
Ich hatte mich in den letzten Monaten recht ausführlich mit dem Thema "Optimierung der Raumakustik" beschäftigt. Dabei fiel mir zuallererst auch auf, dass es unterschiedliche Auffassung darüber gab, wie man einen Raum am besten behandeln sollte. Die einen schrieben, dass man die Seitenwände behandeln soll, die anderen rieten davon ab.
Ich stolperte dann mehr durch Zufall über einen Artikel im amerikanischen Magazin "Sound & Vision" (kann ich übrigens nur empfehlen). Darin wurde geraten, generell die Vorder- und Rückwand zu behandeln. Konkret wurde empfohlen, hinter jeden Lautsprecher im vorderen Bereich (also hinter L,C und R) auf jeden Fall schon einmal einen Breitbandabsorber zu installieren. Im hinteren Bereich solle man sich dann mit Hörtests Schritt für Schritt an ein persönlich gutes Ergebnis herantasten.

Gesagt, getan! Ich installierte also hinter jedem der Frontlautsprecher Akustikschaumstoffmatten von Aixfoam. Die Matten sind 100cm x 50cm x 10cm groß und im Original anthrazitfarben. Sie wurden auf ein Lattenrost geklebt und dann wie Bilder an die Wand gehangen.
Danach installierte ich im hinteren Bereich erst 2 Absorber rechts und links an der Rückwand.

Erste Tests mit Filmmaterial zeigten dann schon beeindruckende Ergebnisse:
Stimmen kamen nun ungemein präzise und wie festgenagelt aus dem Center. Auch im Stereobetrieb war eine große Verbesserung der räumlichen Darstellung zu hören. Es hatte den Anschein, dass man auf einmal viel mehr von der eigentlichen Akustik der Aufnahme hörte. Die akustischen Eigenschaften unseres Keller traten in den Hintergrund und ich war ganz erstaunt, wie viel Räumlichkeit in so mancher Orchesteraufnahme stecken kann.
Da ich aus den hinteren Raumecken immer noch leichte Flatterechos hören konnte, wurde die oben gezeigte Eckenanordnung von jeweils 2 Absorbern pro Seite gewählt, die dieses letzte Problem auch noch lösten.
Dass sich die Akustik im Raum nun überaus positiv verändert hat, hört man schon, wenn man sich einfach nur unterhält. Die Stimmenverständlichkeit ist extrem hoch, trotzdem ist der Raum nicht akustisch tot, was gerade bei den von mir eingesetzten Dipol-Lautsprechern als Surrounds und Back-Surrounds wichtig ist.
Ich bin insgesamt mit dem Ergebnis dieser unkomplizierten Optimierung mehr als zufrieden. Der finanzielle Aufwand für die Absorber lag bei ca. € 200 und ich denke, das ist ein geringer Preis für die erzielten Verbesserungen.
Mein Rat: bevor man immer mehr Geld in besseres Equipment steckt, sollte man erst mit einfachen Mitteln versuchen, die Raumakustik zu verbessern. Das positive Ergebnis sollte offensichtlicher sein, als z.B. ein neuer Receiver im unbehandelten Raum.
Viele Grüße
Markus
ich möchte euch heute gerne ein wenig darüber erzählen, wie ich die Akustik im neuen Kinokeller mit wenig Aufwand deutlich verbessern konnte.
Unser Kinokeller misst 3,3m x 4,9m, wobei im vorderen Bereich noch eine Nische von 1m x 1,9m vorhanden ist. Der Raum ist also leicht L-förmig.
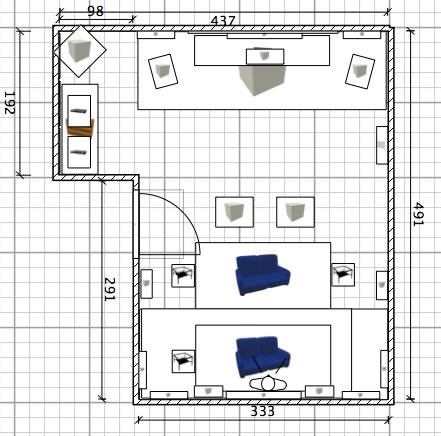
Nach einem Ton-Test im unbehandelten Raum, der nur mit relativ hochflorigem Teppich, dem Podet und den beiden Sofas ausgestattet war, stellte sich schnell heraus, dass der Raum eine sehr lange Nachhallzeit hatte und Flatterechos zu hören waren. Stellte man sich z.B. in die vordere Raumhälfte und schnipste mit den Fingern, dann konnte man quasi noch ewig den Nachhall, der in der hinteren Raumhälfte erzeugt wurde, hören.

Auch beim Test mit Filmmaterial zeigte sich ein unbefriedigendes Bild. Stimmen aus dem Center waren unpräzise und nicht "auf den Punkt". Es fehlte generell eine klar definierte Abbildung der akustischen Geschehnisse.
Ich hatte mich in den letzten Monaten recht ausführlich mit dem Thema "Optimierung der Raumakustik" beschäftigt. Dabei fiel mir zuallererst auch auf, dass es unterschiedliche Auffassung darüber gab, wie man einen Raum am besten behandeln sollte. Die einen schrieben, dass man die Seitenwände behandeln soll, die anderen rieten davon ab.
Ich stolperte dann mehr durch Zufall über einen Artikel im amerikanischen Magazin "Sound & Vision" (kann ich übrigens nur empfehlen). Darin wurde geraten, generell die Vorder- und Rückwand zu behandeln. Konkret wurde empfohlen, hinter jeden Lautsprecher im vorderen Bereich (also hinter L,C und R) auf jeden Fall schon einmal einen Breitbandabsorber zu installieren. Im hinteren Bereich solle man sich dann mit Hörtests Schritt für Schritt an ein persönlich gutes Ergebnis herantasten.

Gesagt, getan! Ich installierte also hinter jedem der Frontlautsprecher Akustikschaumstoffmatten von Aixfoam. Die Matten sind 100cm x 50cm x 10cm groß und im Original anthrazitfarben. Sie wurden auf ein Lattenrost geklebt und dann wie Bilder an die Wand gehangen.
Danach installierte ich im hinteren Bereich erst 2 Absorber rechts und links an der Rückwand.

Erste Tests mit Filmmaterial zeigten dann schon beeindruckende Ergebnisse:
Stimmen kamen nun ungemein präzise und wie festgenagelt aus dem Center. Auch im Stereobetrieb war eine große Verbesserung der räumlichen Darstellung zu hören. Es hatte den Anschein, dass man auf einmal viel mehr von der eigentlichen Akustik der Aufnahme hörte. Die akustischen Eigenschaften unseres Keller traten in den Hintergrund und ich war ganz erstaunt, wie viel Räumlichkeit in so mancher Orchesteraufnahme stecken kann.
Da ich aus den hinteren Raumecken immer noch leichte Flatterechos hören konnte, wurde die oben gezeigte Eckenanordnung von jeweils 2 Absorbern pro Seite gewählt, die dieses letzte Problem auch noch lösten.
Dass sich die Akustik im Raum nun überaus positiv verändert hat, hört man schon, wenn man sich einfach nur unterhält. Die Stimmenverständlichkeit ist extrem hoch, trotzdem ist der Raum nicht akustisch tot, was gerade bei den von mir eingesetzten Dipol-Lautsprechern als Surrounds und Back-Surrounds wichtig ist.
Ich bin insgesamt mit dem Ergebnis dieser unkomplizierten Optimierung mehr als zufrieden. Der finanzielle Aufwand für die Absorber lag bei ca. € 200 und ich denke, das ist ein geringer Preis für die erzielten Verbesserungen.
Mein Rat: bevor man immer mehr Geld in besseres Equipment steckt, sollte man erst mit einfachen Mitteln versuchen, die Raumakustik zu verbessern. Das positive Ergebnis sollte offensichtlicher sein, als z.B. ein neuer Receiver im unbehandelten Raum.
Viele Grüße
Markus
Fernbedienung mit Z-Wave: Nevo Q50
14. November 2010Guten Morgen zusammen,
es ist mal wieder soweit (und ich hoffe, dass es diesmal endgültig ist):
Ich habe mir eine neue Universal-Fernbedienung gegönnt :)
Nachdem ich schon lange mit einer geliebäugelt habe, fiel die Wahl nun endlich auf ein Modell der Markt Nevo. Die Nevos werden normalerweise komplett programmiert nur von entsprechenden Händlern an die Kunden ausgeliefert, es geht also an sich nicht nur um die reine Hardware, sondern auch um die Programmierung, die Teil des Pakets ist.
Wie man im Bild unten sehen kann, bietet die Nevo eine Kombination aus Touchscreen und festen Tasten, was ich persönlich als sehr angenehm empfinde, gerade auch, wenn die Laufwerksfunktionen im Dunklen durch "Ertasten" gefunden werden sollen.
 Da ich in der Vergangenheit nun bereits einige Erfahrungen mit der Programmierung sämtlicher auf dem Markt erhältlicher FBs sammeln konnte, habe ich auf die Händler-Option verzichtet und habe mich selbst daran gemacht, die Nevo Q50 meinen Wünschen entsprechend einzurichten.
Da ich in der Vergangenheit nun bereits einige Erfahrungen mit der Programmierung sämtlicher auf dem Markt erhältlicher FBs sammeln konnte, habe ich auf die Händler-Option verzichtet und habe mich selbst daran gemacht, die Nevo Q50 meinen Wünschen entsprechend einzurichten.
Einer der Hauptgründe für die Entscheidung, eine Nevo zu kaufen war der, dass ich auch die komplette Lichtsteuerung in unserem Kinokeller mit nur einer Fernbedienung bewerkstelligen wollte. Außerdem möchte ich meine Geräte, die in einer Nische außerhalb der Sichtweite stehen, auch zuverlässig bedienen.
Dazu nutzt die Nevo Q50 die Z-Wave-Funktechnologie. Z-Wave-kompatible Schalter, Dimmer, Zwischenschalter gibt es mittlerweile so einige, daher hatte ich bei der Verkabelung des Kellers diese auch direkt mit installieren lassen.
Um dann noch die versteckten Geräte per Funk steuern zu können, gibt es eine Umwandlerbox namens Nevo Connect NC-50. Diese empfängt die Z-Wave-Funkbefehle der FB und wandelt diese dann entweder in Infrarot um oder gibt sie per aufklebbaren Infrarot-Augen, die auf den Infrarot-Empfängern von AV-Receiver & Co. installiert werden, weiter.
 Damit ist es dann möglich, wirklich den kompletten Raum mit einer FB zu steuern und sich dabei noch nicht einmal Gedanken darüber machen zu müssen, wie man die FB hält.
Damit ist es dann möglich, wirklich den kompletten Raum mit einer FB zu steuern und sich dabei noch nicht einmal Gedanken darüber machen zu müssen, wie man die FB hält.
Die Nevo wird mit der Programmier-Software Nevo Studio Pro 3 ausgeliefert und diese bietet wirklich fast schon unendliche Möglichkeiten, die Fernbedienung an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.
Das Gute ist, dass man sich nicht mit einem festen vorgegebenen Bedienkonzept anfreunden muss, sondern einfach seine eigene Benutzerführung aufbauen kann. Klar sollte man sich vorher ein paar Gedanken über die Bestandteile der eigenen Anlage machen und darüber, was man denn nun wie erreichen möchte.
Mir war es nun sehr wichtig, dass die drei Lichter, die ich im Raum verteilt habe (Decke, gedimmte Bühne und Podestkante) gut in einzelne Aktionen mit eingebunden werden können.
Was heißt das nun? Also, ich gehe in den Keller, um einen Film zu schauen. Ich schalte beim Reingehen per Wandschalter die vorgenannten Lichter an. Ich drücke auf der FB auf "Blu-ray schauen". Daraufhin werden erst einmal alle Geräte eingeschaltet, der BD-Eingang am Receiver angewählt und nachdem der BD-Player hochgefahren ist, die Schublade zum Einlegen eines Films ausgefahren. Dass der Player zum Hochfahren fast eine Minute braucht, trage ich in der Nevo-Software ein.
Mittlerweile sitzen unsere Gäste auf ihren Plätzen und ich habe den Film eingelegt. Die Nevo zeigt mittlerweile die Bildschirmseite für "Blu-ray schauen". Dort befindet sich auf dem Display auch eine Taste "Film starten". Bei Druck auf diese Taste geht die Schublade am BD-Player zu und die Lichter gehen aus (zuerst das hellere Deckenlicht, dann die Podestlichtleiste und anschließend werden noch die Spots der Bühne ausgedimmt).
Jetzt kann der Film beginnen.
Sollte man den Film einmal kurz unterbrechen müssen, um noch etwas aus der Küche zu holen oder das stille Örtchen aufsuchen zu müssen, dann drücke ich auf die Pause-Taste. Der Film wird unterbrochen, das Licht der Bühne dimmt hoch und die Fußleiste am Podest geht an, damit niemand stolpert. Wenn wieder alle im Raum sind, dann schaltet ein weiterer Druck auf "Pause" die Lichtleiste wieder ab, dimmt das Bühnenlicht herunter und setzt den Film fort.
Ich denke an diesem Beispiel kann man schon sehr gut erkennen, wie flexibel sich mit der Nevo viele Situation lösen lassen. Man kann zahlreiche Einstellungen auch unter Einbeziehung des Faktors "Zeit" programmieren. So werden z.B. nach dem Anschauen eines Films beim Druck auf die Taste "Anlage abschalten" sämtliche Geräte abgeschaltet und alle Lichter bis auf die Bühnenspots abgeschaltet. Man kann dann, während das Licht der Bühne noch leuchtet den Raum verlassen und das Licht der Bühne schaltet sich dann nach weiteren 3 Minuten ab.
Alle diese Möglichkeiten in Betracht ziehend würde ich sagen, dass die Nevo Q50 wirklich die erste meiner vielen FBs ist, die wirklich ALLES mit einem Gerät ermöglicht. Die Integration von Z-Wave ist ungemein wertvoll und stimmig, es können sogar Widgets erstellt werden, die auf der FB die Einschaltzustände einzelnen Lichter im Haus anzeigt. Da sämtliche Schalter auch untereinander vernetzt sind und quasi als Relaisstationen arbeiten, könnte man vom Keller aus z.B. auch das Licht im Schlafzimmer einschalten. Oder die Heizung steuern. Oder die Rollos im Wohnzimmer herunterfahren.
Fazit: Die Nevo ist kein billiger Spaß (Listenpreis ist EUR 549 für die Q50 und EUR 249 für den NC-50 Connect), zeigt aber eindrucksvoll, was in Sachen Heim-Automatisierung so möglich ist.
Sollte jemand Fragen zur Lichtsteuerung mit Z-Wave haben, dann meldet euch. Habe mich die letzten Monate SEHR intensiv damit beschäftigt.
Viele Grüße
Markus
es ist mal wieder soweit (und ich hoffe, dass es diesmal endgültig ist):
Ich habe mir eine neue Universal-Fernbedienung gegönnt :)
Nachdem ich schon lange mit einer geliebäugelt habe, fiel die Wahl nun endlich auf ein Modell der Markt Nevo. Die Nevos werden normalerweise komplett programmiert nur von entsprechenden Händlern an die Kunden ausgeliefert, es geht also an sich nicht nur um die reine Hardware, sondern auch um die Programmierung, die Teil des Pakets ist.
Wie man im Bild unten sehen kann, bietet die Nevo eine Kombination aus Touchscreen und festen Tasten, was ich persönlich als sehr angenehm empfinde, gerade auch, wenn die Laufwerksfunktionen im Dunklen durch "Ertasten" gefunden werden sollen.
 Da ich in der Vergangenheit nun bereits einige Erfahrungen mit der Programmierung sämtlicher auf dem Markt erhältlicher FBs sammeln konnte, habe ich auf die Händler-Option verzichtet und habe mich selbst daran gemacht, die Nevo Q50 meinen Wünschen entsprechend einzurichten.
Da ich in der Vergangenheit nun bereits einige Erfahrungen mit der Programmierung sämtlicher auf dem Markt erhältlicher FBs sammeln konnte, habe ich auf die Händler-Option verzichtet und habe mich selbst daran gemacht, die Nevo Q50 meinen Wünschen entsprechend einzurichten.Einer der Hauptgründe für die Entscheidung, eine Nevo zu kaufen war der, dass ich auch die komplette Lichtsteuerung in unserem Kinokeller mit nur einer Fernbedienung bewerkstelligen wollte. Außerdem möchte ich meine Geräte, die in einer Nische außerhalb der Sichtweite stehen, auch zuverlässig bedienen.
Dazu nutzt die Nevo Q50 die Z-Wave-Funktechnologie. Z-Wave-kompatible Schalter, Dimmer, Zwischenschalter gibt es mittlerweile so einige, daher hatte ich bei der Verkabelung des Kellers diese auch direkt mit installieren lassen.
Um dann noch die versteckten Geräte per Funk steuern zu können, gibt es eine Umwandlerbox namens Nevo Connect NC-50. Diese empfängt die Z-Wave-Funkbefehle der FB und wandelt diese dann entweder in Infrarot um oder gibt sie per aufklebbaren Infrarot-Augen, die auf den Infrarot-Empfängern von AV-Receiver & Co. installiert werden, weiter.
 Damit ist es dann möglich, wirklich den kompletten Raum mit einer FB zu steuern und sich dabei noch nicht einmal Gedanken darüber machen zu müssen, wie man die FB hält.
Damit ist es dann möglich, wirklich den kompletten Raum mit einer FB zu steuern und sich dabei noch nicht einmal Gedanken darüber machen zu müssen, wie man die FB hält.Die Nevo wird mit der Programmier-Software Nevo Studio Pro 3 ausgeliefert und diese bietet wirklich fast schon unendliche Möglichkeiten, die Fernbedienung an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.
Das Gute ist, dass man sich nicht mit einem festen vorgegebenen Bedienkonzept anfreunden muss, sondern einfach seine eigene Benutzerführung aufbauen kann. Klar sollte man sich vorher ein paar Gedanken über die Bestandteile der eigenen Anlage machen und darüber, was man denn nun wie erreichen möchte.
Mir war es nun sehr wichtig, dass die drei Lichter, die ich im Raum verteilt habe (Decke, gedimmte Bühne und Podestkante) gut in einzelne Aktionen mit eingebunden werden können.
Was heißt das nun? Also, ich gehe in den Keller, um einen Film zu schauen. Ich schalte beim Reingehen per Wandschalter die vorgenannten Lichter an. Ich drücke auf der FB auf "Blu-ray schauen". Daraufhin werden erst einmal alle Geräte eingeschaltet, der BD-Eingang am Receiver angewählt und nachdem der BD-Player hochgefahren ist, die Schublade zum Einlegen eines Films ausgefahren. Dass der Player zum Hochfahren fast eine Minute braucht, trage ich in der Nevo-Software ein.
Mittlerweile sitzen unsere Gäste auf ihren Plätzen und ich habe den Film eingelegt. Die Nevo zeigt mittlerweile die Bildschirmseite für "Blu-ray schauen". Dort befindet sich auf dem Display auch eine Taste "Film starten". Bei Druck auf diese Taste geht die Schublade am BD-Player zu und die Lichter gehen aus (zuerst das hellere Deckenlicht, dann die Podestlichtleiste und anschließend werden noch die Spots der Bühne ausgedimmt).
Jetzt kann der Film beginnen.
Sollte man den Film einmal kurz unterbrechen müssen, um noch etwas aus der Küche zu holen oder das stille Örtchen aufsuchen zu müssen, dann drücke ich auf die Pause-Taste. Der Film wird unterbrochen, das Licht der Bühne dimmt hoch und die Fußleiste am Podest geht an, damit niemand stolpert. Wenn wieder alle im Raum sind, dann schaltet ein weiterer Druck auf "Pause" die Lichtleiste wieder ab, dimmt das Bühnenlicht herunter und setzt den Film fort.
Ich denke an diesem Beispiel kann man schon sehr gut erkennen, wie flexibel sich mit der Nevo viele Situation lösen lassen. Man kann zahlreiche Einstellungen auch unter Einbeziehung des Faktors "Zeit" programmieren. So werden z.B. nach dem Anschauen eines Films beim Druck auf die Taste "Anlage abschalten" sämtliche Geräte abgeschaltet und alle Lichter bis auf die Bühnenspots abgeschaltet. Man kann dann, während das Licht der Bühne noch leuchtet den Raum verlassen und das Licht der Bühne schaltet sich dann nach weiteren 3 Minuten ab.
Alle diese Möglichkeiten in Betracht ziehend würde ich sagen, dass die Nevo Q50 wirklich die erste meiner vielen FBs ist, die wirklich ALLES mit einem Gerät ermöglicht. Die Integration von Z-Wave ist ungemein wertvoll und stimmig, es können sogar Widgets erstellt werden, die auf der FB die Einschaltzustände einzelnen Lichter im Haus anzeigt. Da sämtliche Schalter auch untereinander vernetzt sind und quasi als Relaisstationen arbeiten, könnte man vom Keller aus z.B. auch das Licht im Schlafzimmer einschalten. Oder die Heizung steuern. Oder die Rollos im Wohnzimmer herunterfahren.
Fazit: Die Nevo ist kein billiger Spaß (Listenpreis ist EUR 549 für die Q50 und EUR 249 für den NC-50 Connect), zeigt aber eindrucksvoll, was in Sachen Heim-Automatisierung so möglich ist.
Sollte jemand Fragen zur Lichtsteuerung mit Z-Wave haben, dann meldet euch. Habe mich die letzten Monate SEHR intensiv damit beschäftigt.
Viele Grüße
Markus
Neues Haus, neues Kino
24. April 2010Hallo zusammen,
endlich ist es soweit: am 14. Mai werden wir von Oberhausen nach Krefeld ziehen und damit ist auch mein Kino hier im "Pott" Geschichte.
Da wir uns größenmäßig nun von 140 qm Wohnfläche auf "nur" noch 100 qm verkleinern, wird es leider keinen Platz geben, um einen Raum als "Abstellkammer" für Umzugskartons, die irgendwann mal ausgeräumt werden, zu nutzen. Auch werden wir keinen Platz haben, um das alte Kino erst einmal zwischenzulagern.
Das bedeutet, dass ich den neuen Kino-Raum bis zum 14. Mai zumindest soweit schon mal fertig haben muss, damit die Sofas, der Podest. die Geräte etc. dort hingestellt und aufgebaut werden können. Insofern bin ich im Moment fleißig dabei, den Raum fertig zu machen. Wände mit Vorsatzschalen sind schon fertig, im Moment wird gestrichen, bald kommt der Elektriker, um neue Steckdosen inkl. eigener Sicherung zu verlegen.
Bilder folgen.
Bis dahin viele Grüße
Markus
endlich ist es soweit: am 14. Mai werden wir von Oberhausen nach Krefeld ziehen und damit ist auch mein Kino hier im "Pott" Geschichte.
Da wir uns größenmäßig nun von 140 qm Wohnfläche auf "nur" noch 100 qm verkleinern, wird es leider keinen Platz geben, um einen Raum als "Abstellkammer" für Umzugskartons, die irgendwann mal ausgeräumt werden, zu nutzen. Auch werden wir keinen Platz haben, um das alte Kino erst einmal zwischenzulagern.
Das bedeutet, dass ich den neuen Kino-Raum bis zum 14. Mai zumindest soweit schon mal fertig haben muss, damit die Sofas, der Podest. die Geräte etc. dort hingestellt und aufgebaut werden können. Insofern bin ich im Moment fleißig dabei, den Raum fertig zu machen. Wände mit Vorsatzschalen sind schon fertig, im Moment wird gestrichen, bald kommt der Elektriker, um neue Steckdosen inkl. eigener Sicherung zu verlegen.
Bilder folgen.
Bis dahin viele Grüße
Markus
Neues Kino in Sicht
7. Februar 2010Hallo zusammen,
nun scheint es sich zu bewahrheiten: ein neues Kino ist in Sicht :-)
Wir werden aller Voraussicht nach am kommenden Freitag ein Haus kaufen und dann im April umziehen. Dann heißt es Abschied nehmen vom augenblicklichen Kino.
Ich sehe die Situation mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Auf der einen Seite freut es mich natürlich, wieder ein Projekt komplett von vorne starten zu können und hier die Erfahrungen mit einfließen zu lassen, die ich beim "Bau" unseres jetzigen Kinos gewonnen habe.
Auf der anderen Seite tut es mir ein wenig leid, dem jetzigen Kino den Rücken zuzukehren. Wie ich ja bereits geschrieben hatte, war ich mittlerweile RICHTIG zufrieden mit Klang, Ausstattung und Optik, sodass es mich schon ein wenig ärgert, dass jetzt alles hinter mir zu lassen.
Da mir die Kombination aus Blau und Schwarz aber immer noch sehr gut gefällt, wird wohl auch er neue Raum wieder in diese Richtung gehen.
Hier schon mal ein erster Entwurf:
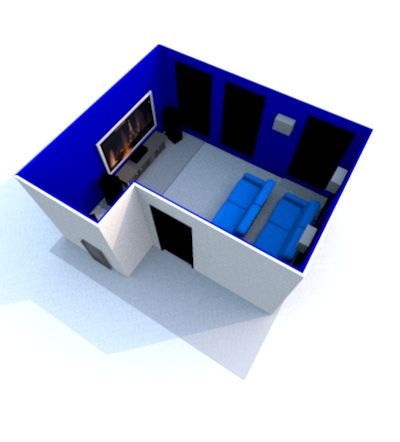
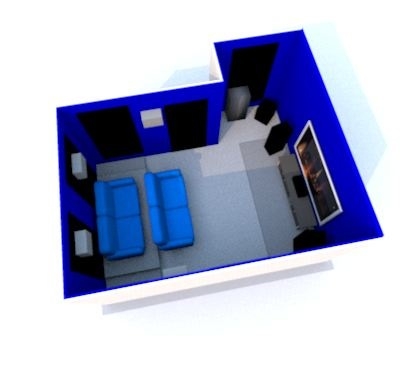
Schauen wir also mal, wie sich das alles entwickeln wird und welche Stolpersteine sich noch ergeben werden (und die werden kommen).
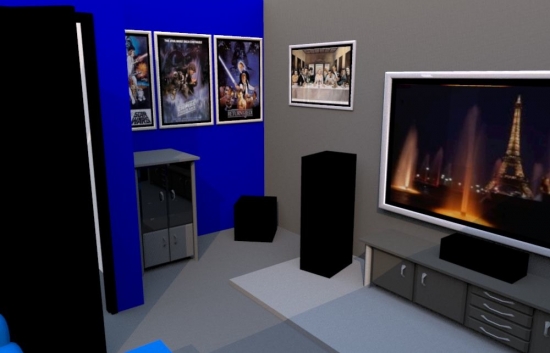
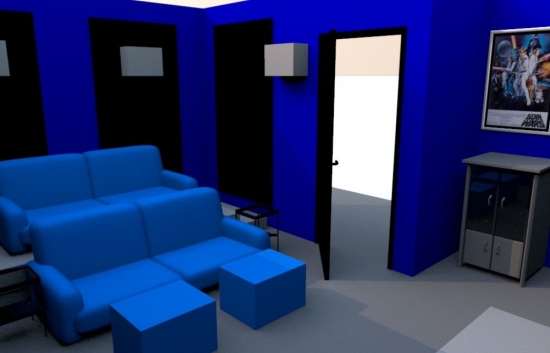

Da es sich um ein Reihenmittelhaus handelt, mache ich mir gerade viele Gedanken über eine mögliche Schallisolierung nach links und rechts. Denke, dieser Punkt wird mich noch eine Zeit lang beschäftigen.
Viele Grüße
Markus
nun scheint es sich zu bewahrheiten: ein neues Kino ist in Sicht :-)
Wir werden aller Voraussicht nach am kommenden Freitag ein Haus kaufen und dann im April umziehen. Dann heißt es Abschied nehmen vom augenblicklichen Kino.
Ich sehe die Situation mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Auf der einen Seite freut es mich natürlich, wieder ein Projekt komplett von vorne starten zu können und hier die Erfahrungen mit einfließen zu lassen, die ich beim "Bau" unseres jetzigen Kinos gewonnen habe.
Auf der anderen Seite tut es mir ein wenig leid, dem jetzigen Kino den Rücken zuzukehren. Wie ich ja bereits geschrieben hatte, war ich mittlerweile RICHTIG zufrieden mit Klang, Ausstattung und Optik, sodass es mich schon ein wenig ärgert, dass jetzt alles hinter mir zu lassen.
Da mir die Kombination aus Blau und Schwarz aber immer noch sehr gut gefällt, wird wohl auch er neue Raum wieder in diese Richtung gehen.
Hier schon mal ein erster Entwurf:
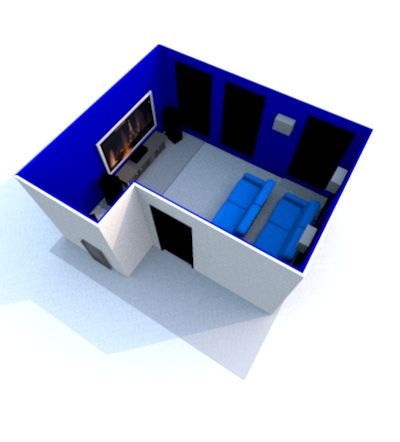
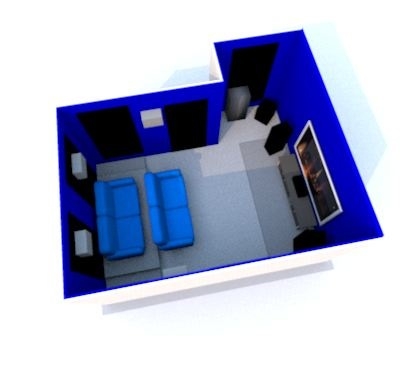
Schauen wir also mal, wie sich das alles entwickeln wird und welche Stolpersteine sich noch ergeben werden (und die werden kommen).
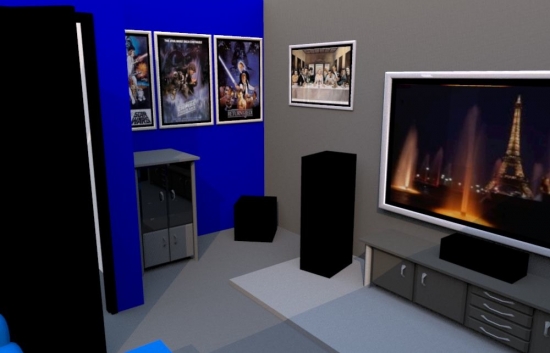
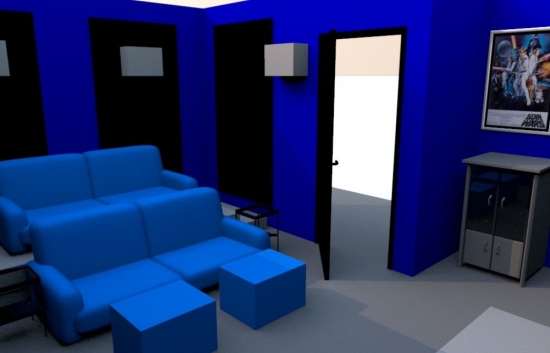

Da es sich um ein Reihenmittelhaus handelt, mache ich mir gerade viele Gedanken über eine mögliche Schallisolierung nach links und rechts. Denke, dieser Punkt wird mich noch eine Zeit lang beschäftigen.
Viele Grüße
Markus
Pioneer SC-LX72 - Der gute erste Eindruck stimmt!
17. Januar 2010Hallo zusammen,
nachdem mein erster Eindruck vom SC-LX72 ja bereits durchaus positiv war, setzt sich diese erste positive Erfahrung tatsächlich fort.
Wir haben uns vor ein paar Tagen "Master & Commander" angeschaut. Sowohl die Szenen, in denen es richtig zur Sache geht, als auch die, in denen es mehr um die gelungene Schaffung von Atmosphäre geht, konnten mich absolut überzeugen.
Im Vergleich zum Onkyo TX-SR875 lässt der Pioneer den eigentlich Kino-Raum viel eher "verschwinden" und ersetzt ihn durch den Ort des Geschehens. Besonders angenehm finde ich, dass der Pioneer das alles auch bei höheren Lautstärken alles so ungemein unaufdringlich hinbekommt. Gerade in lauten Szenen ist man versucht, die Lautstärke immer noch ein wenig mehr zu erhöhen, weil es einfach nicht unangenehm klingt.
Mal schauen, mit was ich ihn heute füttern werde. Ich bin mir aber fast sicher, dass, was immer ich auch nehmen werde, es ihn nicht aus der Reserve locken wird.
Fazit: für mich war der Pioneer ein absolut lohnenswerter Kauf. Die wenigen Nachteile (unflexibles Boxen-Setup und funktionierendes Einmesssystem erst über 63 Hz) werden vom genialen Klang, der hochwertigen Optik und den nur handwarm werdenden Endstufen locker aufgewogen.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag
Markus
nachdem mein erster Eindruck vom SC-LX72 ja bereits durchaus positiv war, setzt sich diese erste positive Erfahrung tatsächlich fort.
Wir haben uns vor ein paar Tagen "Master & Commander" angeschaut. Sowohl die Szenen, in denen es richtig zur Sache geht, als auch die, in denen es mehr um die gelungene Schaffung von Atmosphäre geht, konnten mich absolut überzeugen.
Im Vergleich zum Onkyo TX-SR875 lässt der Pioneer den eigentlich Kino-Raum viel eher "verschwinden" und ersetzt ihn durch den Ort des Geschehens. Besonders angenehm finde ich, dass der Pioneer das alles auch bei höheren Lautstärken alles so ungemein unaufdringlich hinbekommt. Gerade in lauten Szenen ist man versucht, die Lautstärke immer noch ein wenig mehr zu erhöhen, weil es einfach nicht unangenehm klingt.
Mal schauen, mit was ich ihn heute füttern werde. Ich bin mir aber fast sicher, dass, was immer ich auch nehmen werde, es ihn nicht aus der Reserve locken wird.
Fazit: für mich war der Pioneer ein absolut lohnenswerter Kauf. Die wenigen Nachteile (unflexibles Boxen-Setup und funktionierendes Einmesssystem erst über 63 Hz) werden vom genialen Klang, der hochwertigen Optik und den nur handwarm werdenden Endstufen locker aufgewogen.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag
Markus
Neuer Receiver zeigt, was er kann
9. Januar 2010Hallo zusammen,
es war mal wieder soweit: ich gönne mir ja alle 2 Jahren einen neuen AV-Receiver (mache ich seit 1997 so) und diesmal ist meine Wahl auf ein Gerät von Pioneer gefallen.
Ich hatte in der Vergangenheit schon zwei Pioneers (1999 den VSX-908RDS und dann nach einem kurzen aber unbefriedigenden Abstecher zu Denon einen VSX-D2011). Klanglich war ich mit den Geräten von Pioneer immer sehr zufrieden, der 908er hatte nur mit einem Serienfehler zu kämpfen. Die Ausbesserung nahm lange Zeit in Anspruch und ich konnte mir letztendlich bei meinem Händler ein neues Gerät aussuchen. Die Wahl fiel dabei leider auf Denon (AVR-3803 meine ich), mit dem ich aber klanglich rein gar nichts anfangen konnte.
Nun, seit letzten Samstag steht nun ein SC-LX72 im Keller und ersetzt den Onkyo TX-SR875. Der Onkyo ist meiner Meinung nach immer noch ein verdammt tolles Gerät. Super Klang, tolle Ausstattung und gute Verarbeitung haben mich in den letzten 1 3/4 Jahren nicht enttäuscht, höchstens die relativ starke Hitzeentwicklung könnte man bemäkeln.
An sich hatte ich bei Pioneer mit einem LX82 geliebäugelt, der mir dann aber doch zu teuer war, sodass ich mich letztendlich für den LX72 entschieden habe, den ich für EUR 1500 (Listenpreis ist EUR 1899) erwerben konnte.
 Optisch macht der Pioneer im Vergleich zum Onkyo noch mal einen wertigeren Eindruck. Die Hochglanzfront ist sicherlich Geschmacksache, aber die Tatsache, dass nur 2 Drehregler und 1 Knopf offensichtlich zu sehen sind gefällt mir sehr gut. Das Display ist groß und lässt sich in mehreren Stufen dimmen und auch ganz abschalten.
Optisch macht der Pioneer im Vergleich zum Onkyo noch mal einen wertigeren Eindruck. Die Hochglanzfront ist sicherlich Geschmacksache, aber die Tatsache, dass nur 2 Drehregler und 1 Knopf offensichtlich zu sehen sind gefällt mir sehr gut. Das Display ist groß und lässt sich in mehreren Stufen dimmen und auch ganz abschalten.
Was mein Setup angeht, so musste ich einige kleine Änderungen vornehmen, um den 72er richtig zum "Klingen" zu bringen. Nach Anschluss und erstem vollautomatischen Einmessen stellte sich erst einmal Ernüchterung ein:
Der Bass dröhnte, das war früher nicht so. Ich habe mich dann ein wenig schlau gemacht und herausgefunden, dass das EInmesssystem MCACC Advanced von Pioneer im Gegensatz zum Audyssey des Onkyo keine Frequenzgangkorrekturen unter 63 Hz vornimmt. Halte ich persönlich für ziemlich unpraktikabel, da gerade im Bassbereich auch unter 63 Hz schon Probleme mit stehenden Wellen auftreten können.
So nun auch hier. Die Probleme kamen nicht vom Subwoofer (der wurde ja zuvor vom eigenen Einmesssystem optimiert) sondern von den Hauptlautsprechern, die ich bisher immer auf LARGE laufen hatte. Ein Wechsel auf SMALL und die Wahl von 80 Hz als Übernahmefrequenz (der Pioneer bietet im Gegensatz zum Onkyo für alle angeschlossenen Lautsprecher nur EINE Übernahmefrequenz an. Das war bei Onkyo flexibler, hier konnte man die Mains bei 60 Hz trennen, den Center bei 70 Hz und die Surrounds bei 80 Hz, ganz so wie es eben individuell passte. Beim Pioneer gilt die gewählte Frequenz nun für alle Lautsprecher.
Nach dem Umschalten auf 80 Hz war das Dröhnen weg. Klar, der Bereich von 80 Hz der Hauptlautsprecher wurde ja nun vom Subwoofer übernommen, der ja bereits von stehenden Wellen bereinigt war.
Der Klang war nun schon wesentlich besser, nur leider hatte ich den Subwoofer bisher hinten links im Raum stehen stehen und nun konnte man ihn dort orten. Nicht so schön...
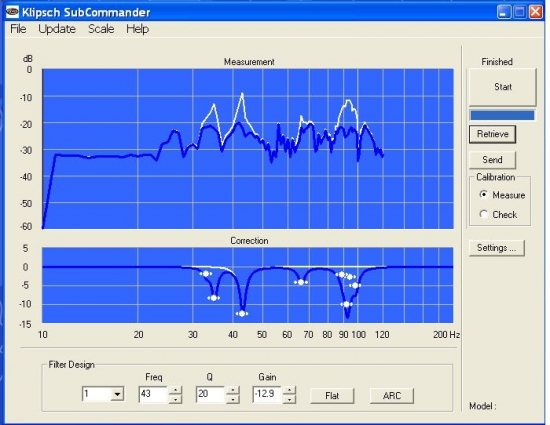 Ich habe mich dann entschlossen, noch ein wenig mit der Position des Subwoofers zu spielen und stellte ihn vorne rechts in die Raumecke (dafür ist der Klipsch ja konzipiert). Die große Überraschung folgte nach dem Einmessen des Subwoofers:
Ich habe mich dann entschlossen, noch ein wenig mit der Position des Subwoofers zu spielen und stellte ihn vorne rechts in die Raumecke (dafür ist der Klipsch ja konzipiert). Die große Überraschung folgte nach dem Einmessen des Subwoofers:
Er spielte nun wesentlich tiefer als auf der bisherigen Position, klasse!
Die Position hinten links hatte ich damals gewählt, als wir unseren Hauptsitzplatz noch an der Rückwand des Raums hatten. Nun liegt er 1,5m weiter vorne und da scheint also nun die neue Position vorne wesentlich besser geeignet zu sein. Wie die obere blaue Kurve zeigt, ist der Frequenzgang gerade im TIefbass nun RICHTIG gerade.
Auch im Zusammenspiel mit den auf SMALL laufenden Hauptlautsprechern stellte sich nun ein sehr homogenes Klangbild ein. Was den Pioneer hier vom Onkyo unterscheidet ist die enorme Weiträumigkeit, mit der er einen Filmsoundtrack abbildet. Der Pioneer gibt einem das Gefühl, dass man nicht zwischen unzähligen Lautsprechern sitzt, sondern vom Klang umgeben ist.
Das ist auch ein Verdienst einer Technik, die Pioneer Fullband Phase Control nennt. Hier wird theoretisch davon ausgegangen, das es zeitliche Verzögerungen bei der Tonwiedergabe mit Mehr-Wege-Boxen gibt, weil z.B. der Hochtöner schneller reagieren kann als ein Tieftöner. Diese zeitlichen Unterschiede gleich die Fullband Phase Control aus und man merkt tatsächlich den Unterschied, wenn man sie an- und abschaltet.
So, nach diesem langen Posting ist jetzt erst mal Pause :-) Ich werde in den kommenden Tagen noch ein wenig über Einzelheiten berichten. Wer zwischendurch Fragen hat: immer her damit!
Viele Grüße
Markus
es war mal wieder soweit: ich gönne mir ja alle 2 Jahren einen neuen AV-Receiver (mache ich seit 1997 so) und diesmal ist meine Wahl auf ein Gerät von Pioneer gefallen.
Ich hatte in der Vergangenheit schon zwei Pioneers (1999 den VSX-908RDS und dann nach einem kurzen aber unbefriedigenden Abstecher zu Denon einen VSX-D2011). Klanglich war ich mit den Geräten von Pioneer immer sehr zufrieden, der 908er hatte nur mit einem Serienfehler zu kämpfen. Die Ausbesserung nahm lange Zeit in Anspruch und ich konnte mir letztendlich bei meinem Händler ein neues Gerät aussuchen. Die Wahl fiel dabei leider auf Denon (AVR-3803 meine ich), mit dem ich aber klanglich rein gar nichts anfangen konnte.
Nun, seit letzten Samstag steht nun ein SC-LX72 im Keller und ersetzt den Onkyo TX-SR875. Der Onkyo ist meiner Meinung nach immer noch ein verdammt tolles Gerät. Super Klang, tolle Ausstattung und gute Verarbeitung haben mich in den letzten 1 3/4 Jahren nicht enttäuscht, höchstens die relativ starke Hitzeentwicklung könnte man bemäkeln.
An sich hatte ich bei Pioneer mit einem LX82 geliebäugelt, der mir dann aber doch zu teuer war, sodass ich mich letztendlich für den LX72 entschieden habe, den ich für EUR 1500 (Listenpreis ist EUR 1899) erwerben konnte.
 Optisch macht der Pioneer im Vergleich zum Onkyo noch mal einen wertigeren Eindruck. Die Hochglanzfront ist sicherlich Geschmacksache, aber die Tatsache, dass nur 2 Drehregler und 1 Knopf offensichtlich zu sehen sind gefällt mir sehr gut. Das Display ist groß und lässt sich in mehreren Stufen dimmen und auch ganz abschalten.
Optisch macht der Pioneer im Vergleich zum Onkyo noch mal einen wertigeren Eindruck. Die Hochglanzfront ist sicherlich Geschmacksache, aber die Tatsache, dass nur 2 Drehregler und 1 Knopf offensichtlich zu sehen sind gefällt mir sehr gut. Das Display ist groß und lässt sich in mehreren Stufen dimmen und auch ganz abschalten.Was mein Setup angeht, so musste ich einige kleine Änderungen vornehmen, um den 72er richtig zum "Klingen" zu bringen. Nach Anschluss und erstem vollautomatischen Einmessen stellte sich erst einmal Ernüchterung ein:
Der Bass dröhnte, das war früher nicht so. Ich habe mich dann ein wenig schlau gemacht und herausgefunden, dass das EInmesssystem MCACC Advanced von Pioneer im Gegensatz zum Audyssey des Onkyo keine Frequenzgangkorrekturen unter 63 Hz vornimmt. Halte ich persönlich für ziemlich unpraktikabel, da gerade im Bassbereich auch unter 63 Hz schon Probleme mit stehenden Wellen auftreten können.
So nun auch hier. Die Probleme kamen nicht vom Subwoofer (der wurde ja zuvor vom eigenen Einmesssystem optimiert) sondern von den Hauptlautsprechern, die ich bisher immer auf LARGE laufen hatte. Ein Wechsel auf SMALL und die Wahl von 80 Hz als Übernahmefrequenz (der Pioneer bietet im Gegensatz zum Onkyo für alle angeschlossenen Lautsprecher nur EINE Übernahmefrequenz an. Das war bei Onkyo flexibler, hier konnte man die Mains bei 60 Hz trennen, den Center bei 70 Hz und die Surrounds bei 80 Hz, ganz so wie es eben individuell passte. Beim Pioneer gilt die gewählte Frequenz nun für alle Lautsprecher.
Nach dem Umschalten auf 80 Hz war das Dröhnen weg. Klar, der Bereich von 80 Hz der Hauptlautsprecher wurde ja nun vom Subwoofer übernommen, der ja bereits von stehenden Wellen bereinigt war.
Der Klang war nun schon wesentlich besser, nur leider hatte ich den Subwoofer bisher hinten links im Raum stehen stehen und nun konnte man ihn dort orten. Nicht so schön...
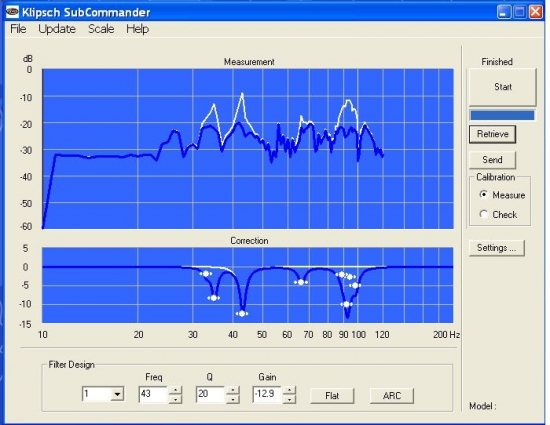 Ich habe mich dann entschlossen, noch ein wenig mit der Position des Subwoofers zu spielen und stellte ihn vorne rechts in die Raumecke (dafür ist der Klipsch ja konzipiert). Die große Überraschung folgte nach dem Einmessen des Subwoofers:
Ich habe mich dann entschlossen, noch ein wenig mit der Position des Subwoofers zu spielen und stellte ihn vorne rechts in die Raumecke (dafür ist der Klipsch ja konzipiert). Die große Überraschung folgte nach dem Einmessen des Subwoofers:Er spielte nun wesentlich tiefer als auf der bisherigen Position, klasse!
Die Position hinten links hatte ich damals gewählt, als wir unseren Hauptsitzplatz noch an der Rückwand des Raums hatten. Nun liegt er 1,5m weiter vorne und da scheint also nun die neue Position vorne wesentlich besser geeignet zu sein. Wie die obere blaue Kurve zeigt, ist der Frequenzgang gerade im TIefbass nun RICHTIG gerade.
Auch im Zusammenspiel mit den auf SMALL laufenden Hauptlautsprechern stellte sich nun ein sehr homogenes Klangbild ein. Was den Pioneer hier vom Onkyo unterscheidet ist die enorme Weiträumigkeit, mit der er einen Filmsoundtrack abbildet. Der Pioneer gibt einem das Gefühl, dass man nicht zwischen unzähligen Lautsprechern sitzt, sondern vom Klang umgeben ist.
Das ist auch ein Verdienst einer Technik, die Pioneer Fullband Phase Control nennt. Hier wird theoretisch davon ausgegangen, das es zeitliche Verzögerungen bei der Tonwiedergabe mit Mehr-Wege-Boxen gibt, weil z.B. der Hochtöner schneller reagieren kann als ein Tieftöner. Diese zeitlichen Unterschiede gleich die Fullband Phase Control aus und man merkt tatsächlich den Unterschied, wenn man sie an- und abschaltet.
So, nach diesem langen Posting ist jetzt erst mal Pause :-) Ich werde in den kommenden Tagen noch ein wenig über Einzelheiten berichten. Wer zwischendurch Fragen hat: immer her damit!
Viele Grüße
Markus
Belkin PF-50 Power-Console: Mehr als nur eine Mehrfachsteckdose?
13. Dezember 2009Hallo zusammen,
 nach vielen Monaten bin ich endlich mal wieder dazu gekommen, ein wenig was im Keller zu basteln. Da ich der Meinung war, dass wir bei HD-Material zu weit von der Leinwand wegsitzen, schauen wir uns Filme nun wieder von der vorderen Couch aus an. Damit es dabei auch bequem zugeht, haben wir direkt einen neuen passenden Hocker für die Beine samt neuen Bezügen für die beiden Klippan-Sofas geholt. Die Bezüge sind wesentlich dunkler als die Alten, was man auf dem Foto aber leider nicht wirklich erkennen kann.
nach vielen Monaten bin ich endlich mal wieder dazu gekommen, ein wenig was im Keller zu basteln. Da ich der Meinung war, dass wir bei HD-Material zu weit von der Leinwand wegsitzen, schauen wir uns Filme nun wieder von der vorderen Couch aus an. Damit es dabei auch bequem zugeht, haben wir direkt einen neuen passenden Hocker für die Beine samt neuen Bezügen für die beiden Klippan-Sofas geholt. Die Bezüge sind wesentlich dunkler als die Alten, was man auf dem Foto aber leider nicht wirklich erkennen kann.
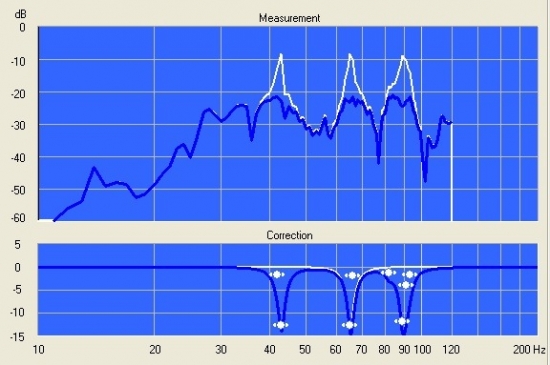 Außerdem habe ich die Leinwand 30 cm weiter nach unten gehangen (damit verbunden auch eine neue horizontale Ausrichtung des Center-Speakers), weil man ansonsten immer leicht den Blick heben musste, um das Bild "richtig" zu sehen.
Außerdem habe ich die Leinwand 30 cm weiter nach unten gehangen (damit verbunden auch eine neue horizontale Ausrichtung des Center-Speakers), weil man ansonsten immer leicht den Blick heben musste, um das Bild "richtig" zu sehen.
Als Folge dieser "Umzugsaktion" hat sich auch die Bass-Wiedergabe an der Hörposition verbessert. Zu 20 Hz hin fällt der Pegel jetzt weniger Steil ab, außerdem haben sich 2 Raum-Moden in Luft aufgelöst.
Alles in Allem macht Filmeschauen nun ein ganzes Stück mehr Spaß und das mit wenig Aufwand.
Es ist aber auch ein neues Gerät hinzugekommen und zwar die Belkin PF-50 Power Console. Das ist, wenn man es böse ausdrücken möchte, eine überteuerte Mehrfachsteckdose mit Display :) Ok, es steckt natürlich noch mehr in dem schicken Gehäuse. Die PF-50 bietet insgesamt 10 Steckdose (9 auf der Rückseite, 1 vorne unter einer Klappe), die jeweils in Bänke von 2 Steckdosen zusammengefasst sind, die sich jeweils separat schalten lassen. Dabei sind Einschaltverzögerung, Dauerstrom etc. individuell konfigurierbar (über die Knöpfe unter dem Display und über Schalter auf der Rückseite). Auch ist es möglich, die angeschlossenen Geräte automatisch dann einzuschalten, wenn man den Receiver einschaltet.
Neben diesen Komfort-Funktionen bietet die PF-50 verschiedene Netzfilter für Audio, Video und Digital-Geräte, die für die jeweilige Gerätegattung schädliche Einflüsse aus dem angelieferten Strom herausfiltern. Außerdem ist ein Überspannungsschutz integriert und alle Geräte sind über Belkin gegen Überspannungsschäden versichert.

Die Frage, die man sich nun stellen darf, lautet natürlich: "Bringt das alles was?"
Und um die Frage direkt ganz klar zu beantworten: "Vielleicht!!!" :)
Keine Frage, der Gewinn an Komfort ist natürlich direkt nachvollziehbar und das gute Gefühl, die angeschlossenen Geräte gegen Überspannungsschäden geschützt zu wissen, ist auch beruhigend. Was aber die Filter angeht, so bin ich ein wenig hin und her gerissen. Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich mit dem Anschluss meiner Geräte an die PF-50 deren Performance in neue Höhen geschraubt hätte. Ich hatte bisher nicht mit Brummschleifen o.ä. zu tun, somit kann ich hier von keinem Effekt berichten. Ich denke aber auch einfach, dass die Stromversorgung in DE so stabil und frei von schädlichen Einflüssen ist, dass sich ein Effekt in unseren Breitengraden nur schwer feststellen lassen wird.
Also: War die PF-50 ein Fehlkauf? Nein, ich finde nicht! Wenn man Spaß an hochwertigen Komponenten hat, dann ist die PF-50 sicherlich eine tolle Ergänzung. Sie sieht überaus wertig aus, ist hochwertig verarbeitet und vermittelt das gute Gefühl, die wertvollen Geräte adäquat und sicher angeschlossen zu haben. Ob einem das EUR 250 wert ist, muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe den Kauf jedenfalls nicht bereut.
In diesem Sinne viele Grüße
Markus
P.S.: Die PF-50 hat übrigens auch noch Anschlüsse für Netzwerk, Sat und Telefon, womit man auch diese Komponenten gegen Überspannung schützen kann.
 nach vielen Monaten bin ich endlich mal wieder dazu gekommen, ein wenig was im Keller zu basteln. Da ich der Meinung war, dass wir bei HD-Material zu weit von der Leinwand wegsitzen, schauen wir uns Filme nun wieder von der vorderen Couch aus an. Damit es dabei auch bequem zugeht, haben wir direkt einen neuen passenden Hocker für die Beine samt neuen Bezügen für die beiden Klippan-Sofas geholt. Die Bezüge sind wesentlich dunkler als die Alten, was man auf dem Foto aber leider nicht wirklich erkennen kann.
nach vielen Monaten bin ich endlich mal wieder dazu gekommen, ein wenig was im Keller zu basteln. Da ich der Meinung war, dass wir bei HD-Material zu weit von der Leinwand wegsitzen, schauen wir uns Filme nun wieder von der vorderen Couch aus an. Damit es dabei auch bequem zugeht, haben wir direkt einen neuen passenden Hocker für die Beine samt neuen Bezügen für die beiden Klippan-Sofas geholt. Die Bezüge sind wesentlich dunkler als die Alten, was man auf dem Foto aber leider nicht wirklich erkennen kann.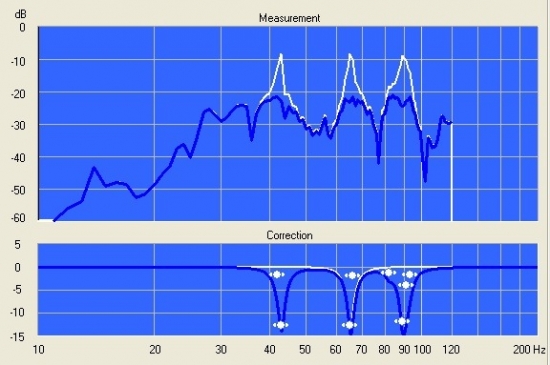 Außerdem habe ich die Leinwand 30 cm weiter nach unten gehangen (damit verbunden auch eine neue horizontale Ausrichtung des Center-Speakers), weil man ansonsten immer leicht den Blick heben musste, um das Bild "richtig" zu sehen.
Außerdem habe ich die Leinwand 30 cm weiter nach unten gehangen (damit verbunden auch eine neue horizontale Ausrichtung des Center-Speakers), weil man ansonsten immer leicht den Blick heben musste, um das Bild "richtig" zu sehen.Als Folge dieser "Umzugsaktion" hat sich auch die Bass-Wiedergabe an der Hörposition verbessert. Zu 20 Hz hin fällt der Pegel jetzt weniger Steil ab, außerdem haben sich 2 Raum-Moden in Luft aufgelöst.
Alles in Allem macht Filmeschauen nun ein ganzes Stück mehr Spaß und das mit wenig Aufwand.
Es ist aber auch ein neues Gerät hinzugekommen und zwar die Belkin PF-50 Power Console. Das ist, wenn man es böse ausdrücken möchte, eine überteuerte Mehrfachsteckdose mit Display :) Ok, es steckt natürlich noch mehr in dem schicken Gehäuse. Die PF-50 bietet insgesamt 10 Steckdose (9 auf der Rückseite, 1 vorne unter einer Klappe), die jeweils in Bänke von 2 Steckdosen zusammengefasst sind, die sich jeweils separat schalten lassen. Dabei sind Einschaltverzögerung, Dauerstrom etc. individuell konfigurierbar (über die Knöpfe unter dem Display und über Schalter auf der Rückseite). Auch ist es möglich, die angeschlossenen Geräte automatisch dann einzuschalten, wenn man den Receiver einschaltet.
Neben diesen Komfort-Funktionen bietet die PF-50 verschiedene Netzfilter für Audio, Video und Digital-Geräte, die für die jeweilige Gerätegattung schädliche Einflüsse aus dem angelieferten Strom herausfiltern. Außerdem ist ein Überspannungsschutz integriert und alle Geräte sind über Belkin gegen Überspannungsschäden versichert.

Die Frage, die man sich nun stellen darf, lautet natürlich: "Bringt das alles was?"
Und um die Frage direkt ganz klar zu beantworten: "Vielleicht!!!" :)
Keine Frage, der Gewinn an Komfort ist natürlich direkt nachvollziehbar und das gute Gefühl, die angeschlossenen Geräte gegen Überspannungsschäden geschützt zu wissen, ist auch beruhigend. Was aber die Filter angeht, so bin ich ein wenig hin und her gerissen. Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich mit dem Anschluss meiner Geräte an die PF-50 deren Performance in neue Höhen geschraubt hätte. Ich hatte bisher nicht mit Brummschleifen o.ä. zu tun, somit kann ich hier von keinem Effekt berichten. Ich denke aber auch einfach, dass die Stromversorgung in DE so stabil und frei von schädlichen Einflüssen ist, dass sich ein Effekt in unseren Breitengraden nur schwer feststellen lassen wird.
Also: War die PF-50 ein Fehlkauf? Nein, ich finde nicht! Wenn man Spaß an hochwertigen Komponenten hat, dann ist die PF-50 sicherlich eine tolle Ergänzung. Sie sieht überaus wertig aus, ist hochwertig verarbeitet und vermittelt das gute Gefühl, die wertvollen Geräte adäquat und sicher angeschlossen zu haben. Ob einem das EUR 250 wert ist, muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe den Kauf jedenfalls nicht bereut.
In diesem Sinne viele Grüße
Markus
P.S.: Die PF-50 hat übrigens auch noch Anschlüsse für Netzwerk, Sat und Telefon, womit man auch diese Komponenten gegen Überspannung schützen kann.
Stillstand oder einfach nur momentane Zufriedenheit?
31. Oktober 2009Hallo zusammen,
nach langer Zeit kommt nun mal wieder ein Beitrag in meinem Blog.
Wieso hat es so lange gedauert? Nun, das kann ich selbst nicht so genau sagen. Auf der einen Seite haben wir in den letzten Monaten so einige Filme im Keller angeschaut, somit ist das Kino durchaus oft im Einsatz. Auf der anderen Seite hat sich aber technisch nichts getan, von dem es sich zu berichten gelohnt hätte.
Ich hatte ja schon erwähnt, dass wir auf der Suche nach einem neuen Haus sind und ich denke, dass das meinen Elan, neue Dinge zu bauen und auszuprobieren ein wenig bremst. Ich hätte durchaus Spaß daran, noch die eine oder andere Sache im Keller neu zu bauen oder zu optimieren. Die Frage, die ich mir dann aber immer stelle ist, ob sich das überhaupt noch lohnt.
Schauen wir also mal, wie sich "die Situation" in den nächsten Wochen/Monaten entwickeln wird.
Wir waren übrigens die letzten drei Wochen im Urlaub in Schweden und davon eine Woche ganz oben in Lappland in der Einsamkeit ohne TV und Internet. Ihr werdet es nicht glauben, aber man kann unter diesen Umständen tatsächlich überleben :-) Nach 2 Tagen fühlt es sich gar nicht mehr so schlimm an und man spart einen fetten Batzen Geld, wenn man nicht jeden Tag neue BDs bei Amazon bestellt :-)


In diesem Sinne viele Grüße
Markus
nach langer Zeit kommt nun mal wieder ein Beitrag in meinem Blog.
Wieso hat es so lange gedauert? Nun, das kann ich selbst nicht so genau sagen. Auf der einen Seite haben wir in den letzten Monaten so einige Filme im Keller angeschaut, somit ist das Kino durchaus oft im Einsatz. Auf der anderen Seite hat sich aber technisch nichts getan, von dem es sich zu berichten gelohnt hätte.
Ich hatte ja schon erwähnt, dass wir auf der Suche nach einem neuen Haus sind und ich denke, dass das meinen Elan, neue Dinge zu bauen und auszuprobieren ein wenig bremst. Ich hätte durchaus Spaß daran, noch die eine oder andere Sache im Keller neu zu bauen oder zu optimieren. Die Frage, die ich mir dann aber immer stelle ist, ob sich das überhaupt noch lohnt.
Schauen wir also mal, wie sich "die Situation" in den nächsten Wochen/Monaten entwickeln wird.
Wir waren übrigens die letzten drei Wochen im Urlaub in Schweden und davon eine Woche ganz oben in Lappland in der Einsamkeit ohne TV und Internet. Ihr werdet es nicht glauben, aber man kann unter diesen Umständen tatsächlich überleben :-) Nach 2 Tagen fühlt es sich gar nicht mehr so schlimm an und man spart einen fetten Batzen Geld, wenn man nicht jeden Tag neue BDs bei Amazon bestellt :-)


In diesem Sinne viele Grüße
Markus
Bald schon ein neues Kino...?
19. Juli 2009Hallo zusammen,
nachdem ich nun seit ein paar Monaten so weit war, dass mir mein Kino sowohl optisch als auch technisch wirklich gut gefällt, könnte es bald schon nötig sein, mit dem kleinen Filmpalast umzuziehen bzw. einen neuen zu bauen.
Meine Frau und ich schauen nun wieder aktiv nach einem Haus, das wir kaufen würden. Nachdem wir uns ja vor 3 Jahren zuerst einmal entschlossen hatten, ein Haus zu mieten, wäre es nun durchaus möglich, dass wir in etwas Eigenes umziehen.
Auf der einen Seite finde ich das natürlich toll, auf der anderen Seite würde es mir sehr leid tun, die ganze Arbeit, die ich mir im Keller so gemacht habe, einfach in die Tonne zu werfen. Insofern wäre ein Umzug eine Veränderung, auf die ich sowohl mit einem lachenden, aber sicherlich auch mit einem ziemlich weinenden Auge blicken würde.
Der erste Besichtigungstermin war letzten Donnerstag und obwohl dieses Haus sehr schön war (Landhausstil), hatte es einen entscheidenden Nachteil: kein Platz fürs Kino, aber wirklich GAR keinen Platz! Somit hätte sich das erst einmal erledigt, wobei ich schon überlegt hatte, ob die ganzen schönen Details dieses Hauses nicht einen Verzicht auf ein Kino rechtfertigen würden.
Auf der anderen Seite wäre dieses Haus dann aber auch eine Entscheidung für viele Jahre und die Vorstellung, in ein paar Monaten nur noch im Wohnzimmer auf dem TV meine Filme schauen zu können, hat mir überhaupt nicht gefallen. Wir werden also erst mal weitersuchen und bis wir dann irgendwann mal etwas gefunden haben, erfreue ich mich weiter am Kino im Keller.
In diesem Sinne viele Grüße und einen schönen Sonntag
Markus
nachdem ich nun seit ein paar Monaten so weit war, dass mir mein Kino sowohl optisch als auch technisch wirklich gut gefällt, könnte es bald schon nötig sein, mit dem kleinen Filmpalast umzuziehen bzw. einen neuen zu bauen.
Meine Frau und ich schauen nun wieder aktiv nach einem Haus, das wir kaufen würden. Nachdem wir uns ja vor 3 Jahren zuerst einmal entschlossen hatten, ein Haus zu mieten, wäre es nun durchaus möglich, dass wir in etwas Eigenes umziehen.
Auf der einen Seite finde ich das natürlich toll, auf der anderen Seite würde es mir sehr leid tun, die ganze Arbeit, die ich mir im Keller so gemacht habe, einfach in die Tonne zu werfen. Insofern wäre ein Umzug eine Veränderung, auf die ich sowohl mit einem lachenden, aber sicherlich auch mit einem ziemlich weinenden Auge blicken würde.
Der erste Besichtigungstermin war letzten Donnerstag und obwohl dieses Haus sehr schön war (Landhausstil), hatte es einen entscheidenden Nachteil: kein Platz fürs Kino, aber wirklich GAR keinen Platz! Somit hätte sich das erst einmal erledigt, wobei ich schon überlegt hatte, ob die ganzen schönen Details dieses Hauses nicht einen Verzicht auf ein Kino rechtfertigen würden.
Auf der anderen Seite wäre dieses Haus dann aber auch eine Entscheidung für viele Jahre und die Vorstellung, in ein paar Monaten nur noch im Wohnzimmer auf dem TV meine Filme schauen zu können, hat mir überhaupt nicht gefallen. Wir werden also erst mal weitersuchen und bis wir dann irgendwann mal etwas gefunden haben, erfreue ich mich weiter am Kino im Keller.
In diesem Sinne viele Grüße und einen schönen Sonntag
Markus
Subwoofer bändigen mit Absorbern
1. Juli 2009Hallo zusammen,
so sehr ich meinen Klipsch RT-10d auch liebe, so blöd finde ich es, dass er sich bei besonders tieffrequenten Tönen selbstständig macht und anfängt, durchs Zimmer zu wandern. Ok, er gibt nicht wirklich Gas und rast durch den Raum, man sieht aber schon nach 2 Stunden Film, dass er nicht mehr da steht, wo er vorher stand. Deutlich wird dies auch bei der automatischen Einmessung, die 1 Minute lan g relative laute tieffrequente Töne von sich gibt und den Subwoofer dabei so sehr in Schwingung versetzt, dass man kaum noch dessen Display lesen kann, weil sich die ganze Kiste so schüttelt.
g relative laute tieffrequente Töne von sich gibt und den Subwoofer dabei so sehr in Schwingung versetzt, dass man kaum noch dessen Display lesen kann, weil sich die ganze Kiste so schüttelt.
Um dagegen etwas zu unternehmen habe ich mir die Tri Absorber der Firma ViaBlue geholt. 4 St. davon kosten bei Ebay inkl. Versand ca. 50 EUR. Diese Dinger haben pro Stück 3 Spikes integriert und leiten so die Vibration des Subwoofers soweit ab, dass sich
a) der Subwoofer nicht mehr bewegt und
b) keine Bewegungsenergie mehr an den Boden abgegeben wird
Nach ersten Tests bin ich sehr überrascht und begeistert: es funktioniert tatsächlich. Der Subwoofer bewegt sich nicht mehr von der Stelle, das Gehäuse wird nicht mehr in so starke Schwingung versetzt und der Klang ist deutlich straffer geworden. Schnelle Impulse kommen sehr präzise und knackig ohne dass der Tiefgang leidet.
Wenn als jemand einem Subwoofer das Vibrieren angewöhnen möchte, dann sind die Tri Absorber ein heißer Tipp.
Viele Grüße
Markus
Um dagegen etwas zu unternehmen
so sehr ich meinen Klipsch RT-10d auch liebe, so blöd finde ich es, dass er sich bei besonders tieffrequenten Tönen selbstständig macht und anfängt, durchs Zimmer zu wandern. Ok, er gibt nicht wirklich Gas und rast durch den Raum, man sieht aber schon nach 2 Stunden Film, dass er nicht mehr da steht, wo er vorher stand. Deutlich wird dies auch bei der automatischen Einmessung, die 1 Minute lan
 g relative laute tieffrequente Töne von sich gibt und den Subwoofer dabei so sehr in Schwingung versetzt, dass man kaum noch dessen Display lesen kann, weil sich die ganze Kiste so schüttelt.
g relative laute tieffrequente Töne von sich gibt und den Subwoofer dabei so sehr in Schwingung versetzt, dass man kaum noch dessen Display lesen kann, weil sich die ganze Kiste so schüttelt.Um dagegen etwas zu unternehmen habe ich mir die Tri Absorber der Firma ViaBlue geholt. 4 St. davon kosten bei Ebay inkl. Versand ca. 50 EUR. Diese Dinger haben pro Stück 3 Spikes integriert und leiten so die Vibration des Subwoofers soweit ab, dass sich
a) der Subwoofer nicht mehr bewegt und
b) keine Bewegungsenergie mehr an den Boden abgegeben wird
Nach ersten Tests bin ich sehr überrascht und begeistert: es funktioniert tatsächlich. Der Subwoofer bewegt sich nicht mehr von der Stelle, das Gehäuse wird nicht mehr in so starke Schwingung versetzt und der Klang ist deutlich straffer geworden. Schnelle Impulse kommen sehr präzise und knackig ohne dass der Tiefgang leidet.
Wenn als jemand einem Subwoofer das Vibrieren angewöhnen möchte, dann sind die Tri Absorber ein heißer Tipp.
Viele Grüße
Markus
Um dagegen etwas zu unternehmen
Alter Beamer und trotzdem HD über HDMI? Kein Problem!!!
28. Juni 2009Hallo zusammen,
sowohl in der letzten Stereoplay als auch in der aktuellen Audiovision sind Specials zum Thema "HDMI" drin. Es wird über alle möglichen Probleme berichtet und wie diese gelöst werden können, beide Magazine schweigen sich aber zu einem besonders praktischen Problemlöser komplett aus.
Die Rede ist von einem Adapter namens "HD Fury". An sich ist das Ding schon ein alter Hut und die Profis unter euch werden nun gähnen. Für alle anderen, die noch einen HD-Ready-Beamer ohne HDMI-Anschluss haben, ist der kleine Kasten aber evtl. ein richtig dicker Problemlöser.
Aber der Reihe nach, wo liegt denn das Problem? Nun, alle BD-Player haben zwar einen YUV-Ausgang, über den im Moment auch noch BDs in einer Auflösung bis 1080i ausgegeben werden können. Soweit so gut, aber...
Problem Nr.1
Die Ausgabe bis 1080i klappt nur mit BDs, DVDs werden nicht hochskaliert.
Problem Nr. 2
Wenn der BD-Player per HDMI an einen AV-Receiver angeschlossen wird, um in den Genuss von HD-Ton zu kommen, dann wird die Ausgabe am YUV-Ausgang von 1080i auf 480p runtergeschraubt. Das wars dann mit 720p auf dem HD-Ready-Display.
Genau diese beiden Probleme kann der HD Fury lösen. Das ist ein kleiner Adapter, der mit dem VGA-Eingang (der ist Voraussetzung) am Beamer verschraubt wird. Je nachdem, welche Version des HD Fury man hat, wird der VGA-Eingang dann in einen DVI- oder HDMI-Eingang mit HDCP verwandelt. Das Resultat: alle anderen HDMI-Geräte wie BD-Player und AV-Receiver "denken", dass der Beamer HDMI-fähig ist und stellen all die Funktion bereit, die eben nur bei einer HDMI-Verbindung genutzt werden können.
Ich habe das vor ein paar Monaten mit meinem Epson EMP-TW200H gemacht und bin mit dem Ergebnis hochzufrieden. Das Bild hat im Vergleich zum Anschluss über YUV an Schärfe gewonnen (klar, denn BDs werden nun nicht mehr mit 480p sondern mit bis zum 1080p ausgegeben), die Farben sind "knackiger" und DVDs sehen auf einmal auch besser aus als vorher. Hinzu kommt, das HD-Ton UND HD-Bild nun gleichzeitig möglich sind.
Ich habe für die kleine Wunderkiste bei Amazon EUR 50 bezahlt (1x ausgepackt, DVI-Version), neu und original verpackt schlägt der HD Fury mit ca. EUR 80 zu Buche. Zusätzlich kamen noch EUR 30 für ein 15m HDMI-auf-DVI-Kabel hinzu und ein Netzteil für den HD-Fury (EUR 10, ist nötig für Kabellängen über 5m). Insgesamt also ein Investment von EUR 90, die sich wirklich gelohnt haben und meine Anlage deutlich aufgewertet haben.
Sollte als noch jemand einen HD-Ready-Beamer mit VGA-Eingang im Einsatz haben und mit dem Bild an sich zufrieden sein, dann ist der HD Fury DER Problemlöser schlechthin und holt aus dem Beamer noch mal deutlich mehr raus als die Zuspielung über YUV.
Viele Grüße
Markus
sowohl in der letzten Stereoplay als auch in der aktuellen Audiovision sind Specials zum Thema "HDMI" drin. Es wird über alle möglichen Probleme berichtet und wie diese gelöst werden können, beide Magazine schweigen sich aber zu einem besonders praktischen Problemlöser komplett aus.
Die Rede ist von einem Adapter namens "HD Fury". An sich ist das Ding schon ein alter Hut und die Profis unter euch werden nun gähnen. Für alle anderen, die noch einen HD-Ready-Beamer ohne HDMI-Anschluss haben, ist der kleine Kasten aber evtl. ein richtig dicker Problemlöser.
Aber der Reihe nach, wo liegt denn das Problem? Nun, alle BD-Player haben zwar einen YUV-Ausgang, über den im Moment auch noch BDs in einer Auflösung bis 1080i ausgegeben werden können. Soweit so gut, aber...
Problem Nr.1

Die Ausgabe bis 1080i klappt nur mit BDs, DVDs werden nicht hochskaliert.
Problem Nr. 2
Wenn der BD-Player per HDMI an einen AV-Receiver angeschlossen wird, um in den Genuss von HD-Ton zu kommen, dann wird die Ausgabe am YUV-Ausgang von 1080i auf 480p runtergeschraubt. Das wars dann mit 720p auf dem HD-Ready-Display.
Genau diese beiden Probleme kann der HD Fury lösen. Das ist ein kleiner Adapter, der mit dem VGA-Eingang (der ist Voraussetzung) am Beamer verschraubt wird. Je nachdem, welche Version des HD Fury man hat, wird der VGA-Eingang dann in einen DVI- oder HDMI-Eingang mit HDCP verwandelt. Das Resultat: alle anderen HDMI-Geräte wie BD-Player und AV-Receiver "denken", dass der Beamer HDMI-fähig ist und stellen all die Funktion bereit, die eben nur bei einer HDMI-Verbindung genutzt werden können.
Ich habe das vor ein paar Monaten mit meinem Epson EMP-TW200H gemacht und bin mit dem Ergebnis hochzufrieden. Das Bild hat im Vergleich zum Anschluss über YUV an Schärfe gewonnen (klar, denn BDs werden nun nicht mehr mit 480p sondern mit bis zum 1080p ausgegeben), die Farben sind "knackiger" und DVDs sehen auf einmal auch besser aus als vorher. Hinzu kommt, das HD-Ton UND HD-Bild nun gleichzeitig möglich sind.
Ich habe für die kleine Wunderkiste bei Amazon EUR 50 bezahlt (1x ausgepackt, DVI-Version), neu und original verpackt schlägt der HD Fury mit ca. EUR 80 zu Buche. Zusätzlich kamen noch EUR 30 für ein 15m HDMI-auf-DVI-Kabel hinzu und ein Netzteil für den HD-Fury (EUR 10, ist nötig für Kabellängen über 5m). Insgesamt also ein Investment von EUR 90, die sich wirklich gelohnt haben und meine Anlage deutlich aufgewertet haben.
Sollte als noch jemand einen HD-Ready-Beamer mit VGA-Eingang im Einsatz haben und mit dem Bild an sich zufrieden sein, dann ist der HD Fury DER Problemlöser schlechthin und holt aus dem Beamer noch mal deutlich mehr raus als die Zuspielung über YUV.
Viele Grüße
Markus
Neue Heimkino-Bilder
28. Juni 2009Hallo zusammen,
im Bilderbereich gibt es ein paar neue Kino-Impressionen. Ich habe die helle Zimmertür mit schwarzem Molton verkleidet, eine kleine Bühne unter die Leinwand gebaut. Außerdem gibt es jetzt atmosphärisches Licht von unten.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag
Markus
im Bilderbereich gibt es ein paar neue Kino-Impressionen. Ich habe die helle Zimmertür mit schwarzem Molton verkleidet, eine kleine Bühne unter die Leinwand gebaut. Außerdem gibt es jetzt atmosphärisches Licht von unten.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag
Markus
Klipsch RT-10d Subwoofer - Zwischenbilanz
28. Juni 2009Hallo zusammen,
 nachdem ich mich schon vor 1 1/2 Jahren in die Subwoofer der Reference-Serie von Klipsch verliebt hatte, habe ich mir vor 4 Wochen zum augenblicklichen Straßenpreis vor EUR 770 das Modell RT-10d (Listenpreis EUR 1600) gegönnt.
nachdem ich mich schon vor 1 1/2 Jahren in die Subwoofer der Reference-Serie von Klipsch verliebt hatte, habe ich mir vor 4 Wochen zum augenblicklichen Straßenpreis vor EUR 770 das Modell RT-10d (Listenpreis EUR 1600) gegönnt.
Der RT-10d hat einen dreieckigen Grundriss und eignet sich damit perfekt zum Einsatz in Raumecken. Er verfügt über drei 10" Bass-Treiber, von denen einer (der, der nach vorne in der Raum abstrahlt) aktiv von einer 700 Watt Digital-Endstufe versorgt wird. Die anderen beiden Treiber, die zur Wand strahlen, sind passiv ausgelegt, sie werden von der Energie und vom Luftdruck der aktiven Membran in Schwingung versetzt. Dieses Prinzip ist vergleichbar mit einem Bassreflex-Aufbau, wobei der Klipsch aber keine Probleme mit Strömungsgeräuschen hat.
Generell wird ja von einer Aufstellung eines Subs in Raumecken abgeraten, weil die Wände zwar den Pegel des Subs erhöhen, das aber leider oft unpräzise sein und auch zu unerwünschtem Dröhnen führen kann.
Der RT-10d umschifft diese Probleme indem er ein eigenes Einmesssystem verwendet und den Klang des Subwoofers so an den Raum anpasst und gegen stehende Wellen und somit Dröhnen vorgeht.
Die Inbetriebnahme des Subwoofers gestaltet sich somit recht einfach:
- Sub in eine Raumecke stellen (wobei man schon probieren sollte, in welcher Raumecke ein Sub generell am besten klingt)
- mitgeliefertes Mikrofon am Sub anschließen und am Hörplatz in Ohrhöhe aufbauen (am besten auf einem Stativ)
- den Einmessvorgang starten
- 1 Minute die Ohren zuhalten (es wird verdammt laut)
- FERTIG!
Ich habe im Anschluss dann noch einmal das Audyssey meines Onkyo TX-SR875 laufen lassen und das wars dann auch schon.
Was der kleine 10" Su bwoofer dann an Bassenergie in unseren 35qm Kinoraum pustet, ist schier unglaublich. Der RT-10d kann sowohl richtig laut und tief als auch schnell und präzise spielen. So soll das sein. Bei Explosionen bebt der ganze Raum (und die Magengrube), bei schnellen Musikimpulsen kommen diese knackig, schnell und mit Nachdruck.
bwoofer dann an Bassenergie in unseren 35qm Kinoraum pustet, ist schier unglaublich. Der RT-10d kann sowohl richtig laut und tief als auch schnell und präzise spielen. So soll das sein. Bei Explosionen bebt der ganze Raum (und die Magengrube), bei schnellen Musikimpulsen kommen diese knackig, schnell und mit Nachdruck.
Von einem Dröhnen habe ich bisher nichts gehört, es gab bisher einfach nur extrem guten Bass, der bis 22 Hz bei -3dB herunterreicht. Klar, es geht noch tiefer, aber seien wir doch mal ehrlich: braucht man das wirklich?!
Zusammenfassend würde ich den Klipsch als den besten Subwoofer bezeichnen, den ich je im Heimkinoeinsatz hatte. Für den Listenpreis von EUR 1600 gibt es sicherlich noch Konkurrenten, die noch tiefer und lauter spielen, zum augenblicklichen Straßenpreis von unter EUR 800 halte ich den Klipsch aber für konkurrenzlos.
Zum tollen Klang kommt noch eine sehr komplette Ausstattung.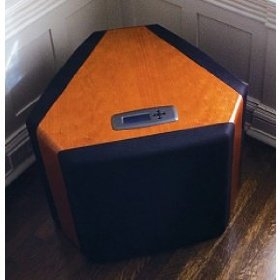 Neben dem Einmesssystem, das in schwierigen Räumen wirklich Wunder bewirken kann, gibt es ein gutes beleuchtetes LCD-Display, an dem alle Einstellungen gemacht werden könne. Es gibt voreingestellte Equalizer-Kurven, Presets für eigene Settings, eine Infrarot-Empfänger, um den Sub per FB steuern zu können und zu guter Letzt noch einen USB-Anschluss, um den Sub per PC-Software konfigurieren zu können (inkl. Anzeige der Messergebnisse als Frequenzgangschrieb).
Neben dem Einmesssystem, das in schwierigen Räumen wirklich Wunder bewirken kann, gibt es ein gutes beleuchtetes LCD-Display, an dem alle Einstellungen gemacht werden könne. Es gibt voreingestellte Equalizer-Kurven, Presets für eigene Settings, eine Infrarot-Empfänger, um den Sub per FB steuern zu können und zu guter Letzt noch einen USB-Anschluss, um den Sub per PC-Software konfigurieren zu können (inkl. Anzeige der Messergebnisse als Frequenzgangschrieb).
Von mir eine dicke Empfehlung für den Klipsch RT-10d (den es als RT-12d auch noch als 12" Variante gibt).
Viele Grüße
Markus
 nachdem ich mich schon vor 1 1/2 Jahren in die Subwoofer der Reference-Serie von Klipsch verliebt hatte, habe ich mir vor 4 Wochen zum augenblicklichen Straßenpreis vor EUR 770 das Modell RT-10d (Listenpreis EUR 1600) gegönnt.
nachdem ich mich schon vor 1 1/2 Jahren in die Subwoofer der Reference-Serie von Klipsch verliebt hatte, habe ich mir vor 4 Wochen zum augenblicklichen Straßenpreis vor EUR 770 das Modell RT-10d (Listenpreis EUR 1600) gegönnt.Der RT-10d hat einen dreieckigen Grundriss und eignet sich damit perfekt zum Einsatz in Raumecken. Er verfügt über drei 10" Bass-Treiber, von denen einer (der, der nach vorne in der Raum abstrahlt) aktiv von einer 700 Watt Digital-Endstufe versorgt wird. Die anderen beiden Treiber, die zur Wand strahlen, sind passiv ausgelegt, sie werden von der Energie und vom Luftdruck der aktiven Membran in Schwingung versetzt. Dieses Prinzip ist vergleichbar mit einem Bassreflex-Aufbau, wobei der Klipsch aber keine Probleme mit Strömungsgeräuschen hat.
Generell wird ja von einer Aufstellung eines Subs in Raumecken abgeraten, weil die Wände zwar den Pegel des Subs erhöhen, das aber leider oft unpräzise sein und auch zu unerwünschtem Dröhnen führen kann.
Der RT-10d umschifft diese Probleme indem er ein eigenes Einmesssystem verwendet und den Klang des Subwoofers so an den Raum anpasst und gegen stehende Wellen und somit Dröhnen vorgeht.
Die Inbetriebnahme des Subwoofers gestaltet sich somit recht einfach:
- Sub in eine Raumecke stellen (wobei man schon probieren sollte, in welcher Raumecke ein Sub generell am besten klingt)
- mitgeliefertes Mikrofon am Sub anschließen und am Hörplatz in Ohrhöhe aufbauen (am besten auf einem Stativ)
- den Einmessvorgang starten
- 1 Minute die Ohren zuhalten (es wird verdammt laut)
- FERTIG!
Ich habe im Anschluss dann noch einmal das Audyssey meines Onkyo TX-SR875 laufen lassen und das wars dann auch schon.
Was der kleine 10" Su
 bwoofer dann an Bassenergie in unseren 35qm Kinoraum pustet, ist schier unglaublich. Der RT-10d kann sowohl richtig laut und tief als auch schnell und präzise spielen. So soll das sein. Bei Explosionen bebt der ganze Raum (und die Magengrube), bei schnellen Musikimpulsen kommen diese knackig, schnell und mit Nachdruck.
bwoofer dann an Bassenergie in unseren 35qm Kinoraum pustet, ist schier unglaublich. Der RT-10d kann sowohl richtig laut und tief als auch schnell und präzise spielen. So soll das sein. Bei Explosionen bebt der ganze Raum (und die Magengrube), bei schnellen Musikimpulsen kommen diese knackig, schnell und mit Nachdruck.Von einem Dröhnen habe ich bisher nichts gehört, es gab bisher einfach nur extrem guten Bass, der bis 22 Hz bei -3dB herunterreicht. Klar, es geht noch tiefer, aber seien wir doch mal ehrlich: braucht man das wirklich?!
Zusammenfassend würde ich den Klipsch als den besten Subwoofer bezeichnen, den ich je im Heimkinoeinsatz hatte. Für den Listenpreis von EUR 1600 gibt es sicherlich noch Konkurrenten, die noch tiefer und lauter spielen, zum augenblicklichen Straßenpreis von unter EUR 800 halte ich den Klipsch aber für konkurrenzlos.
Zum tollen Klang kommt noch eine sehr komplette Ausstattung.
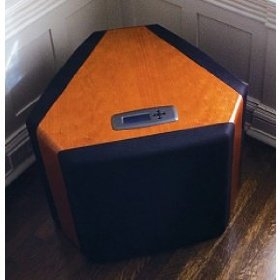 Neben dem Einmesssystem, das in schwierigen Räumen wirklich Wunder bewirken kann, gibt es ein gutes beleuchtetes LCD-Display, an dem alle Einstellungen gemacht werden könne. Es gibt voreingestellte Equalizer-Kurven, Presets für eigene Settings, eine Infrarot-Empfänger, um den Sub per FB steuern zu können und zu guter Letzt noch einen USB-Anschluss, um den Sub per PC-Software konfigurieren zu können (inkl. Anzeige der Messergebnisse als Frequenzgangschrieb).
Neben dem Einmesssystem, das in schwierigen Räumen wirklich Wunder bewirken kann, gibt es ein gutes beleuchtetes LCD-Display, an dem alle Einstellungen gemacht werden könne. Es gibt voreingestellte Equalizer-Kurven, Presets für eigene Settings, eine Infrarot-Empfänger, um den Sub per FB steuern zu können und zu guter Letzt noch einen USB-Anschluss, um den Sub per PC-Software konfigurieren zu können (inkl. Anzeige der Messergebnisse als Frequenzgangschrieb).Von mir eine dicke Empfehlung für den Klipsch RT-10d (den es als RT-12d auch noch als 12" Variante gibt).
Viele Grüße
Markus
Kabelsalat
27. Juni 2009Hallo zusammen,
ich habe es nun endlich mal geschafft, in unserem Wohnzimmer im Erdgeschoss die ganzen Heimkino-Kabel zu verstecken, Praktiker und Kabelkanälen sei Dank!
Ich kann nur jedem wärmstens ans Herz legen, ein paar EUR in diese Kanäle zu investieren. Es gibt sie in zahlreichen Farben für teilweise unten 5 EUR (für 2 Meter) und machen aus einem improvisiert ausschauenden Wohnraumkino fast eine richtige Installation. Sollte die Standardfarbe des Kanals nicht passen, dann streicht man eben noch mal drüber, aber auch ohne Anstrich ergibt sich ein ganz neues Bild.
Also dann, an alle, die viel Geld für gutes Equipment und unzählige Filme ausgeben:
Kabelkanäle kosten wenig und bringen viel :-)
Viele Grüße
Markus
ich habe es nun endlich mal geschafft, in unserem Wohnzimmer im Erdgeschoss die ganzen Heimkino-Kabel zu verstecken, Praktiker und Kabelkanälen sei Dank!
Ich kann nur jedem wärmstens ans Herz legen, ein paar EUR in diese Kanäle zu investieren. Es gibt sie in zahlreichen Farben für teilweise unten 5 EUR (für 2 Meter) und machen aus einem improvisiert ausschauenden Wohnraumkino fast eine richtige Installation. Sollte die Standardfarbe des Kanals nicht passen, dann streicht man eben noch mal drüber, aber auch ohne Anstrich ergibt sich ein ganz neues Bild.
Also dann, an alle, die viel Geld für gutes Equipment und unzählige Filme ausgeben:
Kabelkanäle kosten wenig und bringen viel :-)
Viele Grüße
Markus
Hallo zusammen,
meine Frau und ich kommen gerade aus dem Keller, wir hatten "Slumdog Millionaire" im BD-Player laufen. WAS FÜR EIN FILM!!!!
Ich muss sagen, dass ich den letzten Jahren ja schon an der Academy gezweifelt habe, was die Vergabe von Oscars angeht, aber dieser Film ist einfach in jeder Beziehung eine dicke Empfehlung wert.
Es fängt an beim Film selbst: tolle Story, tolle Schauspieler (und ich meine wirklich alle), wahnsinns Scnitte. So muss das sein und solche Filme haben auch Oscars verdient.
Die BD macht da keinen Unterschied. Wir hatten den Film bereits im Kino auf Deutsch gesehen, diesmal war es dann eben die BD aus UK und den Film im Original zu schauen bzw. zu hören, hat ihn noch mal eine Klasse besser gemacht.
Der richtige Hammer aber ist für mich der Sound. Was da an Details und Druck geboten wird, sucht seines Gleichen. Der Sound der DVD wurde auf AreaDVD mit 73% bewertet und da muss ich mich wirklich fragen, ob die Tester dort die gleiche BD im Player hatten wie wir heute Abend. Der Soundtrack ist so räumlich, dass man sich in die Slums von Bombay versetzt fühlt. Es gibt zahlreiche Effekte und der Bass ist tief und verdammt druckvoll. Die Musik verteilt sich auf alle Lautsprecher und reißt einen förmlich mit. Was an diesem Soundtrack "recht schlicht" sein soll, hat sich mir nicht erschlossen (unserem Nachbarn sicherlich auch nicht...).
In diesem Sinne: fette Empfehlung, unbedingt anschauen und anhören, es lohnt sich!
Viele Grüße
Markus
meine Frau und ich kommen gerade aus dem Keller, wir hatten "Slumdog Millionaire" im BD-Player laufen. WAS FÜR EIN FILM!!!!
Ich muss sagen, dass ich den letzten Jahren ja schon an der Academy gezweifelt habe, was die Vergabe von Oscars angeht, aber dieser Film ist einfach in jeder Beziehung eine dicke Empfehlung wert.
Es fängt an beim Film selbst: tolle Story, tolle Schauspieler (und ich meine wirklich alle), wahnsinns Scnitte. So muss das sein und solche Filme haben auch Oscars verdient.
Die BD macht da keinen Unterschied. Wir hatten den Film bereits im Kino auf Deutsch gesehen, diesmal war es dann eben die BD aus UK und den Film im Original zu schauen bzw. zu hören, hat ihn noch mal eine Klasse besser gemacht.
Der richtige Hammer aber ist für mich der Sound. Was da an Details und Druck geboten wird, sucht seines Gleichen. Der Sound der DVD wurde auf AreaDVD mit 73% bewertet und da muss ich mich wirklich fragen, ob die Tester dort die gleiche BD im Player hatten wie wir heute Abend. Der Soundtrack ist so räumlich, dass man sich in die Slums von Bombay versetzt fühlt. Es gibt zahlreiche Effekte und der Bass ist tief und verdammt druckvoll. Die Musik verteilt sich auf alle Lautsprecher und reißt einen förmlich mit. Was an diesem Soundtrack "recht schlicht" sein soll, hat sich mir nicht erschlossen (unserem Nachbarn sicherlich auch nicht...).
In diesem Sinne: fette Empfehlung, unbedingt anschauen und anhören, es lohnt sich!
Viele Grüße
Markus
Hallo zusammen,
ich hatte mir vor ein paar Wochen ja eine Philips SRT9320 geholt, weil ich einfach nicht an schönen Fernbedienungen vorbeigehen kann. Das fing schon 1993 an als ich meinen ersten AV-Receiver gekauft hatte und ich es blöd fand, mit 3 Fernbedienungen rumzuhantieren. Damals war es eine FB von Denon, die schon ein LCD-Display hatte, auf dem Befehle eingeblendet wurden.
Es ging dann weiter mit der Marantz RC2000 und irgendwann kam dann die erste Pronto. Es folgten Geräte von Logitech, Philips (die berüchtigte RC9800i), ein Siemens Simpad mit RemoteControl2 Software und jetzt schließlich die SRT9320.
Warum ich die Geräte alle aufzähle? Ganz einfach: bisher habe ich immer noch nicht die perfekte Fernbedienung gefunden. Irgendetwas hat mich immer gestört und leider ist es mit der neuen Philips nicht anders.
An sich ist die SRT9320 ein tolles Gerät: helles und scharfes Display, guter Druckpunkt der Hard-Keys, klasse Verarbeitung. Wenn man sich dann aber näher mit ihrer Programmierung beschäftigt (die direkt auf der FB stattfindet und keinen PC voraussetzt), dann scheint es, als ob mit zunehmender Komplexität der Programmierung manche Funktionen nicht mehr richtig funktionieren.
Im Einzelnen bereiten mir folgende Punkte Kopfzerbrechen:
- Irgendwann funktioniert die Verschiebung der Tasten auf dem Display nicht mehr richtig. Soll heißen: ich kann sie zwar verschieben, wenn ich dann aber speichere, werden die Tasten wieder an die Positionen gesetzt, auf denen sie vor dem Verschieben standen. Ab diesem Punkt muss man nach dem Verschieben jeder einzelnen Taste speichern.
- Irgendwann klappt die Makrofunktion nicht mehr richtig, was sich dadurch äußert, dass das Startmakro einer Aktivität jedes Mal neu gestartet wird, selbst wenn man die Aktivität gar nicht verlassen hat. Also: ich bin in der Aktivität "DVD anschauen". Dann möchte ich am Beamer eine Einstellung vornehmen, die jedoch mit den Tasten, die der Aktivität zugeordnet sind, nicht gemacht werden kann. Ich wechsele also auf das Gerät "Beamer", mache meine Einstellung und wenn ich dann wieder zurück auf "DVD schauen" gehe, wird diese Aktivität wieder neu gestartet. Dumm, wenn z.B. der DVD-Player nur eine Taste zum ein- und ausschalten hat, denn in diesem Fall wird er dann mitten im Film einfach abgeschaltet.
- Manche Tasten, die unter einem Gerät angelernt worden sind, lassen sich nicht in Aktivitäten einfügen. Es wird zwar eine Taste eingefügt, es ist aber nicht die, die ich an sich ausgewählt habe.
Das wirkliche Problem liegt aber darin, dass ich bisher noch nicht herausfinden konnte, ab wann die o.g. Punkte auftreten. Irgendwann ist es einfach so weit.
Fazit: die SRT9320 ist eine tolle Fernbedienung und könnte durch zukünftige Firmware-Updates noch wesentlich besser werden. Leider liest man in den im Moment zahlreich erscheinenden Tests nichts von o.g. Problemen. Meine Anlage ist jetzt nicht so groß, daher gehe ich davon aus, dass jeder der sich mal 2 Stunden mit der FB beschäftigt, die gleichen Beobachtungen machen wird.
Viele Grüße
Markus
ich hatte mir vor ein paar Wochen ja eine Philips SRT9320 geholt, weil ich einfach nicht an schönen Fernbedienungen vorbeigehen kann. Das fing schon 1993 an als ich meinen ersten AV-Receiver gekauft hatte und ich es blöd fand, mit 3 Fernbedienungen rumzuhantieren. Damals war es eine FB von Denon, die schon ein LCD-Display hatte, auf dem Befehle eingeblendet wurden.
Es ging dann weiter mit der Marantz RC2000 und irgendwann kam dann die erste Pronto. Es folgten Geräte von Logitech, Philips (die berüchtigte RC9800i), ein Siemens Simpad mit RemoteControl2 Software und jetzt schließlich die SRT9320.
Warum ich die Geräte alle aufzähle? Ganz einfach: bisher habe ich immer noch nicht die perfekte Fernbedienung gefunden. Irgendetwas hat mich immer gestört und leider ist es mit der neuen Philips nicht anders.
An sich ist die SRT9320 ein tolles Gerät: helles und scharfes Display, guter Druckpunkt der Hard-Keys, klasse Verarbeitung. Wenn man sich dann aber näher mit ihrer Programmierung beschäftigt (die direkt auf der FB stattfindet und keinen PC voraussetzt), dann scheint es, als ob mit zunehmender Komplexität der Programmierung manche Funktionen nicht mehr richtig funktionieren.
Im Einzelnen bereiten mir folgende Punkte Kopfzerbrechen:
- Irgendwann funktioniert die Verschiebung der Tasten auf dem Display nicht mehr richtig. Soll heißen: ich kann sie zwar verschieben, wenn ich dann aber speichere, werden die Tasten wieder an die Positionen gesetzt, auf denen sie vor dem Verschieben standen. Ab diesem Punkt muss man nach dem Verschieben jeder einzelnen Taste speichern.
- Irgendwann klappt die Makrofunktion nicht mehr richtig, was sich dadurch äußert, dass das Startmakro einer Aktivität jedes Mal neu gestartet wird, selbst wenn man die Aktivität gar nicht verlassen hat. Also: ich bin in der Aktivität "DVD anschauen". Dann möchte ich am Beamer eine Einstellung vornehmen, die jedoch mit den Tasten, die der Aktivität zugeordnet sind, nicht gemacht werden kann. Ich wechsele also auf das Gerät "Beamer", mache meine Einstellung und wenn ich dann wieder zurück auf "DVD schauen" gehe, wird diese Aktivität wieder neu gestartet. Dumm, wenn z.B. der DVD-Player nur eine Taste zum ein- und ausschalten hat, denn in diesem Fall wird er dann mitten im Film einfach abgeschaltet.
- Manche Tasten, die unter einem Gerät angelernt worden sind, lassen sich nicht in Aktivitäten einfügen. Es wird zwar eine Taste eingefügt, es ist aber nicht die, die ich an sich ausgewählt habe.
Das wirkliche Problem liegt aber darin, dass ich bisher noch nicht herausfinden konnte, ab wann die o.g. Punkte auftreten. Irgendwann ist es einfach so weit.
Fazit: die SRT9320 ist eine tolle Fernbedienung und könnte durch zukünftige Firmware-Updates noch wesentlich besser werden. Leider liest man in den im Moment zahlreich erscheinenden Tests nichts von o.g. Problemen. Meine Anlage ist jetzt nicht so groß, daher gehe ich davon aus, dass jeder der sich mal 2 Stunden mit der FB beschäftigt, die gleichen Beobachtungen machen wird.
Viele Grüße
Markus
Hallo zusammen! :-)
18. Juni 2009Nachdem ich mich so lange dagegen gewehrt habe, fange ich jetzt hier einfach einmal an zu bloggen :-) Ich hoffe, dass der Kram, den ich so schreiben werde, nicht zu langweilig sein wird. Wenn er es ist, dann bitte melden.
Auf vielfachen Wunsch habe ich heute ein paar Bilder meines Kinokellers hochgeladen, viel Spaß beim Betrachten. Wer noch mehr sehen möchte, der kann auch mal unter
web.me.com/mschuetze
vorbeischauen.
Diese Seite hatte ich irgendwann mal angefangen, weil mich die Kollegen im Büro jeden Montag immer gefragt haben, was ich am Wochenende so im Keller getrieben habe.
In diese Sinne noch mal viel Spaß und viele Grüße
Markus
P.S.: Kommentare und Anregungen sind AUSDRÜCKLICH erwünscht!
Auf vielfachen Wunsch habe ich heute ein paar Bilder meines Kinokellers hochgeladen, viel Spaß beim Betrachten. Wer noch mehr sehen möchte, der kann auch mal unter
web.me.com/mschuetze
vorbeischauen.
Diese Seite hatte ich irgendwann mal angefangen, weil mich die Kollegen im Büro jeden Montag immer gefragt haben, was ich am Wochenende so im Keller getrieben habe.
In diese Sinne noch mal viel Spaß und viele Grüße
Markus
P.S.: Kommentare und Anregungen sind AUSDRÜCKLICH erwünscht!
Top Angebote
Retro-Markus
Aktivität
Forenbeiträge18
Kommentare249
Blogbeiträge37
Clubposts0
Bewertungen117
Mein Avatar
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(7)
(37)
Kommentare
Antec AV Cooler - Hifi-Kompo …
von Martin.Schneider
am https://de.idealsvdr.c…
Der Blog von Retro-Markus wurde 54.938x besucht.