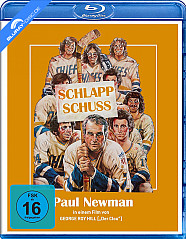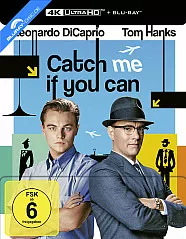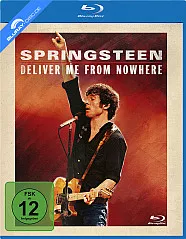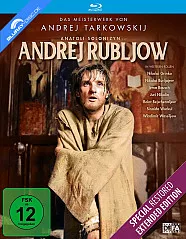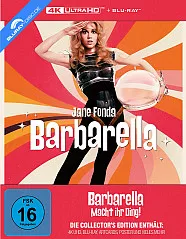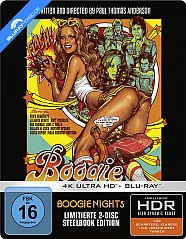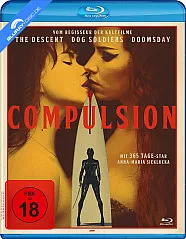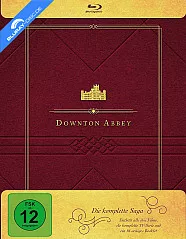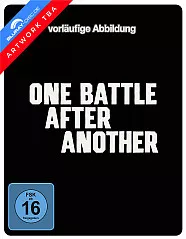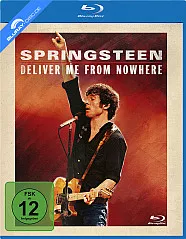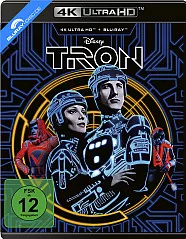"Manche mögen’s heiß" von Billy Wilder: Ab sofort auf Ultra HD Blu-ray im Mediabook vorbestellbar"Alien: Romulus": Ab 24. April 2026 bei Amazon und im Leonine Studios Shop auf UHD Blu-ray im Steelbook - UPDATE 3"Scream" von Wes Craven: Im Februar 2026 wieder auf Ultra HD Blu-ray im Steelbook erhältlich - UPDATE"Ein fast perfekter Antrag" mit Iris Berben und Heiner Lauterbach: Ab 26.02. im Kino und im Juli 2026 auf Blu-ray2026 von Warner Home Video auf UHD Blu-ray: Vorschau auf kommende 4K-Premieren"Wrong Turn - The Foundation" ab 21.12. auf UHD Blu-ray im Mediabook mit Sammelschuber vorbestellbarSTC-Medienpool übernimmt Vertrieb von MaRuMi FilmMotion"Dogma": Kult-Komödie erscheint auch in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray"Turbine Weihnachtsrakete 2025": Letzte Phase mit Rabatten von bis zu 44% gestartet"Capelight Adventskalender"-Tag 19: "3 für 33€"-Aktion mit Klassikern auf UHD Blu-ray in Keep Cases
NEWSTICKER
Filmbewertungen von kleinhirn
Durch den ersten Teil bereits auf das mit meinem Geschmack unkompatiblen Humorniveau vorgewarnt, lieferte ich mich erneut dem infantilen Witzelinferno aus.
Und? Hat man es erst einmal geschafft seinen eigenen Anspruch temporär zu verleugnen, kann einem der pubertierende Humor sogar hier und dort einmal ein verschmitztes Schmunzeln abringen.
Ansonsten werd ich mit den ganzen Gummifiguren der Guardians nicht wirklich warm, kann mich aber an den bombastischen Weltraumsequenzen köstlich ergötzen. Auch wenn das Finale meine langsam verrotenden Sinne maßlos überfordert, ist der zweite Teil visuell eine epische Spaceoper, die mich aufs trefflichste für die Dauer von 2Std aus der Realität entführt hat.
Und? Hat man es erst einmal geschafft seinen eigenen Anspruch temporär zu verleugnen, kann einem der pubertierende Humor sogar hier und dort einmal ein verschmitztes Schmunzeln abringen.
Ansonsten werd ich mit den ganzen Gummifiguren der Guardians nicht wirklich warm, kann mich aber an den bombastischen Weltraumsequenzen köstlich ergötzen. Auch wenn das Finale meine langsam verrotenden Sinne maßlos überfordert, ist der zweite Teil visuell eine epische Spaceoper, die mich aufs trefflichste für die Dauer von 2Std aus der Realität entführt hat.
mit 4
mit 5
mit 4
mit 3
bewertet am 26.01.18 um 22:18
Nettes Amüsement, welches das schwierige Verhältnis zwischen unseren liebsten Haustieren auf die Schippe nimmt. Im Rahmen einer James Bond Parodie geben sich gelungene Gags, Albernheiten und allerlei Klischees die Klinke in die Hand.
In erster Linie lebt der Film von seiner charmanten Machart. Die Erzählstruktur selbst ist etwas zäh und abgehackt, besinnt sich auf die einzelnen Scenen, die so wie einzelne Sketche wirken.
Was soll's der Film ist launig und macht Groß und Klein gleichermaßen Spaß.
Das 3D Bild schwankt zwischen grad noch erträglich und schluderig schlecht. Das trübt die Sehfreude im 3D Modus merklich. Geistige Benommenheit nach dem Film ist garantiert, Kopfschmerzen sind gut möglich.
Ein kleines 3D Looney Toones Schmankerl gibt's als Entschädigung dafür Gratis.
In erster Linie lebt der Film von seiner charmanten Machart. Die Erzählstruktur selbst ist etwas zäh und abgehackt, besinnt sich auf die einzelnen Scenen, die so wie einzelne Sketche wirken.
Was soll's der Film ist launig und macht Groß und Klein gleichermaßen Spaß.
Das 3D Bild schwankt zwischen grad noch erträglich und schluderig schlecht. Das trübt die Sehfreude im 3D Modus merklich. Geistige Benommenheit nach dem Film ist garantiert, Kopfschmerzen sind gut möglich.
Ein kleines 3D Looney Toones Schmankerl gibt's als Entschädigung dafür Gratis.
mit 3
mit 4
mit 3
mit 3
bewertet am 26.01.18 um 22:11
Voll weniger geile Ärsche als davor. Viel Brumm. Und wer Bier, dann Corona. Und auch Familie is voll wichtig, näh, aber auch Respect haben! Super Männer und gemein total Frau. Aber gerächt Ende!!!!!!!!! Wahnsinn Stunt aber auch Schpezialeffekt, glaub ich! Und U-Boot wohl nicht wahr, oder?
Nachdem ich mich jahrelang gescheut habe, mich der Tuningfamilie anzuschließen, war es neulich dann soweit. Teil 8 derTurbosaga hat sich den Weg in meinen Player erschlichen.
Und was muß ich sagen? Hirnlose Action und Stuntakrobatik ala Mission Impossible/A Team. Der Steigerungslogik folgend gibt's im 8ten Teil furioses und kurioses am Fließband.
Insgesamt also sehr gute over the top Unterhaltung im unteren Bereich der Intellektuellenskala. Und wohl nur Maschinenbauingenieure werden wohl wirklich wißen, welchen Effekt die endlosen Schalthebel-Tacho-Gaspedal Schnitte auf die Umdrehungszahlen haben werden und so geheimnisvoll schmunzelnd in den vollen Genuß des Filmes kommen.
Nachdem ich mich jahrelang gescheut habe, mich der Tuningfamilie anzuschließen, war es neulich dann soweit. Teil 8 derTurbosaga hat sich den Weg in meinen Player erschlichen.
Und was muß ich sagen? Hirnlose Action und Stuntakrobatik ala Mission Impossible/A Team. Der Steigerungslogik folgend gibt's im 8ten Teil furioses und kurioses am Fließband.
Insgesamt also sehr gute over the top Unterhaltung im unteren Bereich der Intellektuellenskala. Und wohl nur Maschinenbauingenieure werden wohl wirklich wißen, welchen Effekt die endlosen Schalthebel-Tacho-Gaspedal Schnitte auf die Umdrehungszahlen haben werden und so geheimnisvoll schmunzelnd in den vollen Genuß des Filmes kommen.
mit 4
mit 5
mit 4
mit 2
bewertet am 26.01.18 um 19:08
Alles Andere als seichte Unterhaltung.
Wenders avantgardistische Hommage an Berlins Subkultur und kleine Betrachtungen der metaphysischen Philosophie ist mitunter schwere, karge Kost, die mit klassischem Unterhaltungskino wenig gemein hat.
Ohne Drehbuch, frei assoziert, erzählt Wenders die Geschichte des Engels Damiel, der des Lebens als geistiges Wesen überdrüssig wird, als er der attraktiven und sensiblen Circusartistin Marion begegnet. Die Sehnsucht nach sensorischen Erfahrungen und den Leidenschaften der Liebe, läßt in Damiel die Begierde reifen, sich in eine Daseinsform aus Fleisch und Blut zu inkarnieren.
Äonen wachen Damiel und sein Engelfreund Cassiel über die Welt. Isoliert und einsam. Der feinstofflichen Existenz und des zeitlosen Seins überdrüssig, entscheidet sich Damiel für die flüchtigen Augenblicke irdischen Glückes...
Ohne die Kameraarbeit von Henri Alekan, wäre dieses poetische Mosaik aus Gedankenfragmenten, Seinsphilosophie, verlorenem Kinderglück und experimentellem Kino nur schwer verdaulich. In oftmals tottraurigen aber hypnotisch fesselnden schwarz/weiß Bildern von trostlosen Hinterhöfen, kriegsvernarbten Gemäuern, verwitterter Großstadtarchitektur und schmuddeligen Häuserfassaden erschafft Alekan eine morbid-meditative Stimmung die an die verlassenen Ghettos nordenglischer Bergbausiedlungen erinnert oder an Schimanskis halb verfallene Hafenviertel.
Das im Film auch Konzerte von Nick Cave eine Schlüßelrolle einnehmen, ist sicherlich kein Zufall und unterstützt musikalisch thematisch die depressive Grundstimmung der hier näher beleuchteten Randkultur.
Alekans Bilder hingegen sind ein melancholisches Kunstwerk für sich, in denen sich der ganze Großstadtblues von Hoffnung, Verzweiflung, Verfall und Einsamkeit wiederspiegeln und somit auch die Traurigkeit des Engels oder von Marion symbolisieren.
Die lähmende Zähigkeit der Inszenierung und der Verzicht auf fast jegliche gewohnte Spannungskultur, erzeugt jedoch trotz der phantastischen Bilder, im nicht auf dieses cineastische Ausnahmewerk eingestimmten Zuschauer ein erhebliches Maß an verstörendem Desinteresse. Einziger erzählerischer Lichtblick in diesem filmischen Stimmungsgemälde sind die Auftritte des US Schauspielers Peter Falk (Columbo), der als Ex-Engel Akzente zu setzen weiß und dem Independantstreifen zu internationaler Größe verhilft.
Was nach 30 Jahren bleibt, ist ein nostalgischer Rückblick auf das Berlin vor Wiedervereinigung und Wiederaufbau Ost Finanzspritzen, als die Stadt noch Untergrund, subversiven Charme und ein ruppiges Ambiente hatte, bevor die Industrie, das Geld und die Kaufhausketten die Seele der Stadt töteten und sie durch perverse Unmengen smarten Geldes zum Zentrum der Start-Up Scene und, Craft Beer brauenden Großstadtclone mit Hipster Hauptbehaarung wurde.
Auch David Lynch bediente sich der gleichen Vorgehensweise, sich vom Kuss der Muse während der Dreharbeiten leiten zu lassen. Was bei dem Amerikaner aber meistens in einem überwältigenden Erlebnis einer (alb)traumhaften verwobenen, in sich stimmigen irrationalen und dem Wahnsinn verstörend nahem Gesamtkunstwerk gipfelte, ist bei Wenders Stückwerk mit nur partiell überzeugenden Elementen. Wenders Werk ist zu brav und deutschintellektuell und erhält zu wenig außergewöhnliche Überraschungsmomente, um den Zuschauer während der gesamten Spieldauer von 124min in den Bann zu ziehen.
Fast schien es mir, als sollten die trancigen Bilder Alekans die Aufmerksamkeit des Zuschauers an sich binden, um ihn von den vielen blutleeren Verlegenheitsmomenten abzulenken und dem Regisseur die Luft zum Nachdenken zu verschaffen, die er braucht, sich Gedanken über ein glimpflichen Ausgang des Filmes machen zu können.
Interessant ist dabei, das es gerade die Inhaltliche Leere ist, die dem Film dazu verhalf, sich in intellektuellen Kreisen Kultstatus zu verschaffen.
Ein Jeder konnte so eben seinen halbgaren Studierstübchenquatsch in die kryptischen Anfängeresoterikfragmente Wenders hineininterpretieren und die angedeutete Metaphysik zu seinen Gunsten ungestraft weiterspinnen...
Wenders avantgardistische Hommage an Berlins Subkultur und kleine Betrachtungen der metaphysischen Philosophie ist mitunter schwere, karge Kost, die mit klassischem Unterhaltungskino wenig gemein hat.
Ohne Drehbuch, frei assoziert, erzählt Wenders die Geschichte des Engels Damiel, der des Lebens als geistiges Wesen überdrüssig wird, als er der attraktiven und sensiblen Circusartistin Marion begegnet. Die Sehnsucht nach sensorischen Erfahrungen und den Leidenschaften der Liebe, läßt in Damiel die Begierde reifen, sich in eine Daseinsform aus Fleisch und Blut zu inkarnieren.
Äonen wachen Damiel und sein Engelfreund Cassiel über die Welt. Isoliert und einsam. Der feinstofflichen Existenz und des zeitlosen Seins überdrüssig, entscheidet sich Damiel für die flüchtigen Augenblicke irdischen Glückes...
Ohne die Kameraarbeit von Henri Alekan, wäre dieses poetische Mosaik aus Gedankenfragmenten, Seinsphilosophie, verlorenem Kinderglück und experimentellem Kino nur schwer verdaulich. In oftmals tottraurigen aber hypnotisch fesselnden schwarz/weiß Bildern von trostlosen Hinterhöfen, kriegsvernarbten Gemäuern, verwitterter Großstadtarchitektur und schmuddeligen Häuserfassaden erschafft Alekan eine morbid-meditative Stimmung die an die verlassenen Ghettos nordenglischer Bergbausiedlungen erinnert oder an Schimanskis halb verfallene Hafenviertel.
Das im Film auch Konzerte von Nick Cave eine Schlüßelrolle einnehmen, ist sicherlich kein Zufall und unterstützt musikalisch thematisch die depressive Grundstimmung der hier näher beleuchteten Randkultur.
Alekans Bilder hingegen sind ein melancholisches Kunstwerk für sich, in denen sich der ganze Großstadtblues von Hoffnung, Verzweiflung, Verfall und Einsamkeit wiederspiegeln und somit auch die Traurigkeit des Engels oder von Marion symbolisieren.
Die lähmende Zähigkeit der Inszenierung und der Verzicht auf fast jegliche gewohnte Spannungskultur, erzeugt jedoch trotz der phantastischen Bilder, im nicht auf dieses cineastische Ausnahmewerk eingestimmten Zuschauer ein erhebliches Maß an verstörendem Desinteresse. Einziger erzählerischer Lichtblick in diesem filmischen Stimmungsgemälde sind die Auftritte des US Schauspielers Peter Falk (Columbo), der als Ex-Engel Akzente zu setzen weiß und dem Independantstreifen zu internationaler Größe verhilft.
Was nach 30 Jahren bleibt, ist ein nostalgischer Rückblick auf das Berlin vor Wiedervereinigung und Wiederaufbau Ost Finanzspritzen, als die Stadt noch Untergrund, subversiven Charme und ein ruppiges Ambiente hatte, bevor die Industrie, das Geld und die Kaufhausketten die Seele der Stadt töteten und sie durch perverse Unmengen smarten Geldes zum Zentrum der Start-Up Scene und, Craft Beer brauenden Großstadtclone mit Hipster Hauptbehaarung wurde.
Auch David Lynch bediente sich der gleichen Vorgehensweise, sich vom Kuss der Muse während der Dreharbeiten leiten zu lassen. Was bei dem Amerikaner aber meistens in einem überwältigenden Erlebnis einer (alb)traumhaften verwobenen, in sich stimmigen irrationalen und dem Wahnsinn verstörend nahem Gesamtkunstwerk gipfelte, ist bei Wenders Stückwerk mit nur partiell überzeugenden Elementen. Wenders Werk ist zu brav und deutschintellektuell und erhält zu wenig außergewöhnliche Überraschungsmomente, um den Zuschauer während der gesamten Spieldauer von 124min in den Bann zu ziehen.
Fast schien es mir, als sollten die trancigen Bilder Alekans die Aufmerksamkeit des Zuschauers an sich binden, um ihn von den vielen blutleeren Verlegenheitsmomenten abzulenken und dem Regisseur die Luft zum Nachdenken zu verschaffen, die er braucht, sich Gedanken über ein glimpflichen Ausgang des Filmes machen zu können.
Interessant ist dabei, das es gerade die Inhaltliche Leere ist, die dem Film dazu verhalf, sich in intellektuellen Kreisen Kultstatus zu verschaffen.
Ein Jeder konnte so eben seinen halbgaren Studierstübchenquatsch in die kryptischen Anfängeresoterikfragmente Wenders hineininterpretieren und die angedeutete Metaphysik zu seinen Gunsten ungestraft weiterspinnen...
mit 3
mit 4
mit 3
mit 3
bewertet am 15.01.18 um 11:36
Kleines Horrorfilmchen mit 3, 4 netten Effekten, welches impoppigen Gewand einer Teeniekomödie angeboten wird, so daß der Unterhaltungsfaktor stimmt, jedoch leine Gruselathmosphäre erzeugt wird.
Das Ambiente des 80er Jahre Mainstreem Horrorfilms distanzierte sich vom schmuddeligen Bahnhofskinolook und wurde sauber und vorzeigbar und eignete sich zur besten Familienunterhaltung im heimischen Wohnzimmer.
Das der Film heute noch ab 18 Jahren freigegeben ist, ist natürlich eine Witznummer. In wenigen Momenten wird ihn dasselbe Schicksal ereilen, wie es dereinst Dracula, Der Wolfsmensch und co. widerfahren ist: es wird mit einem anerkennenden Lächeln aufgenommen, dient jedoch mehr dem Amüsement denn der Nervenkitzelei.
Obwohl der Blob wahrscheinlich nicht länger als 3 Minuten zu sehen ist und die Effekte anachronistisch wirken, steht er doch exemplarisch für die 80er Jahre und bedient so das Nostalgiebedürfnis der langsam der Zerfäulnis ausgesetzten Generationen...
Das Ambiente des 80er Jahre Mainstreem Horrorfilms distanzierte sich vom schmuddeligen Bahnhofskinolook und wurde sauber und vorzeigbar und eignete sich zur besten Familienunterhaltung im heimischen Wohnzimmer.
Das der Film heute noch ab 18 Jahren freigegeben ist, ist natürlich eine Witznummer. In wenigen Momenten wird ihn dasselbe Schicksal ereilen, wie es dereinst Dracula, Der Wolfsmensch und co. widerfahren ist: es wird mit einem anerkennenden Lächeln aufgenommen, dient jedoch mehr dem Amüsement denn der Nervenkitzelei.
Obwohl der Blob wahrscheinlich nicht länger als 3 Minuten zu sehen ist und die Effekte anachronistisch wirken, steht er doch exemplarisch für die 80er Jahre und bedient so das Nostalgiebedürfnis der langsam der Zerfäulnis ausgesetzten Generationen...
mit 3
mit 3
mit 4
mit 1
bewertet am 31.12.17 um 12:07
Ach ja, was soll man zu dem Film nur großartig sagen?
Machen wir's mal kurz. Valerian bietet Top Unterhaltung auf simplen Niveau. Die Geschichte ist weder komplex noch tiefsinnig, so daß der Sog in Luc Bessons phantastische Welt Valerians ausbleibt. Das ist bedauerlich, da man sich mit dem Entwurf von Alpha, der Raumstation der Tausend Planeten, doch so richtig Mühe gemacht hat. Die Wesen und ihre jeweils spezifischen Habitate sind akribisch ausgeklügelt und monströs in Scene gesetzt. Schauwerte mit erheblichen Unterhaltungcharakter geben sich hier am Fließband die Klinke in die Hand.
Woran es dem Film jedoch wirklich mangelt, ist Substanz. Hier bewahrheitet sich mal wieder die alte Beobachtung, daß sich Comics nicht so ohne weiteres in ein anderes Medium transportieren lassen. Was im Graphic Novel in seiner kindgerechten Einfachheit noch funktioniert, wirkt auf der "realen" Ebene einfach zu dünn. Auch wenn die Rahmenhandlung mit der ausgelöschten Alienkultur und den Machtkämpfen auf Kommandoebene noch ansatzweise seriös sind, reißen einige Passagen mit ihrem Klamauk das Niveau der Geschichte wieder in den Keller.
Ist dies aber noch entschuldbar, ist es der gröbste Schnitzer des Filmes nicht: Die Hauptdarsteller. Kann man Dane DeHaan als Valerian noch ein gewißes schauspielerisches Spektrum attestieren, gelingt dies bei seinem Sidekick Cara de Levingne als Laureline jedoch schon nicht mehr. Steif und auffallend limitiert in ihrer Ausdrucksweise kann sie nur das verkörpern, was ihr auch im wirklichen Leben eigen ist: eine kühle selbstgefällige Topmodelzicke.
Auch paßt diese gesamte unausgereifte Liebesgeschichte irgendwie überhaupt nicht in diese überbordene Science-Fiction Welt. Sie ist für den Film einfach viel zu klein und unbedeutend und interessiert im Grunde genommen keine Sau. Auch prallen sämtliche Emphatiebemühungen an der arrogant wirkenden Cara ab, wie Griebenschmalz an einer Teflonpfanne, so daß jede Identifikationstendenzen schon im Ansatz zum scheitern veurteilt sind.
Hier hat Besson also einen schweren Fehler begangen, wahrscheinlich weil er einem seiner Lieblingscomics keinen Verrat antun wollte...
Seis drum. Trotz der groben Fehler in der Umsetzung ist Valerian ist nichts Halbes und nichts Ganzes, eine Mixtur aus Schweine im Weltraum und einer guten Star Trek TNG Episode, muß man den Film vor allen als das sehen, was er selbst sein möchte: Eine leichte, berauschende Sinneserfahrung und Hommage an die Kreativität des Erschaffers. Betrachtet man das Werk also nicht literarisch, sondern mißt ihn an den eigenen Ansprüchen, so stellt Valerian ein cineastisches Vergnügen dar, welches selbst im Heimkino immer noch dankbares staunen erntet.
Die Aufmachung des Steelbooks ist unspektakulär bis einfallslos. Die 3D Effekte, gerade im Weltraum sind imponierend und endlich mal ohne Nachregulierung zu genießen. Die vielen Ghostings bei Nah- und Portäitaufnahmen sind dagegen schon eher ein Ärgernis gehobener Güte und trüben das Seherlebnis...
Machen wir's mal kurz. Valerian bietet Top Unterhaltung auf simplen Niveau. Die Geschichte ist weder komplex noch tiefsinnig, so daß der Sog in Luc Bessons phantastische Welt Valerians ausbleibt. Das ist bedauerlich, da man sich mit dem Entwurf von Alpha, der Raumstation der Tausend Planeten, doch so richtig Mühe gemacht hat. Die Wesen und ihre jeweils spezifischen Habitate sind akribisch ausgeklügelt und monströs in Scene gesetzt. Schauwerte mit erheblichen Unterhaltungcharakter geben sich hier am Fließband die Klinke in die Hand.
Woran es dem Film jedoch wirklich mangelt, ist Substanz. Hier bewahrheitet sich mal wieder die alte Beobachtung, daß sich Comics nicht so ohne weiteres in ein anderes Medium transportieren lassen. Was im Graphic Novel in seiner kindgerechten Einfachheit noch funktioniert, wirkt auf der "realen" Ebene einfach zu dünn. Auch wenn die Rahmenhandlung mit der ausgelöschten Alienkultur und den Machtkämpfen auf Kommandoebene noch ansatzweise seriös sind, reißen einige Passagen mit ihrem Klamauk das Niveau der Geschichte wieder in den Keller.
Ist dies aber noch entschuldbar, ist es der gröbste Schnitzer des Filmes nicht: Die Hauptdarsteller. Kann man Dane DeHaan als Valerian noch ein gewißes schauspielerisches Spektrum attestieren, gelingt dies bei seinem Sidekick Cara de Levingne als Laureline jedoch schon nicht mehr. Steif und auffallend limitiert in ihrer Ausdrucksweise kann sie nur das verkörpern, was ihr auch im wirklichen Leben eigen ist: eine kühle selbstgefällige Topmodelzicke.
Auch paßt diese gesamte unausgereifte Liebesgeschichte irgendwie überhaupt nicht in diese überbordene Science-Fiction Welt. Sie ist für den Film einfach viel zu klein und unbedeutend und interessiert im Grunde genommen keine Sau. Auch prallen sämtliche Emphatiebemühungen an der arrogant wirkenden Cara ab, wie Griebenschmalz an einer Teflonpfanne, so daß jede Identifikationstendenzen schon im Ansatz zum scheitern veurteilt sind.
Hier hat Besson also einen schweren Fehler begangen, wahrscheinlich weil er einem seiner Lieblingscomics keinen Verrat antun wollte...
Seis drum. Trotz der groben Fehler in der Umsetzung ist Valerian ist nichts Halbes und nichts Ganzes, eine Mixtur aus Schweine im Weltraum und einer guten Star Trek TNG Episode, muß man den Film vor allen als das sehen, was er selbst sein möchte: Eine leichte, berauschende Sinneserfahrung und Hommage an die Kreativität des Erschaffers. Betrachtet man das Werk also nicht literarisch, sondern mißt ihn an den eigenen Ansprüchen, so stellt Valerian ein cineastisches Vergnügen dar, welches selbst im Heimkino immer noch dankbares staunen erntet.
Die Aufmachung des Steelbooks ist unspektakulär bis einfallslos. Die 3D Effekte, gerade im Weltraum sind imponierend und endlich mal ohne Nachregulierung zu genießen. Die vielen Ghostings bei Nah- und Portäitaufnahmen sind dagegen schon eher ein Ärgernis gehobener Güte und trüben das Seherlebnis...
mit 4
mit 5
mit 5
mit 3
bewertet am 28.12.17 um 18:33
Einschläfernde Rittersaga, mit Nüschts, was man von einem Mittelalterspektakel erwarten könnte.
Statt Erzböser Intrigen nur lauwarmes Ränkespiel, statt epochaler Schlachten nur steife Duelle. Einschläfernd bräsige Hinterkammermusik statt schmetternde Fanfareneruptionen.
Die Handlung: schablonenhafte Dutzendware! Ein Geschwisterpärchen flieht vor einem wollüstigen Adelsmann in die benachbarte Ritterburg, nicht aber ohne vorher noch einen geheimnisvollen Ring und einen Brief mit auf den Weg bekommen zu haben, in dem geschrieben steht, daß der Burgherr dem Verfasser des Briefes (dem Vater der Geschwister) noch ein Gefallen schuldig sei. Der Bruder verliebt sich in die holde Burgdame, wird aber vom Rest des Hofes mit Jugendherbergstreichen gemobbt. Die Schwester veliebt sich in seinen einzigen Verbündeten, einem holden Knappen, voll und frisch von Tugend! Am Ende gibts noch den bösen Lehnsherren, der behauptet, der Vater sei ein Verräter und in Ungnade gefallen. Der Bruder, mittlerweile zum Ritter ausgebildet sagt aber: stimmt nicht! Also Kampf. Der Bruder gewinnt und es wird geheiratet. Am Ende sind alle glücklich und lachen und knutschen sich!
Der eiserne Ritter von Falworth geht zwar mit einer Riege A-Promis (Tony Curtis, Janeth Leigh) an den Start, verspielt mit seiner ereignisarmen Handlung und seinem nett-gefälligen Stil aber jeden Kredit. Vorsichhinplätschernde, leiernd-monotone Bratschen Musik mag zwar ein Gefühl für das wirkliche, träge vor sich dahin wälzende Leben im Mittelalter vermitteln, dient aber hier in erster Linie als Grundlage für zwei sich anbahnende Liebesgeschichten, deren Züchtigkeit 1954 noch wohlfeil gewesen sein mag, deren Behäbigkeit heute jedoch anödet.
Der eiserne Ritter ist allerdings kein kompletter Totalausfall, auch wenn die typischen Monumentalscenen mit seinen wuchtigen Kulissen fehlen. Sein Downtempo und seine Harmlosigkeit sind allerdings ist schon gewöhnungsbedürftig und spiegeln eher die Muffigkeit der 50er Jahre Nachkriegszeit Nierentischsittendebatten wieder, als das es das Genre progressiv nach vorne beschleunigen würde. Mit seiner überschaubar komplexen Handlung und der unaufgeregten Inszenierung mit seinen nur keusch angedeuteten Pikanterien könnte der Eiserne Ritter von Falsworth wohl zu Oma und Opas Lieblingsfilm avancieren. Der Übergang zum anschlie?enden Nachmittagsnickerchen im beheizten Ohrensessel dürfte wohl nahtlos verlaufen..
Womit der Film aber auf jeden Fall punkten kann, ist seine Farbgebung. Die Bilder schwelgen im sattesten Technicolor und die Augen baden in einer Bilderpracht, von der man sich kaum mehr lösen mag.
Wäre die Welt doch nur wirklich so schön, ach, was wären wir alle glücklich...
Statt Erzböser Intrigen nur lauwarmes Ränkespiel, statt epochaler Schlachten nur steife Duelle. Einschläfernd bräsige Hinterkammermusik statt schmetternde Fanfareneruptionen.
Die Handlung: schablonenhafte Dutzendware! Ein Geschwisterpärchen flieht vor einem wollüstigen Adelsmann in die benachbarte Ritterburg, nicht aber ohne vorher noch einen geheimnisvollen Ring und einen Brief mit auf den Weg bekommen zu haben, in dem geschrieben steht, daß der Burgherr dem Verfasser des Briefes (dem Vater der Geschwister) noch ein Gefallen schuldig sei. Der Bruder verliebt sich in die holde Burgdame, wird aber vom Rest des Hofes mit Jugendherbergstreichen gemobbt. Die Schwester veliebt sich in seinen einzigen Verbündeten, einem holden Knappen, voll und frisch von Tugend! Am Ende gibts noch den bösen Lehnsherren, der behauptet, der Vater sei ein Verräter und in Ungnade gefallen. Der Bruder, mittlerweile zum Ritter ausgebildet sagt aber: stimmt nicht! Also Kampf. Der Bruder gewinnt und es wird geheiratet. Am Ende sind alle glücklich und lachen und knutschen sich!
Der eiserne Ritter von Falworth geht zwar mit einer Riege A-Promis (Tony Curtis, Janeth Leigh) an den Start, verspielt mit seiner ereignisarmen Handlung und seinem nett-gefälligen Stil aber jeden Kredit. Vorsichhinplätschernde, leiernd-monotone Bratschen Musik mag zwar ein Gefühl für das wirkliche, träge vor sich dahin wälzende Leben im Mittelalter vermitteln, dient aber hier in erster Linie als Grundlage für zwei sich anbahnende Liebesgeschichten, deren Züchtigkeit 1954 noch wohlfeil gewesen sein mag, deren Behäbigkeit heute jedoch anödet.
Der eiserne Ritter ist allerdings kein kompletter Totalausfall, auch wenn die typischen Monumentalscenen mit seinen wuchtigen Kulissen fehlen. Sein Downtempo und seine Harmlosigkeit sind allerdings ist schon gewöhnungsbedürftig und spiegeln eher die Muffigkeit der 50er Jahre Nachkriegszeit Nierentischsittendebatten wieder, als das es das Genre progressiv nach vorne beschleunigen würde. Mit seiner überschaubar komplexen Handlung und der unaufgeregten Inszenierung mit seinen nur keusch angedeuteten Pikanterien könnte der Eiserne Ritter von Falsworth wohl zu Oma und Opas Lieblingsfilm avancieren. Der Übergang zum anschlie?enden Nachmittagsnickerchen im beheizten Ohrensessel dürfte wohl nahtlos verlaufen..
Womit der Film aber auf jeden Fall punkten kann, ist seine Farbgebung. Die Bilder schwelgen im sattesten Technicolor und die Augen baden in einer Bilderpracht, von der man sich kaum mehr lösen mag.
Wäre die Welt doch nur wirklich so schön, ach, was wären wir alle glücklich...
mit 3
mit 4
mit 3
mit 1
bewertet am 28.12.17 um 18:17
Was man dem Film attestieren kann, ist: Er versprüht einen gewißen Charme. Ein üppig ausgestattetes New York der 20er Jahre und ein Dutzend sich klammheimlich an der Evolutionsleiter vorbeigemogelten Zauberwesen versetzen den Zuschauer in eine gemütliche Adventssonntagnachmittagswohlf ühlathmosphäre.
Hier liegt aber auch das prominente Haar in der Suppe. Der Film ist nicht frei von einer gewißen Behäbigkeit und ästhetischer Selbstgefälligkeit, bei der die Handlung das Nachsehen hat. So dümpelt der Film mindestens ein Drittel einfach vor sich hin, ohne daß Nennenswertes zu berichten wäre und dem Zuschauer nicht weiter übrig bleibt, als die filigranen digitalen Welten zu bestaunen.
Die Jagd nach den entfleuchten Zauberwesen entpuppt sich dabei nämlich weitgehend als kraftlose Zerstörungsorgie mit viel Schutt und mäßigen Unterhaltungswert. Zumindest sind die Zauberwesen erwartungsgemäß alle Top animiert, wenn auch nur bedingt phantastisch, denn J.K. Rowlings Fabelwesen sind zu sehr Plüschtiere mit spackigen Namen wie Fluffels oder Mokkelpops, als kreative Ausgeburten eines fantasiebegabten Literaturgenies...
Neben der Hauptlinie findet aber noch eine Paralellerzählung den Weg in die Geschichte: Der Obermagier sucht nach einem Obscurus, einem düsteren Energiewesen aus der Zauberwelt, welches der er für seine dunklen Pläne benutzen möchte.
Zunächst nur am Rande erwähnt, spielt sich dieser Handlungsfaden immer mehr in den Vordergrund, bis der Obskurus letztendlich sogar zur Hauptattraktion und zentralen Figur des Showdowns wird. Hier knallen dann gute und dunkle Materie mit einer Wucht aufeinander, die man so vielleicht nur im Finale eine X-Men Verfilmung erwartet hätte und dessen Showwert für so manches handzahme Geplänkel entschädigt.
Abschließend läßt sich sagen, daß Phantastische Tierwesen eine insgesamt seichte aber gut bekömmliche Kost bietet, deren wiederholte Besichtigung ich nicht ausschließen möchte.
Hier liegt aber auch das prominente Haar in der Suppe. Der Film ist nicht frei von einer gewißen Behäbigkeit und ästhetischer Selbstgefälligkeit, bei der die Handlung das Nachsehen hat. So dümpelt der Film mindestens ein Drittel einfach vor sich hin, ohne daß Nennenswertes zu berichten wäre und dem Zuschauer nicht weiter übrig bleibt, als die filigranen digitalen Welten zu bestaunen.
Die Jagd nach den entfleuchten Zauberwesen entpuppt sich dabei nämlich weitgehend als kraftlose Zerstörungsorgie mit viel Schutt und mäßigen Unterhaltungswert. Zumindest sind die Zauberwesen erwartungsgemäß alle Top animiert, wenn auch nur bedingt phantastisch, denn J.K. Rowlings Fabelwesen sind zu sehr Plüschtiere mit spackigen Namen wie Fluffels oder Mokkelpops, als kreative Ausgeburten eines fantasiebegabten Literaturgenies...
Neben der Hauptlinie findet aber noch eine Paralellerzählung den Weg in die Geschichte: Der Obermagier sucht nach einem Obscurus, einem düsteren Energiewesen aus der Zauberwelt, welches der er für seine dunklen Pläne benutzen möchte.
Zunächst nur am Rande erwähnt, spielt sich dieser Handlungsfaden immer mehr in den Vordergrund, bis der Obskurus letztendlich sogar zur Hauptattraktion und zentralen Figur des Showdowns wird. Hier knallen dann gute und dunkle Materie mit einer Wucht aufeinander, die man so vielleicht nur im Finale eine X-Men Verfilmung erwartet hätte und dessen Showwert für so manches handzahme Geplänkel entschädigt.
Abschließend läßt sich sagen, daß Phantastische Tierwesen eine insgesamt seichte aber gut bekömmliche Kost bietet, deren wiederholte Besichtigung ich nicht ausschließen möchte.
mit 3
mit 5
mit 4
mit 3
bewertet am 26.12.17 um 15:10
Sapperlot! Das nenn ich Nachhaltigkeit: Sämtliche Drehbuchkomponenten die den Alienautoren als unverkäuflich schienen, wurden von einem emsigen Volunteer wieder aus den Papiercontainern der Studios gefischt und zu einem Film gemanscht.
Im Science-Fiction Genre mit Logik zu argumentieren, kommt natürlich einer psychiatrischen Diagnose gleich. Dennoch, was dem Zuschauer hier an Dümmlichkeiten aufgetischt wird, erfüllt den Tatbestand der Beleidigung im juristischen Sinne zu genüge.
Wenn ein kleines Wesen (Kreuzung aus Tulpe und Fidgetspinner) sich minutenlang bei -273 Celsius quitschlebendig im Weltraum ohne Athmosphäre aufhält und dann mit einer Athmosphärenveränderung im Raumschiff außer Gefecht gesetzt werden soll, dann weißte Bescheid, wohin die Reise geht.
Von mir aus: Das Ambiente ist OK, der Stil stimmt. Auch wird ein kleines Gruselgefühl erzeugt, als sich der blinde Passagier durch die Körperöffnungen der Besatzung in deren Innereien schleicht und unter den lebenswichtigen Organen für berechtigten Unmut sorgt. Dem abgestumpften Sci-Fi Horror Experten entfleucht hier natürlich nicht viel mehr als ein gelangweilt nonchalantes Rülpserchen aus seiner aufgedunsenen Schips- und Colawampe.
Das die Crew dabei Beliebigkeitswert hat, ist noch nichtmal das Allerschlimmste. Die B-Promis erfüllen ihren Job zufriedenstellend. Das aber fast jeder neben seiner Astronautenmission noch einen zweiten Geheimauftrag hat, ist billigstes Plagiat und wirkt verzweifelt um erzählerische Tiefe bemüht.
So ist es dann wohl auch vor allem das Drehbuch, das dem Film um die doch ansehnlichen Effekte den Garaus macht.
Zumindest kann man ihm attestieren, daß er seiner Schwachsinnigkeit bis zum Ende treu bleibt. Der Höhepunkt kommt zum Schluß!
Spoiler!: Es sind noch zwei Rettungskapseln und zwei Besatzungsmitglieder übrig. Statt das jeder eine Kapsel nimmt, muß eine als Mausefalle herhalten und ein Crewmitglied muß sich opfern...
Ich dachte immer, als Astronaut muß man smart sein!
Meine Bewerbungsmappe geht morgen raus...
Im Science-Fiction Genre mit Logik zu argumentieren, kommt natürlich einer psychiatrischen Diagnose gleich. Dennoch, was dem Zuschauer hier an Dümmlichkeiten aufgetischt wird, erfüllt den Tatbestand der Beleidigung im juristischen Sinne zu genüge.
Wenn ein kleines Wesen (Kreuzung aus Tulpe und Fidgetspinner) sich minutenlang bei -273 Celsius quitschlebendig im Weltraum ohne Athmosphäre aufhält und dann mit einer Athmosphärenveränderung im Raumschiff außer Gefecht gesetzt werden soll, dann weißte Bescheid, wohin die Reise geht.
Von mir aus: Das Ambiente ist OK, der Stil stimmt. Auch wird ein kleines Gruselgefühl erzeugt, als sich der blinde Passagier durch die Körperöffnungen der Besatzung in deren Innereien schleicht und unter den lebenswichtigen Organen für berechtigten Unmut sorgt. Dem abgestumpften Sci-Fi Horror Experten entfleucht hier natürlich nicht viel mehr als ein gelangweilt nonchalantes Rülpserchen aus seiner aufgedunsenen Schips- und Colawampe.
Das die Crew dabei Beliebigkeitswert hat, ist noch nichtmal das Allerschlimmste. Die B-Promis erfüllen ihren Job zufriedenstellend. Das aber fast jeder neben seiner Astronautenmission noch einen zweiten Geheimauftrag hat, ist billigstes Plagiat und wirkt verzweifelt um erzählerische Tiefe bemüht.
So ist es dann wohl auch vor allem das Drehbuch, das dem Film um die doch ansehnlichen Effekte den Garaus macht.
Zumindest kann man ihm attestieren, daß er seiner Schwachsinnigkeit bis zum Ende treu bleibt. Der Höhepunkt kommt zum Schluß!
Spoiler!: Es sind noch zwei Rettungskapseln und zwei Besatzungsmitglieder übrig. Statt das jeder eine Kapsel nimmt, muß eine als Mausefalle herhalten und ein Crewmitglied muß sich opfern...
Ich dachte immer, als Astronaut muß man smart sein!
Meine Bewerbungsmappe geht morgen raus...
mit 2
mit 5
mit 5
mit 2
bewertet am 24.12.17 um 11:52
Eine Ehre, den Film als erstes Bewerten zu dürfen.
Eine Schande, daß die Bewertungsliste zweieinhalb Jahre nach seiner Veröffentlichung noch immer jungfräulich in den Katakomben des Forums schlummerte und nicht schon von Lobhudeleien auf den wohl besten Sportfilm aller Zeiten aus allen Poren triefte.
Der Film spielt zu einer Zeit, als Frauen noch echte Männer und Männer noch echte Dreckskerle waren. In den Venen pulsierte noch reines Adrenalin, statt die schlaffe vegane Gurkensmoothiebrühe unserer Ära.
Der unterklassige Eishockeyclub des Stahlarbeiterkaffs Charlestown dümpelt mehr recht als schlecht vor sich hin und unterhält mit seinem zwar ambitionierten aber wenig erfolgreichen Spiel nur eine handvoll gelangweilter Zuschauer. Verwunderlich ist das nicht, da Sport bei den Akteuren der Chiefs nur eine untergeordnete Rolle spielt. In erster Linie sind die Recken um den Trainer Reggie (Paul Newman) nämlich eher an anderen Dingen interessiert. Da wären an erster Stelle Alkohol und Frauen zu nennen. An zweiter Frauen und Alkohol. Sexismus war damals noch olympisch und Vorwürfe der "Me Too" Bewegung wurden als Auszeichnung verstanden.
Da dem Verein jedoch der Abstieg droht, verpflichtet der engagierte Manager drei neue Nachwuchshoffnungen: die Hanson Brüder. Mit ihrem Milchbubiaussehen und Faible für Kinderspielzeug stoßen die Neulinge allerdings zunächst auf Ablehnung und Skepsis bei Trainer und Teamkollegen. Erst als ein Stammspieler verprügelt das Feld verlassen muß, schlägt die Stunde der Newcomer. Und siehe: hinter den Streberfassaden stecken drei psychopathische Teufel. Untertrieben beschrieben könnte man sagen, die Spielphilosophie der Hanson Brüder zeichne sich durch eine gewiße Körperlichkeit aus. Korrekterweise muß es aber wohl heißen, die drei sind kleine, brutale Drecksäue. ABER: die Chiefs gewinnen wieder und was viel mehr zählt ist, daß das Feuer der Leidenschaft bei den Zuschauern wieder zu lodern beginnt.
Das neue Spektakel in der War Memorial Eisarena spricht sich schnell in Charlestown herum. Im Nu sind die Spiele der Chiefs ausverkauft und das ruppige Spiel der Kufenhelden ist das unangefochtene Stadtgespräch Nr. 1.
Alles könnte jetzt so wunderbar sein. Aber gerade nun, wo man auf der Welle des Erfolges und der Popularität surft, macht ein übles Gerücht die Runde: Der Verein soll aus dem Verkehr gezogen werden.
Können die Chiefs das Blatt noch wenden, jetzt wo sie im Finale um die Meisterschaft spielen? Und wo der Trainer sich im allerletzten Spiel seiner Karriere wieder auf die sportlichen Tugenden seiner Leidenschaft besonnen und der Gewalt abgeschworen hat, um mit seinem Sportethos in harmonischer Eintracht versöhnt die Rente anzutreten?
Ohne zu spoilern, nur soviel: der Film bleibt sich bis zum bitteren Ende treu und biedert sich nicht den Erwartungshaltungen der Sittenbehörde an.
Worte können das kindische Vergnügen nicht beschreiben, den Schlappschuss verbreitet. Man muß die Schläge schon in den eigenen vier Weichteilen erfahren.
Schlappschuss ist kein Sportfilm. Eigentlich ist es ein Antisportfilm. Oder eine Sportkomödie. Oder ein Tiefschlag in die Magengrube eines jeden menschenähnlichen Wesens mit einem Restkern Anstand im Leibe.
Alles wodurch sich die Epigonen des Genres auszeichnen wird hier konsequent entlarvt. Wo anders der hehre Sportsgeist beschworen und an Fairness, Moral und Tugend appeliert wird, und man so vieles für das spätere Leben an holder Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Kampf- und Teamgeist als seelische Erbauungssubstanz mit nach Hause schleppen darf, zählt hier eigentlich nur das Gegenteil: Fresse polieren, Weiber und Suff. Im Grunde ist Schlapschuss also eine Hommage an den guten, alten Steinzeitmann. Das aber mit einer Konsequenz und lebensbejahenden Vitalität, die Laune macht.
Natürlich quillt aus allen Ritzen des bürgerlichen Charlestowns auch die empörte Gegenkultur, die die Welt vor dem Untergang und der Reise ins sichere Verderben bewahren will. Gegen die animalische Primitivität der spätpubertierenden Triebwesen haben die Beetschwestern aber nicht den Hauch einer Chance.
Völlig verrückt und aufgeputscht prügeln sich die Sportsöldner mitunter schon vor dem Anpfiff warm und der Sport mutiert zusehends zu martialischen Gladiatorenspielen gleich denen im altehrwürdigen im Circus Maximus.
Mit ungezügelter Aggressivität und Frivolität wird das Publikum in Extase versetzt und das Establishment geschockt, in dem es mit seiner sterbenslangweiligen domestizierten Lebensrealität konfrontiert wird. Newmanns Kontakt mit der Clubbesitzerin steht hiebei exemplarisch für das Spannungsfeld zwischen lebendigem Mensch und überzüchteter Elite.
Fern davon entfernt, eine politische Botschaft zu transportieren, plädiert der Film jedoch eindeutig dafür, auf die Kacke zu hauen und Spaß dabei zu haben. Und all das, ohne sich des albernen Klamauk und trotteligen Slapstickzu zu bedienen. Das wäre in dieser rauen Männerwelt wohl auch zuviel des Guten...
Daher...Prädikat: Pädagogisch besonders übel
Bild: Sauber restauriert ohne den 70er Jahre typischen Filmlook zu zerstören.
Ton: Obwohl nur Stereo, ist jeder Knochenbruch eindeutig im Körper zu verorten.
Eine Schande, daß die Bewertungsliste zweieinhalb Jahre nach seiner Veröffentlichung noch immer jungfräulich in den Katakomben des Forums schlummerte und nicht schon von Lobhudeleien auf den wohl besten Sportfilm aller Zeiten aus allen Poren triefte.
Der Film spielt zu einer Zeit, als Frauen noch echte Männer und Männer noch echte Dreckskerle waren. In den Venen pulsierte noch reines Adrenalin, statt die schlaffe vegane Gurkensmoothiebrühe unserer Ära.
Der unterklassige Eishockeyclub des Stahlarbeiterkaffs Charlestown dümpelt mehr recht als schlecht vor sich hin und unterhält mit seinem zwar ambitionierten aber wenig erfolgreichen Spiel nur eine handvoll gelangweilter Zuschauer. Verwunderlich ist das nicht, da Sport bei den Akteuren der Chiefs nur eine untergeordnete Rolle spielt. In erster Linie sind die Recken um den Trainer Reggie (Paul Newman) nämlich eher an anderen Dingen interessiert. Da wären an erster Stelle Alkohol und Frauen zu nennen. An zweiter Frauen und Alkohol. Sexismus war damals noch olympisch und Vorwürfe der "Me Too" Bewegung wurden als Auszeichnung verstanden.
Da dem Verein jedoch der Abstieg droht, verpflichtet der engagierte Manager drei neue Nachwuchshoffnungen: die Hanson Brüder. Mit ihrem Milchbubiaussehen und Faible für Kinderspielzeug stoßen die Neulinge allerdings zunächst auf Ablehnung und Skepsis bei Trainer und Teamkollegen. Erst als ein Stammspieler verprügelt das Feld verlassen muß, schlägt die Stunde der Newcomer. Und siehe: hinter den Streberfassaden stecken drei psychopathische Teufel. Untertrieben beschrieben könnte man sagen, die Spielphilosophie der Hanson Brüder zeichne sich durch eine gewiße Körperlichkeit aus. Korrekterweise muß es aber wohl heißen, die drei sind kleine, brutale Drecksäue. ABER: die Chiefs gewinnen wieder und was viel mehr zählt ist, daß das Feuer der Leidenschaft bei den Zuschauern wieder zu lodern beginnt.
Das neue Spektakel in der War Memorial Eisarena spricht sich schnell in Charlestown herum. Im Nu sind die Spiele der Chiefs ausverkauft und das ruppige Spiel der Kufenhelden ist das unangefochtene Stadtgespräch Nr. 1.
Alles könnte jetzt so wunderbar sein. Aber gerade nun, wo man auf der Welle des Erfolges und der Popularität surft, macht ein übles Gerücht die Runde: Der Verein soll aus dem Verkehr gezogen werden.
Können die Chiefs das Blatt noch wenden, jetzt wo sie im Finale um die Meisterschaft spielen? Und wo der Trainer sich im allerletzten Spiel seiner Karriere wieder auf die sportlichen Tugenden seiner Leidenschaft besonnen und der Gewalt abgeschworen hat, um mit seinem Sportethos in harmonischer Eintracht versöhnt die Rente anzutreten?
Ohne zu spoilern, nur soviel: der Film bleibt sich bis zum bitteren Ende treu und biedert sich nicht den Erwartungshaltungen der Sittenbehörde an.
Worte können das kindische Vergnügen nicht beschreiben, den Schlappschuss verbreitet. Man muß die Schläge schon in den eigenen vier Weichteilen erfahren.
Schlappschuss ist kein Sportfilm. Eigentlich ist es ein Antisportfilm. Oder eine Sportkomödie. Oder ein Tiefschlag in die Magengrube eines jeden menschenähnlichen Wesens mit einem Restkern Anstand im Leibe.
Alles wodurch sich die Epigonen des Genres auszeichnen wird hier konsequent entlarvt. Wo anders der hehre Sportsgeist beschworen und an Fairness, Moral und Tugend appeliert wird, und man so vieles für das spätere Leben an holder Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Kampf- und Teamgeist als seelische Erbauungssubstanz mit nach Hause schleppen darf, zählt hier eigentlich nur das Gegenteil: Fresse polieren, Weiber und Suff. Im Grunde ist Schlapschuss also eine Hommage an den guten, alten Steinzeitmann. Das aber mit einer Konsequenz und lebensbejahenden Vitalität, die Laune macht.
Natürlich quillt aus allen Ritzen des bürgerlichen Charlestowns auch die empörte Gegenkultur, die die Welt vor dem Untergang und der Reise ins sichere Verderben bewahren will. Gegen die animalische Primitivität der spätpubertierenden Triebwesen haben die Beetschwestern aber nicht den Hauch einer Chance.
Völlig verrückt und aufgeputscht prügeln sich die Sportsöldner mitunter schon vor dem Anpfiff warm und der Sport mutiert zusehends zu martialischen Gladiatorenspielen gleich denen im altehrwürdigen im Circus Maximus.
Mit ungezügelter Aggressivität und Frivolität wird das Publikum in Extase versetzt und das Establishment geschockt, in dem es mit seiner sterbenslangweiligen domestizierten Lebensrealität konfrontiert wird. Newmanns Kontakt mit der Clubbesitzerin steht hiebei exemplarisch für das Spannungsfeld zwischen lebendigem Mensch und überzüchteter Elite.
Fern davon entfernt, eine politische Botschaft zu transportieren, plädiert der Film jedoch eindeutig dafür, auf die Kacke zu hauen und Spaß dabei zu haben. Und all das, ohne sich des albernen Klamauk und trotteligen Slapstickzu zu bedienen. Das wäre in dieser rauen Männerwelt wohl auch zuviel des Guten...
Daher...Prädikat: Pädagogisch besonders übel
Bild: Sauber restauriert ohne den 70er Jahre typischen Filmlook zu zerstören.
Ton: Obwohl nur Stereo, ist jeder Knochenbruch eindeutig im Körper zu verorten.
mit 5
mit 3
mit 3
mit 3
bewertet am 23.12.17 um 11:35
Paris im 16Jhdt. Die Fackel der Vernunft ist auf dem Weg von Athen in die französische Hauptstadt in die Seine gefallen und verloschen. Die Gesellschaft ist daher immer noch von spätmittelalterlichen Aberglauben, Standesdünkel, unflätigem Gebaren und einem grunzdummen Plebs, dessen abstoßendes Wesen in den grobschlächtigen Goschen, treffend eingefangen ist, geprägt. Der spärlich vorhandende Elan neuronaler Aktivität in den verklebten Hirnwindungen der Dumpfschädel läßt sich an dem Zustand und der Anzahl der vom pestig-jauchigen Atem umwehten und Zahnpilz, Plaque und Mundfäule zerfressenden Dentalruinen stellvertretend ablesen.
Da wundert es nicht, daß erste Vorboten der Aufklärung ironischer Weise zuerst beim Klerus auflodern.
In den gärenden, verschlungenen Gassen von Paris und den frühgotischen Gewölben der Hauptstadtkathedrale, entfaltet sich ein Drama um die hübsche Ziegeunerin Esmaralda, den Schönling Hauptmann Phoebus, den Hosentaschenpoeten Pierre, das Charakterschwein Richter Frollo und sein Findelkind, die Mißgeburt, den Glöckner der heiligen Jungfrau Maria gewidmeten Kirche.
Victor Hugos literarisches Vorbild ist komplex und tangiert neben vielen psychologischen Fazcetten, z.b., daß Esmeralda die Schönheit (Phoebus) dem Geist (Pierre) vorzieht, obwohl abzusehen ist, daß sie die Liasson ins Verderben stürzen wird, vor allem humanistische, soziale und aufklärerische Prozesse.
Auch wenn der Film einige dieser Themen aufgreift und eindringliche Plädoyers für die Kraft der Vernunft, des Mitgefühles und Wahrhaftigkeit hält, treten diese hinter den Schauwerten des Fantasykrachers von 1939 zurück.
Die Verfilmung von Regisseur William Dieterle mit Charles Laughton in der Hauptrolle gilt zu recht für viele als die bis heute beste Inszenierung. Nur die Verfilmung von 1956 mit Anthony Quinn kann dem Werk in Punkto Oppulenz noch das Wasser reichen. Mit einer unglaublichen Akribie und Detailgenauigkeit wurden die mittelalterlichen Kulissen mit ihrer Unzahl an enger, windiger und schlupfriger Gassen zusammengezimmert. Muffige Gefängnisse, stickige Räuberhöhlen und munumentale Sakralbauten tragen dabei ebenso zum faszinierenden Eindruck bei, wie die quirligen Massenscenen auf überfüllten Marktplätzen und pulsierenden Volksfesten. Nicht zu unrecht werden die imposanten Massenscenen bis heute gerühmt und erst in den frühen Piratenfilmen und Western eines Michael Curtiz wurde eine so meisterliche Choreographie wieder erreicht.
Einen weiteren Höhepunkt stellt die stimmungsvolle Beleuchtung, mit ihrer kraftvollen Ausstrahlung und psychologischen Kameraführung dar. Regisseur Dieterle war von den Bildgestaltungstechniken des deutschen expressionistischen Filmes so begeistert, daß es nicht verwundert, daß der Glöckner von Notre Dame der intensiven Bildsprache der Vorbilder Fritz Langs und Friedrich Wilhelm Murnaus huldigt. Die Aufnahmen in den starken schwarz/weiß Kontrasten und nur halb ausgeleuchteten Gesichtern und Scenenbildern, schaffen so eine dunkle, geheimnisvolle Athmosphäre, der man sich nur schwerlich entziehen kann. Auch der Schmutz in den Straßen und die schmuddeligen Gebäude mit ihren von der Vernichtungskraft der Zeit in Mitleidenschaft gezogenen Fassaden trägt zu dieser ungemein dichten Athmosphäre bei.
Das der Film nach nun mittlerweile 78 Jahren immer noch zu faszinieren vermag, spricht für seine erhabene Qualität. Er hält alle Versprechen, die man sich von einem alten Schinken erwünscht: Eine melodramatische Handlung, suggestive Bilder, herrausragende Schauspieler und die obligatorisch leiernde und blecherne Filmmusik in antiker Grammophonqualität.
Auch wenn sich der Film von Hugos Klassiker, in welchem Esmeralda und der bucklige Glöckner ein poetisch traurig-schönes Ende finden distanziert, trägt der so eingeschlagene Weg sicherlich erfolgsversprechender dazu bei, den Filmabend mit einem lichten Gefühl in den Rippen zu beenden.
Das es nach dem Film durchaus passieren kann, daß man mitten in der Nacht aus einem Albtraum, in dem eine ungestalte Kreatur in einem wilden Ritt auf einer Kirchenglocke versucht, diese zu begatten, mit einem Lachen aufwacht, sei nur am Rande bemerkt...
Aus dem Bild wurde das bestmögliche rausgeholt. Die Qualität imponiert!
Der Ton quäkt die ganze Zeit. Aber das gehört wohl dazu. Aus reinem Mitleid wurde der Film aber in genau dieser Disziplin für zwei Oscars nominiert.
Aber gegegen die innovative, übermächtige Technicolor Konkurrenz aus Vom Winde verweht, hatte der arme Krüppel keine Chance. The Beauty killed the Beast......
Extras: Schön, daß sich Warner einer alten Tradition besinnt und herauragende Werke der Looney Tunes vor dem Vergessen zu bewahren. Diese Schweinchen Dick/Hi Ho Silver Episode ist ein Juwel ihrer Gattung.
Der zweite Kurzfilm erzeugt allerdings Kopfschütteln. Hier sehen wie eine uralte antialkohol Kampagne. John Johnsen steht ein Karrieresprung bevor. Euphorisiert spricht er dem Alkohol zu. Angeschickert fährt er eine Familie zu Matsch und macht seine Frau zum Krüppel. Der Zusammenhang zum Hauptfilm erschließt sich mir nur über 5 Ecken und ist kaum interessant und reicht auch nicht zu einem überhebliches Lächeln über die gutgläubige Naivität einstiger Moralvorstellung.
Aber vielleicht überleg ich mir wirklich, mal nüchtern zu fahren...
Da wundert es nicht, daß erste Vorboten der Aufklärung ironischer Weise zuerst beim Klerus auflodern.
In den gärenden, verschlungenen Gassen von Paris und den frühgotischen Gewölben der Hauptstadtkathedrale, entfaltet sich ein Drama um die hübsche Ziegeunerin Esmaralda, den Schönling Hauptmann Phoebus, den Hosentaschenpoeten Pierre, das Charakterschwein Richter Frollo und sein Findelkind, die Mißgeburt, den Glöckner der heiligen Jungfrau Maria gewidmeten Kirche.
Victor Hugos literarisches Vorbild ist komplex und tangiert neben vielen psychologischen Fazcetten, z.b., daß Esmeralda die Schönheit (Phoebus) dem Geist (Pierre) vorzieht, obwohl abzusehen ist, daß sie die Liasson ins Verderben stürzen wird, vor allem humanistische, soziale und aufklärerische Prozesse.
Auch wenn der Film einige dieser Themen aufgreift und eindringliche Plädoyers für die Kraft der Vernunft, des Mitgefühles und Wahrhaftigkeit hält, treten diese hinter den Schauwerten des Fantasykrachers von 1939 zurück.
Die Verfilmung von Regisseur William Dieterle mit Charles Laughton in der Hauptrolle gilt zu recht für viele als die bis heute beste Inszenierung. Nur die Verfilmung von 1956 mit Anthony Quinn kann dem Werk in Punkto Oppulenz noch das Wasser reichen. Mit einer unglaublichen Akribie und Detailgenauigkeit wurden die mittelalterlichen Kulissen mit ihrer Unzahl an enger, windiger und schlupfriger Gassen zusammengezimmert. Muffige Gefängnisse, stickige Räuberhöhlen und munumentale Sakralbauten tragen dabei ebenso zum faszinierenden Eindruck bei, wie die quirligen Massenscenen auf überfüllten Marktplätzen und pulsierenden Volksfesten. Nicht zu unrecht werden die imposanten Massenscenen bis heute gerühmt und erst in den frühen Piratenfilmen und Western eines Michael Curtiz wurde eine so meisterliche Choreographie wieder erreicht.
Einen weiteren Höhepunkt stellt die stimmungsvolle Beleuchtung, mit ihrer kraftvollen Ausstrahlung und psychologischen Kameraführung dar. Regisseur Dieterle war von den Bildgestaltungstechniken des deutschen expressionistischen Filmes so begeistert, daß es nicht verwundert, daß der Glöckner von Notre Dame der intensiven Bildsprache der Vorbilder Fritz Langs und Friedrich Wilhelm Murnaus huldigt. Die Aufnahmen in den starken schwarz/weiß Kontrasten und nur halb ausgeleuchteten Gesichtern und Scenenbildern, schaffen so eine dunkle, geheimnisvolle Athmosphäre, der man sich nur schwerlich entziehen kann. Auch der Schmutz in den Straßen und die schmuddeligen Gebäude mit ihren von der Vernichtungskraft der Zeit in Mitleidenschaft gezogenen Fassaden trägt zu dieser ungemein dichten Athmosphäre bei.
Das der Film nach nun mittlerweile 78 Jahren immer noch zu faszinieren vermag, spricht für seine erhabene Qualität. Er hält alle Versprechen, die man sich von einem alten Schinken erwünscht: Eine melodramatische Handlung, suggestive Bilder, herrausragende Schauspieler und die obligatorisch leiernde und blecherne Filmmusik in antiker Grammophonqualität.
Auch wenn sich der Film von Hugos Klassiker, in welchem Esmeralda und der bucklige Glöckner ein poetisch traurig-schönes Ende finden distanziert, trägt der so eingeschlagene Weg sicherlich erfolgsversprechender dazu bei, den Filmabend mit einem lichten Gefühl in den Rippen zu beenden.
Das es nach dem Film durchaus passieren kann, daß man mitten in der Nacht aus einem Albtraum, in dem eine ungestalte Kreatur in einem wilden Ritt auf einer Kirchenglocke versucht, diese zu begatten, mit einem Lachen aufwacht, sei nur am Rande bemerkt...
Aus dem Bild wurde das bestmögliche rausgeholt. Die Qualität imponiert!
Der Ton quäkt die ganze Zeit. Aber das gehört wohl dazu. Aus reinem Mitleid wurde der Film aber in genau dieser Disziplin für zwei Oscars nominiert.
Aber gegegen die innovative, übermächtige Technicolor Konkurrenz aus Vom Winde verweht, hatte der arme Krüppel keine Chance. The Beauty killed the Beast......
Extras: Schön, daß sich Warner einer alten Tradition besinnt und herauragende Werke der Looney Tunes vor dem Vergessen zu bewahren. Diese Schweinchen Dick/Hi Ho Silver Episode ist ein Juwel ihrer Gattung.
Der zweite Kurzfilm erzeugt allerdings Kopfschütteln. Hier sehen wie eine uralte antialkohol Kampagne. John Johnsen steht ein Karrieresprung bevor. Euphorisiert spricht er dem Alkohol zu. Angeschickert fährt er eine Familie zu Matsch und macht seine Frau zum Krüppel. Der Zusammenhang zum Hauptfilm erschließt sich mir nur über 5 Ecken und ist kaum interessant und reicht auch nicht zu einem überhebliches Lächeln über die gutgläubige Naivität einstiger Moralvorstellung.
Aber vielleicht überleg ich mir wirklich, mal nüchtern zu fahren...
mit 5
mit 4
mit 3
mit 2
bewertet am 09.12.17 um 11:53
Wenn auch plo's wohlfeile Ausführungen an Geschmeidigkeit nicht zu überbieten sind, mag ich mich seinem Urteil (und das der Meisten anderen) nicht anschließen.
Unter dem Einfluß der unmittelbaren Nachwehen des Betrachtens, kann man dem finsteren Tal sicher gutmütig gegenüberstehen. Wer mag dem Film nach dem bleihaltigen Showdown nicht wohlwollend zur Seite stehen?
Was dabei aber nicht verdrängt werden darf, ist, daß erst nach zähen 30min zaghaft Akzente gesetzt werden und die eigentliche Geschichte nach einer weiteren geschlagenen halben Stunde an Fahrt gewinnt.
Bis dahin wird man, ähnlich wie in Das weiße Band, durch Handlungsentzug athmosphärisch auf den kargen und spröden winterlichen Alltag der Dorfbewohner eingestimmt. Einzelne Scenen wirken quälend lang und man hört nichts außer Röcheln oder Treppenknarzen. Kommunikation findet versehentlich nur gefühlte alle 5min statt. Das gibt Rätsel auf!
Majestätische Alpenpanoramen und kauzige Dorfbewohner sorgen zwar für visuelle Schauwerte, können aber nicht über die erzählerische Leere hinwegtäuschen, von der der Erste Teil des Filmes geprägt ist. Auch wenn nachträglich vieles Sinn ergibt läßt sich nicht der Eindrück verwähren, auf der Folterbank zu sitzen. Man hofft eine kleine Ewigkeit vergebens, daß sich zur Unterhaltung wenigstens mal ein emsiges Eichhörnchen ins Bild bemüht. Aber vergebens. Die Nüsse scheinen im Nachbartal verbuddelt zu sein!
Den Fehler, mangelndes Tempo in Anspruch umzudeuten sollte man also tunlichst vermeiden.
Wie plo bereits schreibt, orientiert sich Regisseur Prochaska in den Inszenierungen des Todesballettes unverkennbar an amerikanischen Vorbildern wie Sam Packinpah oder Quentin Tarantino. Hier aber tappt Prochaka in eine selbstgelegte Falle: Wer es mit Tarantino oder Packinpah aufnimmt, sollte ihnen zumindest ebenbürtig sein, da man die Hommagen unweigerlich mit den Originalen der Hollywoodlegenden vergleicht. Und hier kann das Urteil nur bescheiden ausfallen, da es fast unmöglich ist, die Intensität und Wucht der beiden zu erreichen. Eine eigenständige Herangehensweise hätte einen besseren Nachgeschmack hinterlassen. Kopien haftet nur allzuoft die Attitüde an, keinen individuellen Stil gefunden zu haben.
Ein weiteres Manko ist für mich der vielgepriesene Hauptdarsteller Sam Riley in der Rolle des Rächers Greider. Ihm ist sicherlich kein Totalausfall vorzuwerfen, doch kann er sein charismatisches Vorbild, nämlich Clint Eastwood in Ein Fremder ohne Namen, nicht verleugnen. Wo in dessen Mimik und Gestik aber noch eiserne Entschloßenheit und tief erfahrenes Leid ins Gesicht geschnitzt sind, ist mir Riley zu glatt und uncharismatisch. Gerade bei dem erzählerischem Leerlauf könnte ein gestandener Charakterkopf ganze Bände ausfüllen und viel dramaturgisches Manko wett machen. Das glatte Babyface Rileys vermag es hingegen nicht, den Zuschauer mit seinem zurückhaltenden Spiel in den Bann zu ziehen. Auch erinnert der laienhaft gebrabbelte amerikanische Slang Greiders eher an Schultheateraufführungen denn an ausgebildete Mimen. Ein Logopäde hätte hier vieles vermeiden können.
Trotz dieser, meine Bewertung maßgeblich bestimmenden Kritikpunkte, hat der Film aber selbstverständlich auch seine Stärken.
Hierzu zählen die bereits erwähnten Landschaftsaufnahmen ebenso wie die zugigen und grobschlächtig gearbeiten Kulissen, die auf ein entbehrungsreiches und von harter körperlicher Arbeit bestimmtes Leben verweisen. Gleiches drücken auch die Furchen, Gräben und verwilderte Bärte der Visagen der Ur-Einwohner aus, dessen verwachsenes Äußeres bereits auf die dumpf-triebhaften zutage tretenden Charaktere verweist.
So ist Das finstere Tal letztendlich kein völlig misratener Film. Mir mutet es aber eher wie ein berüchtigtes Tatort Experiment an, als ein europäisches Indie Meisterwerk, als das es oftmals gefeiert wird. Sicherlich sind solche Werke mutig und sollten gefördert werden, um das europäische Kino nach vorne zu treiben. Hypen und in den Kultstatus erheben würde ich sie indessen nicht, da man mit einer unsachgemäßen Betrachtung der Entwicklung einen Bärendienst erweisen würde, weil man dadurch seine Vollendung viel zu früh feiern und die Meßlatte zu niedrig ansetzen würde.
Wer vorgewarnt ist, sollte aber mit einer Thermoskanne Espresso im Halfter für dieses Kleinod tüchtig gewappnet sein und keine bösen Überraschungen mehr erleben dürfen.
8 deutsche Filmpreise sprechen wohl eher für sich und gegen mich! Alles weitere, siehe plo!
Ach ja, daß mit dem teils unverständlichen Ösidialekt stimmt leider auch wirklich...
Unter dem Einfluß der unmittelbaren Nachwehen des Betrachtens, kann man dem finsteren Tal sicher gutmütig gegenüberstehen. Wer mag dem Film nach dem bleihaltigen Showdown nicht wohlwollend zur Seite stehen?
Was dabei aber nicht verdrängt werden darf, ist, daß erst nach zähen 30min zaghaft Akzente gesetzt werden und die eigentliche Geschichte nach einer weiteren geschlagenen halben Stunde an Fahrt gewinnt.
Bis dahin wird man, ähnlich wie in Das weiße Band, durch Handlungsentzug athmosphärisch auf den kargen und spröden winterlichen Alltag der Dorfbewohner eingestimmt. Einzelne Scenen wirken quälend lang und man hört nichts außer Röcheln oder Treppenknarzen. Kommunikation findet versehentlich nur gefühlte alle 5min statt. Das gibt Rätsel auf!
Majestätische Alpenpanoramen und kauzige Dorfbewohner sorgen zwar für visuelle Schauwerte, können aber nicht über die erzählerische Leere hinwegtäuschen, von der der Erste Teil des Filmes geprägt ist. Auch wenn nachträglich vieles Sinn ergibt läßt sich nicht der Eindrück verwähren, auf der Folterbank zu sitzen. Man hofft eine kleine Ewigkeit vergebens, daß sich zur Unterhaltung wenigstens mal ein emsiges Eichhörnchen ins Bild bemüht. Aber vergebens. Die Nüsse scheinen im Nachbartal verbuddelt zu sein!
Den Fehler, mangelndes Tempo in Anspruch umzudeuten sollte man also tunlichst vermeiden.
Wie plo bereits schreibt, orientiert sich Regisseur Prochaska in den Inszenierungen des Todesballettes unverkennbar an amerikanischen Vorbildern wie Sam Packinpah oder Quentin Tarantino. Hier aber tappt Prochaka in eine selbstgelegte Falle: Wer es mit Tarantino oder Packinpah aufnimmt, sollte ihnen zumindest ebenbürtig sein, da man die Hommagen unweigerlich mit den Originalen der Hollywoodlegenden vergleicht. Und hier kann das Urteil nur bescheiden ausfallen, da es fast unmöglich ist, die Intensität und Wucht der beiden zu erreichen. Eine eigenständige Herangehensweise hätte einen besseren Nachgeschmack hinterlassen. Kopien haftet nur allzuoft die Attitüde an, keinen individuellen Stil gefunden zu haben.
Ein weiteres Manko ist für mich der vielgepriesene Hauptdarsteller Sam Riley in der Rolle des Rächers Greider. Ihm ist sicherlich kein Totalausfall vorzuwerfen, doch kann er sein charismatisches Vorbild, nämlich Clint Eastwood in Ein Fremder ohne Namen, nicht verleugnen. Wo in dessen Mimik und Gestik aber noch eiserne Entschloßenheit und tief erfahrenes Leid ins Gesicht geschnitzt sind, ist mir Riley zu glatt und uncharismatisch. Gerade bei dem erzählerischem Leerlauf könnte ein gestandener Charakterkopf ganze Bände ausfüllen und viel dramaturgisches Manko wett machen. Das glatte Babyface Rileys vermag es hingegen nicht, den Zuschauer mit seinem zurückhaltenden Spiel in den Bann zu ziehen. Auch erinnert der laienhaft gebrabbelte amerikanische Slang Greiders eher an Schultheateraufführungen denn an ausgebildete Mimen. Ein Logopäde hätte hier vieles vermeiden können.
Trotz dieser, meine Bewertung maßgeblich bestimmenden Kritikpunkte, hat der Film aber selbstverständlich auch seine Stärken.
Hierzu zählen die bereits erwähnten Landschaftsaufnahmen ebenso wie die zugigen und grobschlächtig gearbeiten Kulissen, die auf ein entbehrungsreiches und von harter körperlicher Arbeit bestimmtes Leben verweisen. Gleiches drücken auch die Furchen, Gräben und verwilderte Bärte der Visagen der Ur-Einwohner aus, dessen verwachsenes Äußeres bereits auf die dumpf-triebhaften zutage tretenden Charaktere verweist.
So ist Das finstere Tal letztendlich kein völlig misratener Film. Mir mutet es aber eher wie ein berüchtigtes Tatort Experiment an, als ein europäisches Indie Meisterwerk, als das es oftmals gefeiert wird. Sicherlich sind solche Werke mutig und sollten gefördert werden, um das europäische Kino nach vorne zu treiben. Hypen und in den Kultstatus erheben würde ich sie indessen nicht, da man mit einer unsachgemäßen Betrachtung der Entwicklung einen Bärendienst erweisen würde, weil man dadurch seine Vollendung viel zu früh feiern und die Meßlatte zu niedrig ansetzen würde.
Wer vorgewarnt ist, sollte aber mit einer Thermoskanne Espresso im Halfter für dieses Kleinod tüchtig gewappnet sein und keine bösen Überraschungen mehr erleben dürfen.
8 deutsche Filmpreise sprechen wohl eher für sich und gegen mich! Alles weitere, siehe plo!
Ach ja, daß mit dem teils unverständlichen Ösidialekt stimmt leider auch wirklich...
mit 3
mit 4
mit 4
mit 2
bewertet am 03.12.17 um 22:03
Ein Wunder ist geschehen!
Es gibt einen Film, der das unerhörte Kunststück vollbringt, einem den Glauben an das Blockbusterkino Hollywoods als verläßlicher Hoflieferant phantastischer Träume zurückzugeben. Wonder Woman schafft es, sich von den Stereotypen der zweidimensionalen Vorlage iher Graphic Novel Quellen abzuheben und in der Welt der Menschenkinder zu etablieren. Die erste Comicverfilmung seit langer, langer Zeit, die neben spektakulärer Optik auch emotionale Akzente zu setzen weiß.
Nach dem letzten jämmerlichen Thor Ableger begeistert der neueste Superheldenstreifen durch erzählerische Qualität. In Rückbesinnung auf die alte Gewißheit, daß überbordendes Effektgewitter niemals eine qualitativ hochwertige Story ersetzen kann, fokussiert sich das Team um Zack Snyder und Regisseur Patty Jenkins auf sympathische Charaktere und einen für Comicverfilmungen erstaunlich komplexen Handlungsverlauf, in dem gehobener Wert auf dramaturgische Elemente und zwischenmenschliche Töne gelegt wird.
Was zuallererst ins Auge sticht, ist, daß trotz aller Superpower, die Geschichte im Reich der realen Befindlichkeiten verortet ist. Beginnend bei Wonder Women fällt sofort angenehm auf, daß es sich bei dieser Amazonin nicht, wie man leicht hätte meinen können, um eine verhärmte, von maskulinen Attributen durchwirkte Kampflesbe handelt, sondern um eine echte Frau, wenn nicht sogar empfindsames weibliches Wesen, welches glaubwürdige Gefühle entwickelt und echte Anteilnahme am menschlichen Schicksal nimmt.
Die Menschen sind hier nicht beliebige, verzichtbare, seelenlose Dutzendware, deren massenhaftes Ableben den effekthascherischen Showeffekt der Spezialeffekte steigern soll, sondern echte Wesen aus Fleisch und Blut mit ihrer eigenen Geschichte.
Zu Ungunsten der Effekte wird behutsam eine Beziehung zwischen der Kämpferin und dem englischen Spion Steve aufgebaut. Ohne sich zu sehr auf Kitsch zu versteifen oder ins romantische der schmalztriefenden Schmonzette abzugleiten, findet der Film genau die richtige Balance zwischen Gefühl, Humor und Seriosität. Glücklicherweise zünden hierbei die dezent eingefügten Gags und sind meilenweit von der schenkelklopfrigen Infantilität eines Thor oder der Guardians of the Galaxy entfernt.
Auf der mystischen, von der Weltöffentlichkeit durch einen Nebelschleier verborgenen, Insel Themyscira wächst die spätere Wonder Woman Diana, zunächst noch als kleine Göre, heran und wird im Lauf der langen Jahre zur Kriegerin aufgebaut. Mit der Idylle ist es allerdings jäh vorbei, als der britische Spion Steve Trevor mit einem Flugzeug den Schutzschild Themysciras durchbricht und notwassert.
Von Diana gerettet, berichtet der Agent, seine Welt befinde sich in einem furchtbaren Krieg und der Menschheit drohe die Ausrottung.
Schnell stellt sich heraus, daß Steve selbst in den ersten Weltkrieg verwickelt ist und und mit seinem gestohlenen Wissen den weiteren Verlauf des Kampfgeschehens nicht unwesentlich beeiflussen kann. Der deutsche General Ludendorf und seine diabolische Chefchemikerin, Dr. Poison, sind kurz davor, den Feind mit brutalen Giftgasen für alle Zeiten vom Antlitz der Erde zu wischen.
Diana hat auf Thymoscira eine klassisch humanistische Bildungskarriere mit Schwerpunkt auf antike Götterwelt und Altgriechisch durchlaufen und schließt daher aus den ihr zur Verfügung stehenden Informationen folgerichtig, daß der Kriegsgott Ares in der Inkarnation Ludendorfs seine Hände mit im Spiel haben muß.
Wonder Woman sieht daher in der Errettung der Welt und der Tötung Ares ihre Bestimmung.
Über das quirlige und üppige Londen der 1910er Jahre verschlägt es Wonder Woman, Steve und eine Clique aus der Not geborenen und mehr schlecht als recht gecasteten Haudegen, über die umkämpften Schützengräben der belgischen Front, schließlich mitten hinein in das Herz des Bösen...
Actionscenen werden bei diesem Feldzug gegen das personifizierte Übel dieser Welt zurückhaltend eingesetzt und sind eher im konventionellem Stil eines Abenteuer- oder Kriegsfilmes gehalten, in dem sich die Überschaubarkeit des Geschehens über den Actiobombast Overkill erhebt. Wenn es dann schließlich doch mal knallt, fliegen zwar auch ordentlich die Fetzen, bleiben aber im Rahmen eines handelsüblichen Explosionsgewitters.
Die Zeit zwischen den Feuerwerken, wird mit allerlei Verästelung der Handlung, Beleuchtung der Charaktere ausgefüllt (wie es Spud aus Trainspotting in den Film geschafft hat, ist mir ein Mysterium, paßt aber!) und schwelgen im dunstig-schwülen Ambiente des Londons im ausklingenden victorianischem Zeitalter.
Obwohl der Film nicht von einer Scene zur nächsten poltert, kommt keine Sekunde Langeweile auf.
Im ausgedehnten Mittelteil rückt die sich hauchzart anbahnende Liebesgeschichte zwischen Steve und Wonder Woman, mit all den unschuldigen Neckereien zweier Turteltäubchen, etwas in den Vordergrund. Wonder Woman mutiert dadurch zwar nicht zur Romanze, würde hier aber beinahe ohne den ganzen Superheldenquatsch auskommen.
Bis zum fulminanten Finale, in dem Wonder Woman ihr gesamtes in den Tiefen ihres Uterus schlummernden Potential zum Erwachen verhilft, wird der Film von der sympathischen Ausstrahlung Dianas getragen, ohne jedoch jemals einen Abstecher ins Reich des Pathetischen oder Seichten nehmen zu müßen.
Hollywood demonstriert der Welt mit Wonder Woman vorbildlich, was möglich ist, wenn man sich am Drehbuchautorenpult mal wieder etwas am Riemen reißt und sein Publikum mit Würde behandelt, statt es permanent intellektuell zu unterfordern.
DC zeigt Marvel mal wieder wo der Hammer hängt und etabliert sich mit seinem Franchise tendenziell eher im Erwachsenensegment, während MARVEL sich mit Siebenmeilenstiefeln der Erstürmung der Kitapforten verdächtig macht...
Das sich die Imposanz des Filmes erst in 3D voll entfaltet, versteht sich von selbst, wenn auch die beiden stereoskopischen Bilder zum Leidwesen des zahlenden Kunden, nicht immer zu einer Einheit verschmolzen werden können...
Es gibt einen Film, der das unerhörte Kunststück vollbringt, einem den Glauben an das Blockbusterkino Hollywoods als verläßlicher Hoflieferant phantastischer Träume zurückzugeben. Wonder Woman schafft es, sich von den Stereotypen der zweidimensionalen Vorlage iher Graphic Novel Quellen abzuheben und in der Welt der Menschenkinder zu etablieren. Die erste Comicverfilmung seit langer, langer Zeit, die neben spektakulärer Optik auch emotionale Akzente zu setzen weiß.
Nach dem letzten jämmerlichen Thor Ableger begeistert der neueste Superheldenstreifen durch erzählerische Qualität. In Rückbesinnung auf die alte Gewißheit, daß überbordendes Effektgewitter niemals eine qualitativ hochwertige Story ersetzen kann, fokussiert sich das Team um Zack Snyder und Regisseur Patty Jenkins auf sympathische Charaktere und einen für Comicverfilmungen erstaunlich komplexen Handlungsverlauf, in dem gehobener Wert auf dramaturgische Elemente und zwischenmenschliche Töne gelegt wird.
Was zuallererst ins Auge sticht, ist, daß trotz aller Superpower, die Geschichte im Reich der realen Befindlichkeiten verortet ist. Beginnend bei Wonder Women fällt sofort angenehm auf, daß es sich bei dieser Amazonin nicht, wie man leicht hätte meinen können, um eine verhärmte, von maskulinen Attributen durchwirkte Kampflesbe handelt, sondern um eine echte Frau, wenn nicht sogar empfindsames weibliches Wesen, welches glaubwürdige Gefühle entwickelt und echte Anteilnahme am menschlichen Schicksal nimmt.
Die Menschen sind hier nicht beliebige, verzichtbare, seelenlose Dutzendware, deren massenhaftes Ableben den effekthascherischen Showeffekt der Spezialeffekte steigern soll, sondern echte Wesen aus Fleisch und Blut mit ihrer eigenen Geschichte.
Zu Ungunsten der Effekte wird behutsam eine Beziehung zwischen der Kämpferin und dem englischen Spion Steve aufgebaut. Ohne sich zu sehr auf Kitsch zu versteifen oder ins romantische der schmalztriefenden Schmonzette abzugleiten, findet der Film genau die richtige Balance zwischen Gefühl, Humor und Seriosität. Glücklicherweise zünden hierbei die dezent eingefügten Gags und sind meilenweit von der schenkelklopfrigen Infantilität eines Thor oder der Guardians of the Galaxy entfernt.
Auf der mystischen, von der Weltöffentlichkeit durch einen Nebelschleier verborgenen, Insel Themyscira wächst die spätere Wonder Woman Diana, zunächst noch als kleine Göre, heran und wird im Lauf der langen Jahre zur Kriegerin aufgebaut. Mit der Idylle ist es allerdings jäh vorbei, als der britische Spion Steve Trevor mit einem Flugzeug den Schutzschild Themysciras durchbricht und notwassert.
Von Diana gerettet, berichtet der Agent, seine Welt befinde sich in einem furchtbaren Krieg und der Menschheit drohe die Ausrottung.
Schnell stellt sich heraus, daß Steve selbst in den ersten Weltkrieg verwickelt ist und und mit seinem gestohlenen Wissen den weiteren Verlauf des Kampfgeschehens nicht unwesentlich beeiflussen kann. Der deutsche General Ludendorf und seine diabolische Chefchemikerin, Dr. Poison, sind kurz davor, den Feind mit brutalen Giftgasen für alle Zeiten vom Antlitz der Erde zu wischen.
Diana hat auf Thymoscira eine klassisch humanistische Bildungskarriere mit Schwerpunkt auf antike Götterwelt und Altgriechisch durchlaufen und schließt daher aus den ihr zur Verfügung stehenden Informationen folgerichtig, daß der Kriegsgott Ares in der Inkarnation Ludendorfs seine Hände mit im Spiel haben muß.
Wonder Woman sieht daher in der Errettung der Welt und der Tötung Ares ihre Bestimmung.
Über das quirlige und üppige Londen der 1910er Jahre verschlägt es Wonder Woman, Steve und eine Clique aus der Not geborenen und mehr schlecht als recht gecasteten Haudegen, über die umkämpften Schützengräben der belgischen Front, schließlich mitten hinein in das Herz des Bösen...
Actionscenen werden bei diesem Feldzug gegen das personifizierte Übel dieser Welt zurückhaltend eingesetzt und sind eher im konventionellem Stil eines Abenteuer- oder Kriegsfilmes gehalten, in dem sich die Überschaubarkeit des Geschehens über den Actiobombast Overkill erhebt. Wenn es dann schließlich doch mal knallt, fliegen zwar auch ordentlich die Fetzen, bleiben aber im Rahmen eines handelsüblichen Explosionsgewitters.
Die Zeit zwischen den Feuerwerken, wird mit allerlei Verästelung der Handlung, Beleuchtung der Charaktere ausgefüllt (wie es Spud aus Trainspotting in den Film geschafft hat, ist mir ein Mysterium, paßt aber!) und schwelgen im dunstig-schwülen Ambiente des Londons im ausklingenden victorianischem Zeitalter.
Obwohl der Film nicht von einer Scene zur nächsten poltert, kommt keine Sekunde Langeweile auf.
Im ausgedehnten Mittelteil rückt die sich hauchzart anbahnende Liebesgeschichte zwischen Steve und Wonder Woman, mit all den unschuldigen Neckereien zweier Turteltäubchen, etwas in den Vordergrund. Wonder Woman mutiert dadurch zwar nicht zur Romanze, würde hier aber beinahe ohne den ganzen Superheldenquatsch auskommen.
Bis zum fulminanten Finale, in dem Wonder Woman ihr gesamtes in den Tiefen ihres Uterus schlummernden Potential zum Erwachen verhilft, wird der Film von der sympathischen Ausstrahlung Dianas getragen, ohne jedoch jemals einen Abstecher ins Reich des Pathetischen oder Seichten nehmen zu müßen.
Hollywood demonstriert der Welt mit Wonder Woman vorbildlich, was möglich ist, wenn man sich am Drehbuchautorenpult mal wieder etwas am Riemen reißt und sein Publikum mit Würde behandelt, statt es permanent intellektuell zu unterfordern.
DC zeigt Marvel mal wieder wo der Hammer hängt und etabliert sich mit seinem Franchise tendenziell eher im Erwachsenensegment, während MARVEL sich mit Siebenmeilenstiefeln der Erstürmung der Kitapforten verdächtig macht...
Das sich die Imposanz des Filmes erst in 3D voll entfaltet, versteht sich von selbst, wenn auch die beiden stereoskopischen Bilder zum Leidwesen des zahlenden Kunden, nicht immer zu einer Einheit verschmolzen werden können...
mit 4
mit 5
mit 4
mit 3
bewertet am 03.12.17 um 12:45
10 Jahre nachdem die französische Nouvelle Vague durch die Kinosäle brandete, erneuerte sich zu Beginn der 70er Jahre das amerikanische Kino mit dem New Hollywood. Protagonisten des neuen Autorenkinos waren Dennis Hopper, Francis Ford Collpola, George Lucas, Steven Spielberg...und eben Peter Bogdanovich.
Bogdanovich's The Last Picture Show erschien 1971 auf dem Höhepunkt der Bewegung (die übrigens von Spielbergs "der weiße Hai", der Erfindung des Blockbusterkinos, zu Grabe getragen wurde) und gilt aus cineastischer Sicht als einer ihrer absoluten Höhepunkte. Die Academy ließ sich nicht lumpen und honorierte die Literaturverfilmung mit 8 Oscarniminierungen.
Die frühen 50er Jahre. Die Kleinstadt Anarene im tiefsten Texas hat ihre besten Zeiten schon lange hinter sich. Und auch die zweit und drittbesten Tage liegen weit zurück. Durch die verlassenen Straßen tobt der Wind des Zerfalles und des Niederganges. In dieser trostlosen Kulisse fristen die Einwohner Anarenes ein karges Leben. Nur ein verwitternder Spielsaloon, ein Imbiss und ein Kino spenden den Bewohnern etwas Zersteurung vom Einerlei ihres grauen Alltages.
Im Mittelpunkt der Novelle stehen Sonny, sein Freund Duane, die jungfräuliche Verführerin Jacy und die langsam verwitternde Lehrerfrau Ruth. Sonny besucht im letzten Jahr die High School und hat, wie alle seine pubertierenden Kumpels, außer Frauen und dem prickelnden "Ersten mal" nicht viel im Sinn. Sex und Beziehungen sind das Einzige Lebenselexier und der letzte Trost in dieser geistlosen Ödniss.
Zwischen den Darstellern entspinnt sich ein Beziehungs- und Intrigengewirr, in dem es auf der Suche nach Glück nur Verlierer gibt. Jugendliche, im besten Alter, die hoffen daß das Leben jetzt so richtig durchstartet, treffen auf Erwachsene, die die Flausen dieses Traumes längst ausgeträumt haben und die unschuldige Naivität der Heranwachsenden für ihre Begierden geschickt auszunutzen wissen.
Über ein Jahr zeichnet Bogdanovich den Weg des Deillusionierungsprozess der Adoleszens nach. In eindringlichen aber kargen schwarz/weiß Bildern huldigt der Regisseur der Kamerasprache der 40er und 50er Jahre und orientiert sich hierbei an den Westernikonen jener Zeit. Die Spiehalle wird zum Saloon und die Straßenzüge verwandeln sich in Canyons und Felsformationen einer Howard Hawks Produktion. Die vielen Close Ups des aussagekräftigen Minenspiels der allesamt herausragend agierenden Schauspielern gleichen die Gesten der Ausweglosigkeit der Sprache der monumentalen westamerikanischen Landschaft an und steigern so das emotionale Innenleben ins Episch-Zeitlose.
Dieser Kunstgriff beschert dem Film einen hohen Grad von Intensität und Authentizität.
Wodurch sich Die letzte Vorstellung jedoch von seinen Vorbildern distanziert, ist die Prüderie der Mc Carthy Ära. In seiner brutalen Ehrlichkeit knüpft der Film an die Tradition der besten Dramen Hollywoods, wie die Werke von Elia Kazan, Wer hat Angst vor Virginia Wolf, Misfits oder Die Katze auf dem heißen Blechdach, an. Kein Tabu wird hinter einer verschähmten Symolsprache, unter kitschigen Nierentischen oder Micky Mouse bunten Rüschenkleidern versteckt. Die Tatsache des glamourlosen, auf reine Grundbedürfnisse reduzierten Kleinstadtlebens wird auf den Altar der Entmystifizierung genagelt und dem unerbittlichen Urteil des nach Demaskierung geifernden Pharisäertums ausgeliefert.
Im Gegensatz zu den filmischen Vorbildern dieses Werkes, dessen Explosionen der Emotionen und hitzigen Wortgefechten, liegt der Schwerpunkt bei Bogdanovich allerdings in dem Ungesagten zwischen den Zeilen. Die Enttäuschung und das Scheitern läßt sich vielmehr aus den Tränen, den Gesten und ausladenden Kulissen ablesen, als den fassadären Worthülsen, die benutzt werden um in einem letzten Verzweiflungsakt dem Leben noch ein wenig Zuneigung abzuringen, bevor die Existenz am Rande der Zivilisation die letzten Reste Menschlichkeit aus der Seele gespült hat.
In The Last Picture Show zeichnet Co-Drehbuchautor und Verfasser der literarischen Vorlage in halbbiographischen Zügen ein ungeschminktes Zeitporträt einer amerikanischen, nachträglich heroisierten Epoche. Von Rock'n Roll und Pettycoat, Tschitti Tschitti Bäng Bäng und Roll over Beethoven ist man im tiefsten Süden Lichtjahre entfernt. Im Gegenteil: Auf komponierte Filmmusik wird hier gänzlich verzichtet. Stattdessen tropft die Countrymusik lethargisch aus den leise vor sich hinplätschernden Radios und verströmt im Ort das gespenstisch-traurige Aroma von Geisterbahnen.
Um dem schleichenden psychologischen und seelischem Verfall zu entkommen, der als Tribut zu zollen ist, um in dem trägen und von lähmender Eintönigkeit gekennzeichnetem Leben in dem Westernkaff bestehen zu können, besteht eigentlich nur in einer Möglichkeit: Der Flucht hinein in die eigentliche Welt. Und hier scheint sogar der todversprechende Kriegsdienst die bessere Alternative zu sein...
Nachdem das aufkommende Fernsehen die Bewohner vor den Mattschirm gelockt und den Rest sozialen Lebens in Anarene erstickt hat, muß das Kino seine Pforten schließen. Nach der letzten Vorstellung ist der letzte Zeitpunkt zur Flucht gekommen, bevor der geistige Verwesungsprozess beginnt, der die letzten sich aufbäumenden Reste von Vitalität und Lebensfreude zu zersetzen droht...
Das Bild ist ordentlich restauriert, will heißen, frei von Artefakten. Dennoch ist das Bild oft unscharf und durchgehend dominiert durch starkes Filmkorn. der Genuss der oftmals sehr ausdruckstarken Bildern wird so leider geschmählert.
Bogdanovich's The Last Picture Show erschien 1971 auf dem Höhepunkt der Bewegung (die übrigens von Spielbergs "der weiße Hai", der Erfindung des Blockbusterkinos, zu Grabe getragen wurde) und gilt aus cineastischer Sicht als einer ihrer absoluten Höhepunkte. Die Academy ließ sich nicht lumpen und honorierte die Literaturverfilmung mit 8 Oscarniminierungen.
Die frühen 50er Jahre. Die Kleinstadt Anarene im tiefsten Texas hat ihre besten Zeiten schon lange hinter sich. Und auch die zweit und drittbesten Tage liegen weit zurück. Durch die verlassenen Straßen tobt der Wind des Zerfalles und des Niederganges. In dieser trostlosen Kulisse fristen die Einwohner Anarenes ein karges Leben. Nur ein verwitternder Spielsaloon, ein Imbiss und ein Kino spenden den Bewohnern etwas Zersteurung vom Einerlei ihres grauen Alltages.
Im Mittelpunkt der Novelle stehen Sonny, sein Freund Duane, die jungfräuliche Verführerin Jacy und die langsam verwitternde Lehrerfrau Ruth. Sonny besucht im letzten Jahr die High School und hat, wie alle seine pubertierenden Kumpels, außer Frauen und dem prickelnden "Ersten mal" nicht viel im Sinn. Sex und Beziehungen sind das Einzige Lebenselexier und der letzte Trost in dieser geistlosen Ödniss.
Zwischen den Darstellern entspinnt sich ein Beziehungs- und Intrigengewirr, in dem es auf der Suche nach Glück nur Verlierer gibt. Jugendliche, im besten Alter, die hoffen daß das Leben jetzt so richtig durchstartet, treffen auf Erwachsene, die die Flausen dieses Traumes längst ausgeträumt haben und die unschuldige Naivität der Heranwachsenden für ihre Begierden geschickt auszunutzen wissen.
Über ein Jahr zeichnet Bogdanovich den Weg des Deillusionierungsprozess der Adoleszens nach. In eindringlichen aber kargen schwarz/weiß Bildern huldigt der Regisseur der Kamerasprache der 40er und 50er Jahre und orientiert sich hierbei an den Westernikonen jener Zeit. Die Spiehalle wird zum Saloon und die Straßenzüge verwandeln sich in Canyons und Felsformationen einer Howard Hawks Produktion. Die vielen Close Ups des aussagekräftigen Minenspiels der allesamt herausragend agierenden Schauspielern gleichen die Gesten der Ausweglosigkeit der Sprache der monumentalen westamerikanischen Landschaft an und steigern so das emotionale Innenleben ins Episch-Zeitlose.
Dieser Kunstgriff beschert dem Film einen hohen Grad von Intensität und Authentizität.
Wodurch sich Die letzte Vorstellung jedoch von seinen Vorbildern distanziert, ist die Prüderie der Mc Carthy Ära. In seiner brutalen Ehrlichkeit knüpft der Film an die Tradition der besten Dramen Hollywoods, wie die Werke von Elia Kazan, Wer hat Angst vor Virginia Wolf, Misfits oder Die Katze auf dem heißen Blechdach, an. Kein Tabu wird hinter einer verschähmten Symolsprache, unter kitschigen Nierentischen oder Micky Mouse bunten Rüschenkleidern versteckt. Die Tatsache des glamourlosen, auf reine Grundbedürfnisse reduzierten Kleinstadtlebens wird auf den Altar der Entmystifizierung genagelt und dem unerbittlichen Urteil des nach Demaskierung geifernden Pharisäertums ausgeliefert.
Im Gegensatz zu den filmischen Vorbildern dieses Werkes, dessen Explosionen der Emotionen und hitzigen Wortgefechten, liegt der Schwerpunkt bei Bogdanovich allerdings in dem Ungesagten zwischen den Zeilen. Die Enttäuschung und das Scheitern läßt sich vielmehr aus den Tränen, den Gesten und ausladenden Kulissen ablesen, als den fassadären Worthülsen, die benutzt werden um in einem letzten Verzweiflungsakt dem Leben noch ein wenig Zuneigung abzuringen, bevor die Existenz am Rande der Zivilisation die letzten Reste Menschlichkeit aus der Seele gespült hat.
In The Last Picture Show zeichnet Co-Drehbuchautor und Verfasser der literarischen Vorlage in halbbiographischen Zügen ein ungeschminktes Zeitporträt einer amerikanischen, nachträglich heroisierten Epoche. Von Rock'n Roll und Pettycoat, Tschitti Tschitti Bäng Bäng und Roll over Beethoven ist man im tiefsten Süden Lichtjahre entfernt. Im Gegenteil: Auf komponierte Filmmusik wird hier gänzlich verzichtet. Stattdessen tropft die Countrymusik lethargisch aus den leise vor sich hinplätschernden Radios und verströmt im Ort das gespenstisch-traurige Aroma von Geisterbahnen.
Um dem schleichenden psychologischen und seelischem Verfall zu entkommen, der als Tribut zu zollen ist, um in dem trägen und von lähmender Eintönigkeit gekennzeichnetem Leben in dem Westernkaff bestehen zu können, besteht eigentlich nur in einer Möglichkeit: Der Flucht hinein in die eigentliche Welt. Und hier scheint sogar der todversprechende Kriegsdienst die bessere Alternative zu sein...
Nachdem das aufkommende Fernsehen die Bewohner vor den Mattschirm gelockt und den Rest sozialen Lebens in Anarene erstickt hat, muß das Kino seine Pforten schließen. Nach der letzten Vorstellung ist der letzte Zeitpunkt zur Flucht gekommen, bevor der geistige Verwesungsprozess beginnt, der die letzten sich aufbäumenden Reste von Vitalität und Lebensfreude zu zersetzen droht...
Das Bild ist ordentlich restauriert, will heißen, frei von Artefakten. Dennoch ist das Bild oft unscharf und durchgehend dominiert durch starkes Filmkorn. der Genuss der oftmals sehr ausdruckstarken Bildern wird so leider geschmählert.
mit 4
mit 3
mit 3
mit 3
bewertet am 01.12.17 um 10:38
Vorsicht Kumpels, laßt Euch nicht ins Bockshorn jagen! The Wicker Man ist KEIN Horrorfilm!!!
Der Film verfügt über keinerlei horrortypische Elemente. Wer hier Grusel, beklemmende Athmosphäre, Terror, Splatter oder auch einfach nur spröden Nervenkitzel sucht, wird wieder mit leeren Taschen nach Hause geschickt. Bis auf eine archetypische Version des Burning Man Festivals zum Finale hin, bemüht sich der Thrillfaktor nicht, sich nennenswert über den Ruhepol seiner Null-Linie hinaus zu bewegen.
Dennoch ist der Film äußerst sehenswert.
Den Polizeiinspektor Neil Howe verschlägt es auf die kleine Insel Summerisle. Das kleine Mädchen Rowan Morrisson ist verschwunden und Howe macht sich auf die Suche nach dem Verbleib des kleinen Sonnenscheins. Und hier beginnen die Probleme: Niemand will Rowan gekannt haben. Howe stößt auf eine Mauer der Verschwiegenheit und der Verleumdung.
Außer der ablehnenden Haltung der Dorfbewohner erregt aber auch noch etwas anderes das Interesse des Gesetzeshüters: Die Inselbewohner Verhalten sich allesamt merkwürdig, um nicht zu sagen skurill. Sie haben ein sehr freizügiges Verhältniss zur Sexualität und derben Späßen.
Als Howe tiefer in die Strukturen der Insulaner eindringt, stößt er allmählich zum Wesenskern der sozialen Gepflogenheiten des Eilandes vor.
Über die Insel herrscht herrscht der undurchsichtige Arristokrat Lord Summerisle. Summerisle ist der Nachfahre eines Wissenschaftlers, den es einst auf die Insel zog um dort in dem rauhen Nordseeklima robustere Obstsorten zu züchten. Gleichzeitig tauschte der Hobbyanthropologe in einem sozialen Experiment das vorherrschende Christentum gegen einen Heidenkult aus, in dem die Ehrung der Fruchtbarkeitsgöttern im Mittelpunkt ihrer religiösen Opferrituale stehen.
Howe gerät bei seinen Nachforschungen immer tiefer in dien Sog der sektenähnlichen Gemeinschaft, bis er feststellt, daß ihm, von langer Hand geplant, eine prominente Rolle bei der Besänftigung ihrer erzürnten Götter zukommen soll. Das die Insel im Vorjahr von einer Mißernte heimgesucht wurde, läßt hier nicht viel Gutes vermuten...
Was auf der Metaebene tatsächlich wie ein handfester Eingeborenenschocker anmutet, entpuppt sich bei näheren Hinsehen aber als etwas ganz anderes: The Wicker Man ist in erster Linie ein tief im Zeitgeist der späten 60er Jahre verwurzelter Film, der viele Facetten des damaligen Lebensgefühl widerspiegelt.
Die vielen Nacktscenen sind dabei nur der offensichtlichste Aspekt der Nachwehen der sexuellen Revolution. Tiefer geht da schon die Kritik an den etablierten Religionen und die Sehnsucht nach einer alternativen, ursprünglichen, lebendigen, tief in der Natur verwurzelten und frei von verkrusteten Traditionen praktizierenden Religion. In wie weit dabei der Drogengebrauch der Hippieära als prägender Ideenlieferant für die Gestaltung der Inselwelt gewesen sein mag, sei dahingestellt. Eine Parallele zur damaligen Kommunenkultur mit ihrem Wunsch, High im Einklang mit der Natur zu leben, ist aber nicht von der Hand zu weisen. Auch das schleichend einsickernde Böse in die esoterische Welt der Naturgeister, ließe sich in diesem Kontext mit Verweisen auf die Mansonsekte erklären. Lord Summerisle (Christopher Lee) als machthungriger Sektenguru ist dabei sicherlich nicht nur auf dramaturgische Fiktion zurückzuführen.
Maßgeblich zur anhaltenden Zuneigung für den Wicker Man dürfte aber ein anderer Aspekt beigetragen haben. Es ist der Wind der Freiheit und des Humors, der durch die entrückte Welt der verwilderten Dorfbewohner weht. Die Athmosphäre in dem kleinen Hafennest ist von einer anarchischen Skurillität und einem unbekümmerten, naiven Humor geprägt, der mit seinen improvisiert anmutenden Schaustellerleistungen auch Heute noch mit Wehmut auf die Leichtigkeit des Seins der frühen 70er Jahre zurückblicken läßt.
Die dezent schizoide Inszenierung von The Wicker Man könnte man wohl am ehesten als einen säuregeschwängerten Jodorowski light oder den Halloween Beitrag der Monthy Python Truppe klassifizieren.
Obwohl keinerlei Spannung erzeugt wird, übt die selbstverständlich ausgelebte Abnormität und das subversive, Konventionen sprengende Temperament, dieses in spärlich-theatralisch, halbdokumentarisch getauchten Bildern, auch Heute noch die Faszination kurioser Filmexperimente der postpsychedelischen Ära aus.
Erfrischend laienhaft agierende Schauspieler schmettern dabei in bester Musicalmanier frivole Arien in die aufgeheizte Gasthausstimmung. Da kommt Stimmung auf und Assoziationen an die Hippie hommage Hair werden geweckt. Von nervenzerfetzendem Thrill oder die Nackenhaare kräuselnden Suspense ist man aber meilenweit entfernt.
Weder bedrohen die Dorfbewohner den Protagonisten, noch fühlt Howe sich selbst bedroht. Das ganze Geschehen geht völlig gelassen seiner Wege. Hochspannung geht anders.
Dennoch erzeugt das Fremde in dem gläubigen Christen und damit symbolträchtigen Vertreter des Establishments die Andersheit und Eigenständigkeit der Inselbewohner Mißtrauen und Unbehagen.
Die Hartnäckigkeit, mit dem Howe tapfer das Credo seiner Gesellschaft gegen den Naturkult verteidigt ist putzig und aller Ehren wert. Dennoch gilt das unerbittliche Gesetz der sozialen Evolution auch hier: wo Neues entsteht, muß Altes weichen. Und so nimmt die Geschichte ihren unvermeidlichen Lauf...
Ohne genau sagen zu können, was es ist: der freie Geist, die Gesellschaftskritik, der besondere Reiz des Aussergewöhnliche oder das very britische der gesamten kleinen naiv-amateurhaften Produktion: Der Film verfügt über das gewiße Etwas.
Und wenn es am Ende doch bloß wieder nur die vielen Nackedeis sind...
Der Film verfügt über keinerlei horrortypische Elemente. Wer hier Grusel, beklemmende Athmosphäre, Terror, Splatter oder auch einfach nur spröden Nervenkitzel sucht, wird wieder mit leeren Taschen nach Hause geschickt. Bis auf eine archetypische Version des Burning Man Festivals zum Finale hin, bemüht sich der Thrillfaktor nicht, sich nennenswert über den Ruhepol seiner Null-Linie hinaus zu bewegen.
Dennoch ist der Film äußerst sehenswert.
Den Polizeiinspektor Neil Howe verschlägt es auf die kleine Insel Summerisle. Das kleine Mädchen Rowan Morrisson ist verschwunden und Howe macht sich auf die Suche nach dem Verbleib des kleinen Sonnenscheins. Und hier beginnen die Probleme: Niemand will Rowan gekannt haben. Howe stößt auf eine Mauer der Verschwiegenheit und der Verleumdung.
Außer der ablehnenden Haltung der Dorfbewohner erregt aber auch noch etwas anderes das Interesse des Gesetzeshüters: Die Inselbewohner Verhalten sich allesamt merkwürdig, um nicht zu sagen skurill. Sie haben ein sehr freizügiges Verhältniss zur Sexualität und derben Späßen.
Als Howe tiefer in die Strukturen der Insulaner eindringt, stößt er allmählich zum Wesenskern der sozialen Gepflogenheiten des Eilandes vor.
Über die Insel herrscht herrscht der undurchsichtige Arristokrat Lord Summerisle. Summerisle ist der Nachfahre eines Wissenschaftlers, den es einst auf die Insel zog um dort in dem rauhen Nordseeklima robustere Obstsorten zu züchten. Gleichzeitig tauschte der Hobbyanthropologe in einem sozialen Experiment das vorherrschende Christentum gegen einen Heidenkult aus, in dem die Ehrung der Fruchtbarkeitsgöttern im Mittelpunkt ihrer religiösen Opferrituale stehen.
Howe gerät bei seinen Nachforschungen immer tiefer in dien Sog der sektenähnlichen Gemeinschaft, bis er feststellt, daß ihm, von langer Hand geplant, eine prominente Rolle bei der Besänftigung ihrer erzürnten Götter zukommen soll. Das die Insel im Vorjahr von einer Mißernte heimgesucht wurde, läßt hier nicht viel Gutes vermuten...
Was auf der Metaebene tatsächlich wie ein handfester Eingeborenenschocker anmutet, entpuppt sich bei näheren Hinsehen aber als etwas ganz anderes: The Wicker Man ist in erster Linie ein tief im Zeitgeist der späten 60er Jahre verwurzelter Film, der viele Facetten des damaligen Lebensgefühl widerspiegelt.
Die vielen Nacktscenen sind dabei nur der offensichtlichste Aspekt der Nachwehen der sexuellen Revolution. Tiefer geht da schon die Kritik an den etablierten Religionen und die Sehnsucht nach einer alternativen, ursprünglichen, lebendigen, tief in der Natur verwurzelten und frei von verkrusteten Traditionen praktizierenden Religion. In wie weit dabei der Drogengebrauch der Hippieära als prägender Ideenlieferant für die Gestaltung der Inselwelt gewesen sein mag, sei dahingestellt. Eine Parallele zur damaligen Kommunenkultur mit ihrem Wunsch, High im Einklang mit der Natur zu leben, ist aber nicht von der Hand zu weisen. Auch das schleichend einsickernde Böse in die esoterische Welt der Naturgeister, ließe sich in diesem Kontext mit Verweisen auf die Mansonsekte erklären. Lord Summerisle (Christopher Lee) als machthungriger Sektenguru ist dabei sicherlich nicht nur auf dramaturgische Fiktion zurückzuführen.
Maßgeblich zur anhaltenden Zuneigung für den Wicker Man dürfte aber ein anderer Aspekt beigetragen haben. Es ist der Wind der Freiheit und des Humors, der durch die entrückte Welt der verwilderten Dorfbewohner weht. Die Athmosphäre in dem kleinen Hafennest ist von einer anarchischen Skurillität und einem unbekümmerten, naiven Humor geprägt, der mit seinen improvisiert anmutenden Schaustellerleistungen auch Heute noch mit Wehmut auf die Leichtigkeit des Seins der frühen 70er Jahre zurückblicken läßt.
Die dezent schizoide Inszenierung von The Wicker Man könnte man wohl am ehesten als einen säuregeschwängerten Jodorowski light oder den Halloween Beitrag der Monthy Python Truppe klassifizieren.
Obwohl keinerlei Spannung erzeugt wird, übt die selbstverständlich ausgelebte Abnormität und das subversive, Konventionen sprengende Temperament, dieses in spärlich-theatralisch, halbdokumentarisch getauchten Bildern, auch Heute noch die Faszination kurioser Filmexperimente der postpsychedelischen Ära aus.
Erfrischend laienhaft agierende Schauspieler schmettern dabei in bester Musicalmanier frivole Arien in die aufgeheizte Gasthausstimmung. Da kommt Stimmung auf und Assoziationen an die Hippie hommage Hair werden geweckt. Von nervenzerfetzendem Thrill oder die Nackenhaare kräuselnden Suspense ist man aber meilenweit entfernt.
Weder bedrohen die Dorfbewohner den Protagonisten, noch fühlt Howe sich selbst bedroht. Das ganze Geschehen geht völlig gelassen seiner Wege. Hochspannung geht anders.
Dennoch erzeugt das Fremde in dem gläubigen Christen und damit symbolträchtigen Vertreter des Establishments die Andersheit und Eigenständigkeit der Inselbewohner Mißtrauen und Unbehagen.
Die Hartnäckigkeit, mit dem Howe tapfer das Credo seiner Gesellschaft gegen den Naturkult verteidigt ist putzig und aller Ehren wert. Dennoch gilt das unerbittliche Gesetz der sozialen Evolution auch hier: wo Neues entsteht, muß Altes weichen. Und so nimmt die Geschichte ihren unvermeidlichen Lauf...
Ohne genau sagen zu können, was es ist: der freie Geist, die Gesellschaftskritik, der besondere Reiz des Aussergewöhnliche oder das very britische der gesamten kleinen naiv-amateurhaften Produktion: Der Film verfügt über das gewiße Etwas.
Und wenn es am Ende doch bloß wieder nur die vielen Nackedeis sind...
mit 4
mit 3
mit 3
mit 2
bewertet am 01.12.17 um 10:33
Applaus, Applaus. Applaus dem Mastermind Hollywoods, dem Thinktank des Silicon Valleys, dem Magier der Metaphysik, Sylvester Stallone. Dem Venen- und Mundwinkelgepimpten Hohepriester der sanften Zwischentöne ist tatsächlich das Kunststück gelungen, einen Bypass um die Evolution des Actiongenres der letzten 30 Jahre zu legen und nahtlos an die tumbe Hirnlosigkeit seiner 80er Jahre Gewaltphantasien anzuknüpfen.
Hölzerne Schnittfolgen, unbedarfte Dialoge und eine Handlung wie aus dem Kaugummiautomaten geben sich hier ungeniert die Klinke in die Hand. Was in den 80er Jahren noch State of the Art war und Heute, von der Patina der Nostalgie befallen als fragwürdiger Kult gehandelt wird, wirkt im präapokalyptischen (Erscheinungs)Jahre des Herren 2014 schlicht niveau- und ideenlos.
Statt das goldene Zeitalter der muskelbepackten One Man Killermaschinen mit den Segnungen der spöttischen Selbstironie oder des intelligenten Augenzwinkerns unseres Zeitgeistes anzureichern, persifliert Stallone sich und seine Altersgenossen bloß nur selbst und beschwört mit den Expandables die vergilbte Ära des politisch unkorrekten "old school" Actionkinos herauf. Dumm geboren und Nichts dazu gelernt möchte man hier süffisant-herablassend anmerken.
Wer also insgeheim mit naiven Optimismus auf eine Frischzellenkur alter Tugenden kultiger Peinlichkeiten gehofft hatte, wird bitterlich enttäuscht. Originalität wird unter Strafe gestellt und neue Akzente gleichem Hochverrat am System kultivierter Plumpheit.
Vielmehr sieht sich der degenerierte Videojunkie (Ich) totgeglaubter Action Hausmannskost ausgeliefert, die der unvermeidlichen Steigerungslogik folgend in ihrer brachialen Konsequenz auf die Spitze getrieben wird. Mangels nachlassender physischer Fitness übernehmen nun Heckler&Koch und ihre Verbündeten die Rolle des Rächers, wo früher noch im Ringelpitz mit Anfassen die Duelle entschieden wurden. Heuer werden in ermüdenden, nicht endenden wollenden Maschinengewehrsalven ganze Kompanien durch Enthirnung am Weiterleben gehindert. Call of Duty wirkt im Vergleich mit diesem Todestanz wie ein müder Kinderreigen.
In einer Ruinenstadt wollen Sylvester und seine Spielkameraden dem abtrünigen Ex-Expandables Conrad Stonebanks und seiner Privatarmee den endgültigen Garaus machen. In dem trostlosem Grau zerfallender Ruinen und verwitternden Bauschuttes entfaltet sich ein Rachefeldzug, in dem so humorlos gemetzelt und Krieg gespielt wird, daß die Wiedersehensfreude mit den gestandenen Recken dem Ekel des blanken Tötens weicht.
Um seine Buddys vor dem Schwächetod zu retten, schockt Stallone seine treuen Fans und verschweißt unter unmenschlichen Mühen seine beiden Gehirnzellen und manufaktiert einen Gedanken: Er läßt seine Kumpels wissen, er ziehe sich aus dem Geschäft des Söldners zurück und züchte jetzt in Ruhe Tretminen. So werden Lundgren, Stratham und co. vor dem vermeintlichen Schwächetod gerettet.
Seine ehemaligen Kampfgefährten gewieft hinters Licht geführt, heuert Sylvester, der kleine Schelm, jetzt heimlich eine kleine Schar Nachwuchspsychopaten an, die ihm bei seiner unheiligen Mission unterstützen sollen.
Obwohl Stalllone sich redliche Mühe gibt, dem Nachwuchsrudel der Anticharismaten so etwas wie Persönlichkeit auf ihre pickelübersäte Teenagerpelle zu ätzen, scheitert der Versuch, das Werk mit jugendlichem Überschwang anzureichern kläglich.
Die Leinwandpräsenz der testesterongeschwängerten Macholegenden wird nicht annährend erreicht. Männlichkeit weicht selbstverliebten Hipstertum.
Das das unwürdige halbstarke Gebaren der Rowdys in Konfrontation mit der Realität schnell an seine Grenzen stößt, ist abzusehen. Um so größer ist das Hallo, als die Edelreservisten unter Arnies Führung im kritischsten Moment der Geschichte den Weg zurück in die Arena finden...Gemeinnützige Arbeit im Behindertenheim macht halt nur halb soviel Spaß, als irgendwelchen Spielverderbern auf Kommando die Gedärme auszuweiden...
Dafür, daß das einzige Pfund, mit dem die Reihe wuchern kann, nämlich dem Schaulaufen der Altstars meiner versoffenen Jugend, zu Gunsten einer primitiven Gewaltorgie so sträflich vernachläßigt wurde, gibt es keine Entschuldigung. Ich hatte gehofft, mich noch einmal am bierschalen Geschmack endloser VHS Nächte aus der ersten Jugend laben zu dürfen. Aber Pustekuchen. Nicht einmal der Würgegriff pappiger Aldichips bot sich mir erneut zum Genusse an. Der schäbige Selbstekel alter verdumpfter Video Zeiten wollte sich einfach nicht mehr einstellen. Wo bleibt die Daseinsberechtigung Stallones Alter Egos, wenn sie es nicht einmal mehr vermögen, die alten verrosteten Nostalgiesynapsen noch einmal etwas wach zu kitzeln?
Statt auf die Hauptattraktion abgehalfteter Actionikonen zu setzen und ihnen durch allerlei neckische Kabbeleien einen würdigen Abgang durch die Hintertür der Produktionshallen, direkt in das Walhalla der Martial Arts Artisten zu ermöglichen, verbergen diese sich hinter Schutz-und Panzeranzügen, Wackelkameras, Nebenrollendialogen und Horden von Stuntmännern.
Dafür, daß man den aussterbenden Schlag von Akteuren nicht aussreichend ins Rampenlicht gerückt und vermehrt auf zwischenmenschliche Interaktion gesetzt hat, die das Salz in der Suppe bei diesem Cast gewesen wären, sind die wohlwollenden 2 Punkte eigentlich schon fast 2 zuviel!
Hölzerne Schnittfolgen, unbedarfte Dialoge und eine Handlung wie aus dem Kaugummiautomaten geben sich hier ungeniert die Klinke in die Hand. Was in den 80er Jahren noch State of the Art war und Heute, von der Patina der Nostalgie befallen als fragwürdiger Kult gehandelt wird, wirkt im präapokalyptischen (Erscheinungs)Jahre des Herren 2014 schlicht niveau- und ideenlos.
Statt das goldene Zeitalter der muskelbepackten One Man Killermaschinen mit den Segnungen der spöttischen Selbstironie oder des intelligenten Augenzwinkerns unseres Zeitgeistes anzureichern, persifliert Stallone sich und seine Altersgenossen bloß nur selbst und beschwört mit den Expandables die vergilbte Ära des politisch unkorrekten "old school" Actionkinos herauf. Dumm geboren und Nichts dazu gelernt möchte man hier süffisant-herablassend anmerken.
Wer also insgeheim mit naiven Optimismus auf eine Frischzellenkur alter Tugenden kultiger Peinlichkeiten gehofft hatte, wird bitterlich enttäuscht. Originalität wird unter Strafe gestellt und neue Akzente gleichem Hochverrat am System kultivierter Plumpheit.
Vielmehr sieht sich der degenerierte Videojunkie (Ich) totgeglaubter Action Hausmannskost ausgeliefert, die der unvermeidlichen Steigerungslogik folgend in ihrer brachialen Konsequenz auf die Spitze getrieben wird. Mangels nachlassender physischer Fitness übernehmen nun Heckler&Koch und ihre Verbündeten die Rolle des Rächers, wo früher noch im Ringelpitz mit Anfassen die Duelle entschieden wurden. Heuer werden in ermüdenden, nicht endenden wollenden Maschinengewehrsalven ganze Kompanien durch Enthirnung am Weiterleben gehindert. Call of Duty wirkt im Vergleich mit diesem Todestanz wie ein müder Kinderreigen.
In einer Ruinenstadt wollen Sylvester und seine Spielkameraden dem abtrünigen Ex-Expandables Conrad Stonebanks und seiner Privatarmee den endgültigen Garaus machen. In dem trostlosem Grau zerfallender Ruinen und verwitternden Bauschuttes entfaltet sich ein Rachefeldzug, in dem so humorlos gemetzelt und Krieg gespielt wird, daß die Wiedersehensfreude mit den gestandenen Recken dem Ekel des blanken Tötens weicht.
Um seine Buddys vor dem Schwächetod zu retten, schockt Stallone seine treuen Fans und verschweißt unter unmenschlichen Mühen seine beiden Gehirnzellen und manufaktiert einen Gedanken: Er läßt seine Kumpels wissen, er ziehe sich aus dem Geschäft des Söldners zurück und züchte jetzt in Ruhe Tretminen. So werden Lundgren, Stratham und co. vor dem vermeintlichen Schwächetod gerettet.
Seine ehemaligen Kampfgefährten gewieft hinters Licht geführt, heuert Sylvester, der kleine Schelm, jetzt heimlich eine kleine Schar Nachwuchspsychopaten an, die ihm bei seiner unheiligen Mission unterstützen sollen.
Obwohl Stalllone sich redliche Mühe gibt, dem Nachwuchsrudel der Anticharismaten so etwas wie Persönlichkeit auf ihre pickelübersäte Teenagerpelle zu ätzen, scheitert der Versuch, das Werk mit jugendlichem Überschwang anzureichern kläglich.
Die Leinwandpräsenz der testesterongeschwängerten Macholegenden wird nicht annährend erreicht. Männlichkeit weicht selbstverliebten Hipstertum.
Das das unwürdige halbstarke Gebaren der Rowdys in Konfrontation mit der Realität schnell an seine Grenzen stößt, ist abzusehen. Um so größer ist das Hallo, als die Edelreservisten unter Arnies Führung im kritischsten Moment der Geschichte den Weg zurück in die Arena finden...Gemeinnützige Arbeit im Behindertenheim macht halt nur halb soviel Spaß, als irgendwelchen Spielverderbern auf Kommando die Gedärme auszuweiden...
Dafür, daß das einzige Pfund, mit dem die Reihe wuchern kann, nämlich dem Schaulaufen der Altstars meiner versoffenen Jugend, zu Gunsten einer primitiven Gewaltorgie so sträflich vernachläßigt wurde, gibt es keine Entschuldigung. Ich hatte gehofft, mich noch einmal am bierschalen Geschmack endloser VHS Nächte aus der ersten Jugend laben zu dürfen. Aber Pustekuchen. Nicht einmal der Würgegriff pappiger Aldichips bot sich mir erneut zum Genusse an. Der schäbige Selbstekel alter verdumpfter Video Zeiten wollte sich einfach nicht mehr einstellen. Wo bleibt die Daseinsberechtigung Stallones Alter Egos, wenn sie es nicht einmal mehr vermögen, die alten verrosteten Nostalgiesynapsen noch einmal etwas wach zu kitzeln?
Statt auf die Hauptattraktion abgehalfteter Actionikonen zu setzen und ihnen durch allerlei neckische Kabbeleien einen würdigen Abgang durch die Hintertür der Produktionshallen, direkt in das Walhalla der Martial Arts Artisten zu ermöglichen, verbergen diese sich hinter Schutz-und Panzeranzügen, Wackelkameras, Nebenrollendialogen und Horden von Stuntmännern.
Dafür, daß man den aussterbenden Schlag von Akteuren nicht aussreichend ins Rampenlicht gerückt und vermehrt auf zwischenmenschliche Interaktion gesetzt hat, die das Salz in der Suppe bei diesem Cast gewesen wären, sind die wohlwollenden 2 Punkte eigentlich schon fast 2 zuviel!
mit 2
mit 4
mit 4
mit 2
bewertet am 01.12.17 um 10:25
Um es gleich vorweg zu verraten: T2 funktioniert immer noch gut und macht genauso viel Spaß wie damals.
Zum Glück verzichtet Regisseur Danny Boyle darauf, den monolitischen Vorgänger zu kopieren. Es wäre unverzeihlich gewesen, das fortgeschrittene Alter der gesetzten Herren zu kaschieren und sie erneut auf eine Tour de force durch die Subkultur Edinburghs zu jagen. Krampfhaft auf der Suche nach Schenkelklopfern, Schwänken und Zoten, die dem frühen Erwachsenenalter zu eigen gewesen sind. So ein Glaubwürdigkeitsverlust hätte den Film ruiniert.
Die Jugend ist nunmal vorbei, die erste Euphorie des Lebens verklungen und der harte Kampf ums Überleben hat sie alle am Schlawittchen.
Was nicht heißen soll, daß die alte Clique um Mark, Sick Boy, Spud und Begbie in Würde gealtert und hochgeschätzte Mitglieder unserer Gesellschaft geworden sind. Im Gegenteil: Sie alle wühlen nach wie vor im tiefsten Dreck. Die soziale Prägung fordert eben unerbittlich ihren Tribut. Ken Loach läßt grüßen.
Begbie sitzt immer noch im Gefängnis, Sick Boy erpresst Promis mit Sex Videos, Spud ist zwar Vater, verzweifelt aber zunehmend an seiner Heroinsucht.
Mark hat sein Glück in Amsterdam versucht, kehrt aber jetzt, 20 Jahre nach Trainspotting, gescheitert in seine alte Heimat zurück.
Nachdem Mark im Schnellverfahren alte Rechnungen mit Sick Boy beglichen hat und cotherapeutisch Spuds Drogenentzug begleitet, basteln das Dreigestirn an einer neuen goldenen Zukunft: Man will Puffbesitzer werden.
Alles könnte nun ach so rosig werden, wäre Begbie nicht just in diesem Moment aus der Haftanstalt ausgebrochen. Immer noch der unberechenbare Psychopath von einst, erfährt er von der Reunion der alten Gang und wittert seine Chance, Vergeltung an seinen ehemaligen Weggefährten zu üben.
Die Rachestory um Begbie, der sich vom quälenden Schmerz des peinigenden Stachels seines Trainspotting Beschisstraumatas befreien will, der ihn Jahrzehnte seines Lebens kostete, bildet aber nur die grobe Rahmenhandlung von T2.
Im Grunde ist der Film mehr eine lose assozierte Aneinanderreihung skurriler Einfälle, Charakterstudie liebenswerter Exoten und Zeitgeistkritik. Die Reanimation des subversiven Underground Kultstreifens folgt derselben Bildsprache wie das Original. und auch die stilistischen Finessen von einst setzen erneut erfrischende Akzente.
Die Protagonisten sind ihren verkorksten Charakteren treu geblieben und von einer von Reue und Selbstverleugnung getriebene Wandlung vom Saulus zu Paulus ist weit und breit nichts zu sehen. Die Adoleszens läßt sich nüchtern betrachtet getrost als gescheitert diagnostizieren und von einem erfolgreich durchlaufenem "coming of age" ist man meilenweit entfernt. Sie wird sogar in Frage gestellt und als akademisch-literarisch aristokratische Emotionshascherei entlarvt. Hallo Wirklichkeit!
Das soziale Millieu in dem Mark & co sich bewegen ist immer noch die untere Mittelschicht der Arbeiterklasse. Vom Schmutz und der Patina des Verfalls geschlagen, kämpft man in diesem von schrägen Typen durchzogenen Loserhabitat nach wie vor um nichts weniger als das Existenzminimum.
All das trägt ebenso wie die gewohnte kühl-ästhetische Inszenierung mit dazu bei, daß der alte Spirit den Sprung in die Gegenwart unbeschadet überstanden hat.
Da es ein unmögliches Unterfangen gewesen wäre, die anarchistische Urgewalt des Originales wieder zu reanimieren, erscheint T2 als die bestmögliche und glaubwürdigste Fortsetzung.
Das Mark, Spud und co in dieser hochdigitalisierten Welt nur noch als abgehängte, analoge Auslaufmodelle fungieren können, ist dabei natürlich Ehrensache.
Zum Glück verzichtet Regisseur Danny Boyle darauf, den monolitischen Vorgänger zu kopieren. Es wäre unverzeihlich gewesen, das fortgeschrittene Alter der gesetzten Herren zu kaschieren und sie erneut auf eine Tour de force durch die Subkultur Edinburghs zu jagen. Krampfhaft auf der Suche nach Schenkelklopfern, Schwänken und Zoten, die dem frühen Erwachsenenalter zu eigen gewesen sind. So ein Glaubwürdigkeitsverlust hätte den Film ruiniert.
Die Jugend ist nunmal vorbei, die erste Euphorie des Lebens verklungen und der harte Kampf ums Überleben hat sie alle am Schlawittchen.
Was nicht heißen soll, daß die alte Clique um Mark, Sick Boy, Spud und Begbie in Würde gealtert und hochgeschätzte Mitglieder unserer Gesellschaft geworden sind. Im Gegenteil: Sie alle wühlen nach wie vor im tiefsten Dreck. Die soziale Prägung fordert eben unerbittlich ihren Tribut. Ken Loach läßt grüßen.
Begbie sitzt immer noch im Gefängnis, Sick Boy erpresst Promis mit Sex Videos, Spud ist zwar Vater, verzweifelt aber zunehmend an seiner Heroinsucht.
Mark hat sein Glück in Amsterdam versucht, kehrt aber jetzt, 20 Jahre nach Trainspotting, gescheitert in seine alte Heimat zurück.
Nachdem Mark im Schnellverfahren alte Rechnungen mit Sick Boy beglichen hat und cotherapeutisch Spuds Drogenentzug begleitet, basteln das Dreigestirn an einer neuen goldenen Zukunft: Man will Puffbesitzer werden.
Alles könnte nun ach so rosig werden, wäre Begbie nicht just in diesem Moment aus der Haftanstalt ausgebrochen. Immer noch der unberechenbare Psychopath von einst, erfährt er von der Reunion der alten Gang und wittert seine Chance, Vergeltung an seinen ehemaligen Weggefährten zu üben.
Die Rachestory um Begbie, der sich vom quälenden Schmerz des peinigenden Stachels seines Trainspotting Beschisstraumatas befreien will, der ihn Jahrzehnte seines Lebens kostete, bildet aber nur die grobe Rahmenhandlung von T2.
Im Grunde ist der Film mehr eine lose assozierte Aneinanderreihung skurriler Einfälle, Charakterstudie liebenswerter Exoten und Zeitgeistkritik. Die Reanimation des subversiven Underground Kultstreifens folgt derselben Bildsprache wie das Original. und auch die stilistischen Finessen von einst setzen erneut erfrischende Akzente.
Die Protagonisten sind ihren verkorksten Charakteren treu geblieben und von einer von Reue und Selbstverleugnung getriebene Wandlung vom Saulus zu Paulus ist weit und breit nichts zu sehen. Die Adoleszens läßt sich nüchtern betrachtet getrost als gescheitert diagnostizieren und von einem erfolgreich durchlaufenem "coming of age" ist man meilenweit entfernt. Sie wird sogar in Frage gestellt und als akademisch-literarisch aristokratische Emotionshascherei entlarvt. Hallo Wirklichkeit!
Das soziale Millieu in dem Mark & co sich bewegen ist immer noch die untere Mittelschicht der Arbeiterklasse. Vom Schmutz und der Patina des Verfalls geschlagen, kämpft man in diesem von schrägen Typen durchzogenen Loserhabitat nach wie vor um nichts weniger als das Existenzminimum.
All das trägt ebenso wie die gewohnte kühl-ästhetische Inszenierung mit dazu bei, daß der alte Spirit den Sprung in die Gegenwart unbeschadet überstanden hat.
Da es ein unmögliches Unterfangen gewesen wäre, die anarchistische Urgewalt des Originales wieder zu reanimieren, erscheint T2 als die bestmögliche und glaubwürdigste Fortsetzung.
Das Mark, Spud und co in dieser hochdigitalisierten Welt nur noch als abgehängte, analoge Auslaufmodelle fungieren können, ist dabei natürlich Ehrensache.
mit 4
mit 4
mit 4
mit 2
bewertet am 16.11.17 um 14:26
Mäßiger Tim Burton Hybrid, der mal wieder unentschieden im luftleeren Raum zwischen Fantasy, Horror und Kunstfilm laviert, ohne sich jedoch auf ein bestimmtes Genre festzulegen.
Burton's bizarres Skurillitätenkabinett dümpelt in der ersten Hälfte schwerfällig vor sich hin, bevor er nach einer Stunde allmählich in Schwung kommt und der Kampf Gut gegen Böse Fahrt aufnimmt. In abgeschwächter X-Men Superheldenmanier verteidigen dann die Zöglinge um Miss Peregrin ihre Art gegen eine Clique gefräßiger Monster, deren Leibspeise die leuchtenden Augen der Kinder mit besonderem Förderbedarf sind. Ja, da kommt Freude auf...
Auch wenn der Showdown mit einigen Witzeleien und Technikmätzchen die Längen der Ersten Hälfte wieder wett macht, werd ich mit Burtons Filmen selten warm. Mir fällt es schwer, mich in den Film hineinzufühlen, da im rasanten Wechsel so nahtlos zwischen Romanze, Grusel und Kunstfilm hin- und zurück gewechselt wird, daß sich für mich die "Seele" des Filmes nicht erspüren läßt.
Auch ist die Kluft zwischen trauter Hogwarth's Harry Potter Kinderfilmharmonie und furchteinflößenden Creaturedesign zu eklatant, als daß ich sie athmosphärisch unter einen Hut gekriegt hätte. Die Insel...ist weder ein gemütlicher Kinderfantasysonntagnachmittag streifen, noch ein thrillender Horrorfilm geworden. Nix Halbes und nichts Ganzes. Nichtmal ein guter Crossover Projekt, sondern nur ein irgendwie ganz passabel unterhaltenes Garnichts.
Erschwerend muß ich hinzufügen, daß mir die Kinder mit ihren Fähigkeiten nicht gefallen haben. Sie waren mir schlicht zu langweilig und simpel konstruiert. Mehr Kreativität hätte der Buchvorlage besser zu Gesicht gestanden. Die meisten besonderen Fähigkeiten der Kids empfand ich eher wie bemitleidenswerte Behinderungen als beneidenswerte Extrabegabungen, wirken konstruiert bizarr aber eben nicht abgefahren cool.
So tragen viele kleine Details dazu bei, daß mir der Film bis zum Ende hin unzugänglich geblieben ist und ich ihn zwar interessiert, aber innerlich unbeteiligt über mich ergehen ließ.
Andererseits wird man es aber auch nicht bereuen, einmal mehr die Welt aus der ungewöhnlichen Perspektive des Regisseursonderlings zu betrachten.
Das 3D Bild mit seinen zahlreichen Geisterbildern ist jedoch keiner Ehren Wert.
Burton's bizarres Skurillitätenkabinett dümpelt in der ersten Hälfte schwerfällig vor sich hin, bevor er nach einer Stunde allmählich in Schwung kommt und der Kampf Gut gegen Böse Fahrt aufnimmt. In abgeschwächter X-Men Superheldenmanier verteidigen dann die Zöglinge um Miss Peregrin ihre Art gegen eine Clique gefräßiger Monster, deren Leibspeise die leuchtenden Augen der Kinder mit besonderem Förderbedarf sind. Ja, da kommt Freude auf...
Auch wenn der Showdown mit einigen Witzeleien und Technikmätzchen die Längen der Ersten Hälfte wieder wett macht, werd ich mit Burtons Filmen selten warm. Mir fällt es schwer, mich in den Film hineinzufühlen, da im rasanten Wechsel so nahtlos zwischen Romanze, Grusel und Kunstfilm hin- und zurück gewechselt wird, daß sich für mich die "Seele" des Filmes nicht erspüren läßt.
Auch ist die Kluft zwischen trauter Hogwarth's Harry Potter Kinderfilmharmonie und furchteinflößenden Creaturedesign zu eklatant, als daß ich sie athmosphärisch unter einen Hut gekriegt hätte. Die Insel...ist weder ein gemütlicher Kinderfantasysonntagnachmittag streifen, noch ein thrillender Horrorfilm geworden. Nix Halbes und nichts Ganzes. Nichtmal ein guter Crossover Projekt, sondern nur ein irgendwie ganz passabel unterhaltenes Garnichts.
Erschwerend muß ich hinzufügen, daß mir die Kinder mit ihren Fähigkeiten nicht gefallen haben. Sie waren mir schlicht zu langweilig und simpel konstruiert. Mehr Kreativität hätte der Buchvorlage besser zu Gesicht gestanden. Die meisten besonderen Fähigkeiten der Kids empfand ich eher wie bemitleidenswerte Behinderungen als beneidenswerte Extrabegabungen, wirken konstruiert bizarr aber eben nicht abgefahren cool.
So tragen viele kleine Details dazu bei, daß mir der Film bis zum Ende hin unzugänglich geblieben ist und ich ihn zwar interessiert, aber innerlich unbeteiligt über mich ergehen ließ.
Andererseits wird man es aber auch nicht bereuen, einmal mehr die Welt aus der ungewöhnlichen Perspektive des Regisseursonderlings zu betrachten.
Das 3D Bild mit seinen zahlreichen Geisterbildern ist jedoch keiner Ehren Wert.
mit 3
mit 4
mit 4
mit 2
bewertet am 15.11.17 um 12:03
Ebenso wie Blade Runner 2049 und Passengers, huldigt auch Arrival den somnulenten Göttern des Downtempo. Entschleunigung scheint das Gebot der Stunde im Sci-Fi Genre zu sein und Actionoverkill weicht den vermeintlich leiseren und subtileren zwischenmenschlichen Untertönen.
So setzt sich auch Arrival nicht den grell kreischenden, alles entblößenden Studioscheinwerfen Hollywoods aus, sondern spielt fast ausschließlich in bester Arthousemanier im vage verschleiernden Dämmerlicht, welche die Athmosphäre beinahe mystisch auflädt, so, als finde die Geschichte irgendwo in einer Zwischenwelt statt. Hochglanz Ade.
Die stetige Enttäuschung der Sehgewohnheiten und der konsequente Verzicht auf genretypische Eyecandys erfordert einiges an Toleranz, fordert den Zuschauer aber auch zu intensiveren Hinsehen auf, was eine gewiße Sogwirkung entfaltet, die den Zuschauer näher an das Geschehen fesselt.
Ebenso wie die geschickt angewandten psychologischen visuellen Finessen der Produktion halten die Athmosphäre der bedrohlichen Ungewißheit, der hervorragend soverän-unaufgeregt agierende Cast und die meisterhafte Kamerarbeit den Zuschauer bei der Stange. So gesehen ist Arrival in gewißer Weise ein gehobenes Cineastisches Vergnügen. In vielen Disziplienen liefern die Verantwortlichen oscarreife Arbeit ab.
Woran der Film aber letztendlich krankt, ist der wesentliche Aspekt dieser Kunstform: Die Handlung. Die Handlung von Arrival ist lahm. Lahm und zäh bis an die Grenze des erlaubten.
Zwölf Monolithen positionieren sich über dem Erdball, unmittelbar in Bodennähe. Alle 18 Stunden öfnnet sich eine Luke und gibt Forschern die Gelegenheit, das innere des Raumschiffes zu erkunden. Dies geschieht schon sehr früh, nach ca. 10 min Spieldauer.
Im inneren des Monolithen treffen die Forscher auf 2 ausserirdische Riesenktaken, die hinter einer Glaswand in ihrer eingen diesigen Athmosphäre leben und nur schemenhaft in Erscheinung treten, um ihren glibbrigen Kadaver hinter einen Schleier des Schames zu verbergen.
Die Aufgabe der Forscher um Dr. Louise Blanks (Amy Adams) herum besteht nun darin, mit den Alliens Kontakt aufzunehmen. Dies erweist sich als unendlich kompliziert, da die 7 Beinigen, Octopusse mit einer Art Tinte schreiben, die aus einer ihrer Tentakeln abgesondert wird und sich zu kurzlebigen unförmig kreisrunden Sympolen verdichtet.
Und genau hier hört die Handlung quasi auch schon auf. Die Entschlüßelung dieser Symbole karpert jetzt die restliche Zeit des Filmes. Immer wieder unterbrochen durch kurze Erinnerungsfetzen Blanks und kurzen Seitenblicken auf die globale Großwetterlage, konzentriert sich der Film ab jetzt ausschließlich auf die Entschlüßelung der Kreiszeichen.
Und das ist entschieden zu wenig! Auch wenn Regisseur Dennis Villeneuve seine Akzente bewußt auf ein gewißes Maß an "Realitätsnähe" setzt und auch eine sich zart anbahnende Liebesgeschichte zwischen Blanks und ihrem Assistenten Ian Donnelly (Jeremy Renner) ihre Beachtung findet, ist die Kost doch allzu mager. Es ist kein Verbrechen, Bezüge zur menschlichen Realität herzustellen. Eine Handlung darf aber nicht 90 min. auf ein und derselben Stelle herumtreten. Das es am Schluß dann noch so etwas wie einen Clou gibt, ist dann auch wohl das Mindeste an Unterhaltung, mit dem ein zahlender Kunde entschädigt werden muß.
Es spricht nichts gegen einen behutsamen Spannungsaufbau. Wenn dieses als stilistisches Mittel als Ruhe vor dem Sturm eingesetzt wird, in dem Spannung aufgebaut wird, die sich dann in einem furiosem Finale entlädt, wie beispielsweise in Contact.
Es ist die falsche Antwort auf die berechtigte Kritik am Blockbusterkino, den überbordenen Bilderrausch des Marveluniversums nicht mit Substanz zu unterfüttern, jetzt das Pendel ins gegenseitige Extrem schlagen zu lassen: Filme auf die Welt loszulassen die zwar in der Lage sind, gewiße Anspruchspunkte einzuheimsen, aus reinem Trotz aber einer unnötigen Spannungsphobie fröhnen und nüchtern betrachtet einfach todlangweilig sind. Anspruch auf Daseinsberechtigung nur auf Grund gehobener schauspielerischer Qualitäten und ästhetisch gestaltetem Bildmaterial zu ziehen, ist zu wenig! Anspruch darf kein Selbstzweck und kein Ersatz für Unterhaltung sein. Aber man kann's ja anscheinend mal versuchen ...
So setzt sich auch Arrival nicht den grell kreischenden, alles entblößenden Studioscheinwerfen Hollywoods aus, sondern spielt fast ausschließlich in bester Arthousemanier im vage verschleiernden Dämmerlicht, welche die Athmosphäre beinahe mystisch auflädt, so, als finde die Geschichte irgendwo in einer Zwischenwelt statt. Hochglanz Ade.
Die stetige Enttäuschung der Sehgewohnheiten und der konsequente Verzicht auf genretypische Eyecandys erfordert einiges an Toleranz, fordert den Zuschauer aber auch zu intensiveren Hinsehen auf, was eine gewiße Sogwirkung entfaltet, die den Zuschauer näher an das Geschehen fesselt.
Ebenso wie die geschickt angewandten psychologischen visuellen Finessen der Produktion halten die Athmosphäre der bedrohlichen Ungewißheit, der hervorragend soverän-unaufgeregt agierende Cast und die meisterhafte Kamerarbeit den Zuschauer bei der Stange. So gesehen ist Arrival in gewißer Weise ein gehobenes Cineastisches Vergnügen. In vielen Disziplienen liefern die Verantwortlichen oscarreife Arbeit ab.
Woran der Film aber letztendlich krankt, ist der wesentliche Aspekt dieser Kunstform: Die Handlung. Die Handlung von Arrival ist lahm. Lahm und zäh bis an die Grenze des erlaubten.
Zwölf Monolithen positionieren sich über dem Erdball, unmittelbar in Bodennähe. Alle 18 Stunden öfnnet sich eine Luke und gibt Forschern die Gelegenheit, das innere des Raumschiffes zu erkunden. Dies geschieht schon sehr früh, nach ca. 10 min Spieldauer.
Im inneren des Monolithen treffen die Forscher auf 2 ausserirdische Riesenktaken, die hinter einer Glaswand in ihrer eingen diesigen Athmosphäre leben und nur schemenhaft in Erscheinung treten, um ihren glibbrigen Kadaver hinter einen Schleier des Schames zu verbergen.
Die Aufgabe der Forscher um Dr. Louise Blanks (Amy Adams) herum besteht nun darin, mit den Alliens Kontakt aufzunehmen. Dies erweist sich als unendlich kompliziert, da die 7 Beinigen, Octopusse mit einer Art Tinte schreiben, die aus einer ihrer Tentakeln abgesondert wird und sich zu kurzlebigen unförmig kreisrunden Sympolen verdichtet.
Und genau hier hört die Handlung quasi auch schon auf. Die Entschlüßelung dieser Symbole karpert jetzt die restliche Zeit des Filmes. Immer wieder unterbrochen durch kurze Erinnerungsfetzen Blanks und kurzen Seitenblicken auf die globale Großwetterlage, konzentriert sich der Film ab jetzt ausschließlich auf die Entschlüßelung der Kreiszeichen.
Und das ist entschieden zu wenig! Auch wenn Regisseur Dennis Villeneuve seine Akzente bewußt auf ein gewißes Maß an "Realitätsnähe" setzt und auch eine sich zart anbahnende Liebesgeschichte zwischen Blanks und ihrem Assistenten Ian Donnelly (Jeremy Renner) ihre Beachtung findet, ist die Kost doch allzu mager. Es ist kein Verbrechen, Bezüge zur menschlichen Realität herzustellen. Eine Handlung darf aber nicht 90 min. auf ein und derselben Stelle herumtreten. Das es am Schluß dann noch so etwas wie einen Clou gibt, ist dann auch wohl das Mindeste an Unterhaltung, mit dem ein zahlender Kunde entschädigt werden muß.
Es spricht nichts gegen einen behutsamen Spannungsaufbau. Wenn dieses als stilistisches Mittel als Ruhe vor dem Sturm eingesetzt wird, in dem Spannung aufgebaut wird, die sich dann in einem furiosem Finale entlädt, wie beispielsweise in Contact.
Es ist die falsche Antwort auf die berechtigte Kritik am Blockbusterkino, den überbordenen Bilderrausch des Marveluniversums nicht mit Substanz zu unterfüttern, jetzt das Pendel ins gegenseitige Extrem schlagen zu lassen: Filme auf die Welt loszulassen die zwar in der Lage sind, gewiße Anspruchspunkte einzuheimsen, aus reinem Trotz aber einer unnötigen Spannungsphobie fröhnen und nüchtern betrachtet einfach todlangweilig sind. Anspruch auf Daseinsberechtigung nur auf Grund gehobener schauspielerischer Qualitäten und ästhetisch gestaltetem Bildmaterial zu ziehen, ist zu wenig! Anspruch darf kein Selbstzweck und kein Ersatz für Unterhaltung sein. Aber man kann's ja anscheinend mal versuchen ...
mit 2
mit 4
mit 4
mit 2
bewertet am 12.11.17 um 11:23
Ein Cyborg auf der Suche nach seiner Herkunft.
Mayor Mira Killian, ein Mischwesen aus Mensch und Roboter, seiner humanoiden Erinnerung beraubt und als Waffe mißbraucht, wird zur Gefahr für die "Company" Hanka Robotics, als sie der Spur ihrer feuerdurchtränkten Visionen folgt, die sie zurück zum Ursprung ihrer wahren Identität führen.
Somit erfindet Ghost in the Shell das Rad nicht neu, sondern im Gegenteil, arbeitet sich an dem zentralen philosophischen Thema des Androidengenres, der Selbstfindung, ab.
Eingebettet ist dies in eine visuell berauschende Achterbahnfahrt durch die Katakomben und Skylines einer futuristischen Megacity, in der Mira auf den Androiden Kuze trift. Es kristallisiert sich bald heraus, daß Kuze ein misglücktes und in Ungnade gefallenes Vorläufermodel Miras ist, der sich an Hanka Robotics rächen und Mira ihre Vergangenheit zurückbringen will...
Obwohl Ghost in the Shell thematisch am Wesenskern unserer Identität laboriert, wagt er zu keiner Zeit den Schritt ins ernsthaft schwermütig-philosophische Terrain, sondern versteift sich in erster Linie auf Action, Style und optische Schauwerte. So gelingt es denn den fragmentarisch verknüpften Einzelscenen auch nicht, so visuell bestechend sie auch gestaltet sein mögen, einen Erzählfluss zu generieren, der den Zuschauer in seinen Bann schlägt. Anstatt auf Tiefe und Qualität zu setzen, operiert der Film lieber mit Mangatypischer Bildsprache, stereotypischen Dialogen und Charakteren.
Die Übersetzung von Anime aufs reale Tableau kann eben nur bedingt gelingen. Verschiedene Medien bedingen spezifische Realitäten, deren Gesetzmäßigkeiten auf anderen Ebenen nicht funktionieren.
Was im Manga noch funktioniert, wirkt im Land aus Fleisch und Blut dann eben doch Blutarm und unterkühlt.
Dennoch überzeugt der Film mit Kulissen, gegen diejenigen aus dem hochgehypten Blade Runner Reboot, verblaßen. Wenn die dystopischen Hochhausschluchten aus Blade Runner 2049 der Aperetif beim Curry-König sind, dann ist die Cyberpunkwelt aus Ghost in the Shell das 3 Gänge Hauptmenü in einer 5 Sterne Promiklitsche.
Die Kamerafahrten duch den futuristischen Wolkenkratzerdschungel, in dem sich eine Unzahl turmhoher Werbehologramme tummeln, die um die Gunst des werten Konsumenten buhlen, gehört mit zum spektakulärsten, was die kleinen Kreativlümmel aus der Traumfabrik im letzten Semester aus ihren Kisten gezaubert haben.
Das dabei die Geschichte nur Mittelmaß bleibt, ist bei dieser überwältigenden Optik beinahe nur Nebensache, da sie doch insgesamt relativ kurzweilig gehalten ist und die Ästhetik auch ohne oscarwürdige Verrenkungen der Protagonisten bereits alleine Unterhält.
Beinahe wäre ich sogar geneigt zu sagen, Ghost in the Shell ist mit seiner athmosphärischen Dichte der Film geworden, der der Überlangweiler Blade Runner 2049 hätte sein sollen.
Eine Symbiose der beiden Filme wäre wohl der ultimative Science- Fiction Film dieser Generation geworden.
Wenn möglich, Ghost in the Shell bitte unbedingt in 3D bestaunen, obwohl einzelne Scenen eine sträflich schludrige Behandlung erdulden mußten. Andersweitig würden die Sinne um einen erhabenen Rausch betrogen..
Mayor Mira Killian, ein Mischwesen aus Mensch und Roboter, seiner humanoiden Erinnerung beraubt und als Waffe mißbraucht, wird zur Gefahr für die "Company" Hanka Robotics, als sie der Spur ihrer feuerdurchtränkten Visionen folgt, die sie zurück zum Ursprung ihrer wahren Identität führen.
Somit erfindet Ghost in the Shell das Rad nicht neu, sondern im Gegenteil, arbeitet sich an dem zentralen philosophischen Thema des Androidengenres, der Selbstfindung, ab.
Eingebettet ist dies in eine visuell berauschende Achterbahnfahrt durch die Katakomben und Skylines einer futuristischen Megacity, in der Mira auf den Androiden Kuze trift. Es kristallisiert sich bald heraus, daß Kuze ein misglücktes und in Ungnade gefallenes Vorläufermodel Miras ist, der sich an Hanka Robotics rächen und Mira ihre Vergangenheit zurückbringen will...
Obwohl Ghost in the Shell thematisch am Wesenskern unserer Identität laboriert, wagt er zu keiner Zeit den Schritt ins ernsthaft schwermütig-philosophische Terrain, sondern versteift sich in erster Linie auf Action, Style und optische Schauwerte. So gelingt es denn den fragmentarisch verknüpften Einzelscenen auch nicht, so visuell bestechend sie auch gestaltet sein mögen, einen Erzählfluss zu generieren, der den Zuschauer in seinen Bann schlägt. Anstatt auf Tiefe und Qualität zu setzen, operiert der Film lieber mit Mangatypischer Bildsprache, stereotypischen Dialogen und Charakteren.
Die Übersetzung von Anime aufs reale Tableau kann eben nur bedingt gelingen. Verschiedene Medien bedingen spezifische Realitäten, deren Gesetzmäßigkeiten auf anderen Ebenen nicht funktionieren.
Was im Manga noch funktioniert, wirkt im Land aus Fleisch und Blut dann eben doch Blutarm und unterkühlt.
Dennoch überzeugt der Film mit Kulissen, gegen diejenigen aus dem hochgehypten Blade Runner Reboot, verblaßen. Wenn die dystopischen Hochhausschluchten aus Blade Runner 2049 der Aperetif beim Curry-König sind, dann ist die Cyberpunkwelt aus Ghost in the Shell das 3 Gänge Hauptmenü in einer 5 Sterne Promiklitsche.
Die Kamerafahrten duch den futuristischen Wolkenkratzerdschungel, in dem sich eine Unzahl turmhoher Werbehologramme tummeln, die um die Gunst des werten Konsumenten buhlen, gehört mit zum spektakulärsten, was die kleinen Kreativlümmel aus der Traumfabrik im letzten Semester aus ihren Kisten gezaubert haben.
Das dabei die Geschichte nur Mittelmaß bleibt, ist bei dieser überwältigenden Optik beinahe nur Nebensache, da sie doch insgesamt relativ kurzweilig gehalten ist und die Ästhetik auch ohne oscarwürdige Verrenkungen der Protagonisten bereits alleine Unterhält.
Beinahe wäre ich sogar geneigt zu sagen, Ghost in the Shell ist mit seiner athmosphärischen Dichte der Film geworden, der der Überlangweiler Blade Runner 2049 hätte sein sollen.
Eine Symbiose der beiden Filme wäre wohl der ultimative Science- Fiction Film dieser Generation geworden.
Wenn möglich, Ghost in the Shell bitte unbedingt in 3D bestaunen, obwohl einzelne Scenen eine sträflich schludrige Behandlung erdulden mußten. Andersweitig würden die Sinne um einen erhabenen Rausch betrogen..
mit 4
mit 4
mit 4
mit 2
bewertet am 11.11.17 um 11:35
Sammy's Werdegang durch unsere 7 Weltmeere auf der Suche nach nicht enden wollenden Spaß, Abenteuer, einer geheimen Passage und schlußendlich natürlich seiner großen Liebe ist vor allen Dingen auf unsere Allerkleinsten zugeschnitzt, aber nichts desto trotz ein federleichtes Sehvergnügen für Jung UND Alt.
So ist die ab 0 Jahre empfohlene Geschichte um das kleine Hornpanzerungetier Zielpublikum geschuldet vor allem lieb, nett und, bis auf ein paar schlichte Ökobotschaften, harmlos. Harmlos, aber keineswegs langweilig.
Denn immer wieder trifft Sammy auf skurille und gefährliche Meeresbewohner, die seine Reise mit allerlei Anekdoten zu bereichern wissen. Neben ausgehungerten Haien, gefräßigen Piranhas, gierigem Flattergetier und monströsen Schiffsmotoren macht Sammy auch Erfahrungen mit allerlei Menschenkindern, die ihm in schweren Zeiten meist wohlgesonnen stützend zur Seite stehen. Somit ist auch für die obligatorische seelische Erbauung des Junggemüses gesorgt.
Angenehm fällt auch ins Gewicht, daß sich der Bilderrausch aalglatt von der Netzhaut ins Gemüt windet, ohne den Umweg über den kritischen Intellekt nehmen zu müßen. Kindgerecht eben wie ein aufgewärmter Milupa Banane-Vanille Babybrei an einem lauen Sonntagabend.
Das ist nicht negativ. Das ist wohl genau der richtige Zutatenmix, an dem entlang eine sanfte Kinderseele zur edlen Reife gedeihen kann.
Das der Film aber auch für den Erziehungsberechtigten von Belang ist, liegt vor allem daran, daß der Film niemals die Schwelle zum Kitsch überschreitet und eine phantastische Unterwasserwelt zeichnet, die mit ihrer Farbenpracht und Detailverliebtheit selbst verwöhnte Technicolorjunkies in Verzückung versetzt.
Gerne mimmt man da Sammy's Einladung an, mit ihm gemeinsam gemächlich durch die oppulent ausgestatteten tropischen Gewässer zu planschen.
Sein Renomee hat sich der Film vor allem damit erarbeitet, daß der 3D Effekt selten so exzessiv ausgereizt wurde wie hier. Wo andere Filme mehr mit der Tiefenwirkung spielen, setzt Regisseur Ben Stassen vor allem mit dem Pop Out Effekt. Dieser führt vor allem dazu, daß das Wohnzimmer ständig von allerlei glittschigem Schuppenviech bevölkert wird. Am laufendem Band springt, schnappt oder flattert einem irgendwas lebendiges vor der Nase rum, so daß das Gefühl mittendrin zu sein, wohl noch nie so auf die Spitze getrieben wurde wie hier. Das dabei die Bilder unscharf werden, wenn sie die Nasenspitze kitzeln: Schwamm drüber.
So kann man dem Film unterm Strich für seine tiefenentspannte Unterhaltung im Zeitlupentempo, zu Dank verpflichtet sein.
So ist die ab 0 Jahre empfohlene Geschichte um das kleine Hornpanzerungetier Zielpublikum geschuldet vor allem lieb, nett und, bis auf ein paar schlichte Ökobotschaften, harmlos. Harmlos, aber keineswegs langweilig.
Denn immer wieder trifft Sammy auf skurille und gefährliche Meeresbewohner, die seine Reise mit allerlei Anekdoten zu bereichern wissen. Neben ausgehungerten Haien, gefräßigen Piranhas, gierigem Flattergetier und monströsen Schiffsmotoren macht Sammy auch Erfahrungen mit allerlei Menschenkindern, die ihm in schweren Zeiten meist wohlgesonnen stützend zur Seite stehen. Somit ist auch für die obligatorische seelische Erbauung des Junggemüses gesorgt.
Angenehm fällt auch ins Gewicht, daß sich der Bilderrausch aalglatt von der Netzhaut ins Gemüt windet, ohne den Umweg über den kritischen Intellekt nehmen zu müßen. Kindgerecht eben wie ein aufgewärmter Milupa Banane-Vanille Babybrei an einem lauen Sonntagabend.
Das ist nicht negativ. Das ist wohl genau der richtige Zutatenmix, an dem entlang eine sanfte Kinderseele zur edlen Reife gedeihen kann.
Das der Film aber auch für den Erziehungsberechtigten von Belang ist, liegt vor allem daran, daß der Film niemals die Schwelle zum Kitsch überschreitet und eine phantastische Unterwasserwelt zeichnet, die mit ihrer Farbenpracht und Detailverliebtheit selbst verwöhnte Technicolorjunkies in Verzückung versetzt.
Gerne mimmt man da Sammy's Einladung an, mit ihm gemeinsam gemächlich durch die oppulent ausgestatteten tropischen Gewässer zu planschen.
Sein Renomee hat sich der Film vor allem damit erarbeitet, daß der 3D Effekt selten so exzessiv ausgereizt wurde wie hier. Wo andere Filme mehr mit der Tiefenwirkung spielen, setzt Regisseur Ben Stassen vor allem mit dem Pop Out Effekt. Dieser führt vor allem dazu, daß das Wohnzimmer ständig von allerlei glittschigem Schuppenviech bevölkert wird. Am laufendem Band springt, schnappt oder flattert einem irgendwas lebendiges vor der Nase rum, so daß das Gefühl mittendrin zu sein, wohl noch nie so auf die Spitze getrieben wurde wie hier. Das dabei die Bilder unscharf werden, wenn sie die Nasenspitze kitzeln: Schwamm drüber.
So kann man dem Film unterm Strich für seine tiefenentspannte Unterhaltung im Zeitlupentempo, zu Dank verpflichtet sein.
mit 4
mit 5
mit 4
mit 2
bewertet am 05.11.17 um 14:14
Übergroßer Liebesfilm von Baz Luhrmann (Moulin Rouge) in oppulentem Gewand und getragen von einer handvoll grandioser Schauspielrecken.
In knallig bonbonbunten Farben und mit einer gehörigen Portion Nostalgie versehen, entfaltet sich allmählich das Mysterium um den steinreichen Gatsby, der in seinem Cinderella ähnlichem Märchenpalast residiert und mit bombastischen Feiern seine Jugendliebe in sein Gemach zu locken versucht.
Bis etwas Licht in die Geschichte kommt, vergeht viel Zeit, während der der Zuschauer mit überbordenenden Kulissen, rauschenden Partynächten und spektakulären Kameraperspektiven bei Laune gehalten wird, die erst in 3D in ihrer vollen Pracht zu bestaunen sind.
Auch wenn der Film in seinen besten Momenten stilistisch mit seiner Patina an Leones "Es war einmal in America" erinnert, lassen sich im letzten Drittel einige zähere Momente ausmachen. Hier hätte das Timing besser, die Geschichte schneller vorangetrieben werden können. Wahrscheinlich fällt das Absinken der Erzählung auf Normalniveau aber nur deshalb ins Gewicht, weil der Film ansonsten eine Aneinanderrreihung cineastischer Höhepunkte ist, bei dem der Zuschauer im Minutentakt mit visuellen und literarischen Delikatessen gemästet wird und das Erschlaffen des Spannungsbogens wohl einfach nur Entzugserscheinungen der Oppulenz sind.
Kritiker werden der überbordene Schwülstigkeit sicherlich eine verdächtige Nähe zum Kitsch und zuviel dreidimensionale Effekthascherei attestieren. Wenn dies allerdings auf einem derart hohem künstlerisch ästhetischem Niveau stattfindet, laß ich mich gerne von der seichten Muse in Beschlag nehme
In knallig bonbonbunten Farben und mit einer gehörigen Portion Nostalgie versehen, entfaltet sich allmählich das Mysterium um den steinreichen Gatsby, der in seinem Cinderella ähnlichem Märchenpalast residiert und mit bombastischen Feiern seine Jugendliebe in sein Gemach zu locken versucht.
Bis etwas Licht in die Geschichte kommt, vergeht viel Zeit, während der der Zuschauer mit überbordenenden Kulissen, rauschenden Partynächten und spektakulären Kameraperspektiven bei Laune gehalten wird, die erst in 3D in ihrer vollen Pracht zu bestaunen sind.
Auch wenn der Film in seinen besten Momenten stilistisch mit seiner Patina an Leones "Es war einmal in America" erinnert, lassen sich im letzten Drittel einige zähere Momente ausmachen. Hier hätte das Timing besser, die Geschichte schneller vorangetrieben werden können. Wahrscheinlich fällt das Absinken der Erzählung auf Normalniveau aber nur deshalb ins Gewicht, weil der Film ansonsten eine Aneinanderrreihung cineastischer Höhepunkte ist, bei dem der Zuschauer im Minutentakt mit visuellen und literarischen Delikatessen gemästet wird und das Erschlaffen des Spannungsbogens wohl einfach nur Entzugserscheinungen der Oppulenz sind.
Kritiker werden der überbordene Schwülstigkeit sicherlich eine verdächtige Nähe zum Kitsch und zuviel dreidimensionale Effekthascherei attestieren. Wenn dies allerdings auf einem derart hohem künstlerisch ästhetischem Niveau stattfindet, laß ich mich gerne von der seichten Muse in Beschlag nehme
mit 5
mit 4
mit 4
mit 3
bewertet am 08.10.17 um 12:09
Die Altersangabe verrät schon ganz gut, was einen hier erwartet.
Für Nulljährige darf es nirgendwo wehtun. So fehlt es dem Film denn auch an Ecken und Kanten und somit zwangsläufig an Spannung, Witz und Geist. Stattdessen sind wir Zeuge einer Anneinanderreihung von Harmlosigkeiten, Witzelchen, Gähncharakteren und einem sogar für unter dyskalkulie leidenden Fingeramputierten berechenbarem Handlungsmuster.
Es mag sogar sein, daß es für Kleinkinder zur seelischen Erbauung beiträgt, ihnen solch seichten Mampf in ihre unverdorbene Birne zu katapultieren, um ihren unsere basalen Werte von Gut, Falsch, Freundschaft, Mut und Zivilcourage einzuprägen, bevor es das Privatfernsehen tut.
All dies mag pädagogisch seine Berechtigung haben, unterhaltsam ist dies indessen für das verwöhnte adoleszente Primatenhirn nur bedingt. Für dieses dümpelt die Monster Uni 90min knapp unter der Wahrnehmungsschwelle vor sich hin. Wenn ein Film auf Rücksicht auf die zarte Babyseele so Humor- und Spannungsresistent ist, ist er eigentlich im engeren Freundeskreis nicht guten Gewissens zu empfehlen.
Erst in der Seniorenresidenz, wenn der geneigte Besitzer dieses Werkes wieder in dem infantilen Reich der kindlichen Glückseeligkeit segelt, wird sich ein zweites mal in die Monster Uni immatrikuliert. Versprochen!
Für Nulljährige darf es nirgendwo wehtun. So fehlt es dem Film denn auch an Ecken und Kanten und somit zwangsläufig an Spannung, Witz und Geist. Stattdessen sind wir Zeuge einer Anneinanderreihung von Harmlosigkeiten, Witzelchen, Gähncharakteren und einem sogar für unter dyskalkulie leidenden Fingeramputierten berechenbarem Handlungsmuster.
Es mag sogar sein, daß es für Kleinkinder zur seelischen Erbauung beiträgt, ihnen solch seichten Mampf in ihre unverdorbene Birne zu katapultieren, um ihren unsere basalen Werte von Gut, Falsch, Freundschaft, Mut und Zivilcourage einzuprägen, bevor es das Privatfernsehen tut.
All dies mag pädagogisch seine Berechtigung haben, unterhaltsam ist dies indessen für das verwöhnte adoleszente Primatenhirn nur bedingt. Für dieses dümpelt die Monster Uni 90min knapp unter der Wahrnehmungsschwelle vor sich hin. Wenn ein Film auf Rücksicht auf die zarte Babyseele so Humor- und Spannungsresistent ist, ist er eigentlich im engeren Freundeskreis nicht guten Gewissens zu empfehlen.
Erst in der Seniorenresidenz, wenn der geneigte Besitzer dieses Werkes wieder in dem infantilen Reich der kindlichen Glückseeligkeit segelt, wird sich ein zweites mal in die Monster Uni immatrikuliert. Versprochen!
mit 3
mit 4
mit 4
mit 3
bewertet am 07.09.17 um 22:50
Ordentliche, zeitgemäße Monsteraction. Deutliche Abzüge in Puncto Handlung.
Der Neuerzählung mangelt es deutlich an Erzählfluss. Zu dünn und schablonenhaft ist die Handlung, als da´sie ansatzweise fesseln könnte, zu dürftig die schauspielerische Präsenz der Protagonisten, als das Interesse an dessen Schicksal aufflammen könnte.
Somit haben die Monster die gesamte Bühne für sich. Langsam, dramaturgisch fragwürdig, betreten die Urzeitungetüme häppchenweise die Leinwand. Dann allerdings entfesseln sie ihre brachiale Gewalt und zerstören ganze Landstriche, um ihrem triebhaften Liebesleben zu frönen. Nur Godzilla kann verhindern, daß die Megainsekten mit ihrer Brut die Erde verwüsten.
Unterm Strich beendet der Zuschauer das Kintopspektakel mit einem zufriedenstellendem Gefühl. Das ist allerdings größtenteils der fulminanten Endschlacht zu verdanken, in dem die Urgewalten in Zeitlupe aufeinandertreffen und ganze Hochhausblöcke dem Erdboden gleichmachen.
Auch wenn der Film durchaus seine sehenswerten Momente hat, ist Godzilla eine Tortur für den 3D Liebhaber. Meine bleibende Erkenntniss ist deßhalb, daß dunkle Bilder (mind 3/4 des Filmes), sowie Handkamera (mind. 4/4 des Filmes) der sichere Tod eines jeglichen 3D Filmvergnügens sind.
Der Neuerzählung mangelt es deutlich an Erzählfluss. Zu dünn und schablonenhaft ist die Handlung, als da´sie ansatzweise fesseln könnte, zu dürftig die schauspielerische Präsenz der Protagonisten, als das Interesse an dessen Schicksal aufflammen könnte.
Somit haben die Monster die gesamte Bühne für sich. Langsam, dramaturgisch fragwürdig, betreten die Urzeitungetüme häppchenweise die Leinwand. Dann allerdings entfesseln sie ihre brachiale Gewalt und zerstören ganze Landstriche, um ihrem triebhaften Liebesleben zu frönen. Nur Godzilla kann verhindern, daß die Megainsekten mit ihrer Brut die Erde verwüsten.
Unterm Strich beendet der Zuschauer das Kintopspektakel mit einem zufriedenstellendem Gefühl. Das ist allerdings größtenteils der fulminanten Endschlacht zu verdanken, in dem die Urgewalten in Zeitlupe aufeinandertreffen und ganze Hochhausblöcke dem Erdboden gleichmachen.
Auch wenn der Film durchaus seine sehenswerten Momente hat, ist Godzilla eine Tortur für den 3D Liebhaber. Meine bleibende Erkenntniss ist deßhalb, daß dunkle Bilder (mind 3/4 des Filmes), sowie Handkamera (mind. 4/4 des Filmes) der sichere Tod eines jeglichen 3D Filmvergnügens sind.
mit 3
mit 4
mit 4
mit 3
bewertet am 22.08.17 um 11:08
Dünn, dünner, dünnerer, ...noch dünner...San Andreas.
San Andreas ist ein substanzloser und vorhersehbarer Film. Seine unverholene Schlichtheit gereicht ihm jedoch zum Vorteil. Er gibt der unvermeidlichen Rahmenhandlung nicht mehr Gewicht, als zur Aufhängung spektakulärer Effekte unbedingt nötig wären. Von allem intellektuellem Ballast befreit, kann sich San Andreas voll und ganz seiner Kernpompetenz, der hirnlosen Zerstörungswut des Weltenschöpfers, widmen.
Diese unterhält obererstklassig und setzt wohl den Schlußstein im Erdplattenwackelpuddinggenre. Mehr Zerstörung geht nicht. Hier wird das gesamte digitale Set in seine mikroskopischen Pixel zerlegt.
Dwayne Johnson ist Helikopterpilot bei der Feuerwehr. Als der San Andreas Graben aufreißt und halb Kalifornien ins Meer rutscht, muß er seine Ex Frau und seine Tochter, die sich gerade in San Francisco mit dem neuen Lover seiner Ex aufhät, retten. Der Ex geht hops, weil er feiger Weise beim ersten Kontinentaldrift der Stärke Neunkommanochwas das Weite sucht und somit ein Charakterschwein ist was keiner braucht und völlig zurecht von Mutter Erde auf 90qm plattgewalzt wird. Dwayne's toughe Tochter hingegen nimmt den Kampf mit den Naturgewalten auf und kämpft sich mit einem edlen Recken, dem die irren Kurven der Amazone im handumdrehen alle Sinne geraubt haben, durch die einstürzenden Straßenschluchten der Stadt. Bis sie von Paps -Überrachung- in letzter Sekunde gerettet werden.
Danach Sonnenuntergang und Knutschen. Schluß!
Wie gesagt ist die Story dünn und vorhersehbar, mitunter sogar peinlich, wenn z.b. der obligatorische Wissenschaftler und Mahner logorröhisch von Mikroimpulsbeben fabuliert, die seine Theorie endlich beweisen (welche?).
Aber völlig egal. Bei San Andreas stellt sich endlich der Nervenkitzel und die Freude an sinnloser, brachialer Zerstörung ein, die man bei Filmen wie Emmerichs 2012 vergeblich suchte. Und nur Das zählt! In imposanten (aber nicht perfektem) 3D wird hier eine Zerstörungsorgie zelebriert, die keine Wünsche offen läßt und Vorfreude auf das echte Beben macht.
San Andreas ist ein substanzloser und vorhersehbarer Film. Seine unverholene Schlichtheit gereicht ihm jedoch zum Vorteil. Er gibt der unvermeidlichen Rahmenhandlung nicht mehr Gewicht, als zur Aufhängung spektakulärer Effekte unbedingt nötig wären. Von allem intellektuellem Ballast befreit, kann sich San Andreas voll und ganz seiner Kernpompetenz, der hirnlosen Zerstörungswut des Weltenschöpfers, widmen.
Diese unterhält obererstklassig und setzt wohl den Schlußstein im Erdplattenwackelpuddinggenre. Mehr Zerstörung geht nicht. Hier wird das gesamte digitale Set in seine mikroskopischen Pixel zerlegt.
Dwayne Johnson ist Helikopterpilot bei der Feuerwehr. Als der San Andreas Graben aufreißt und halb Kalifornien ins Meer rutscht, muß er seine Ex Frau und seine Tochter, die sich gerade in San Francisco mit dem neuen Lover seiner Ex aufhät, retten. Der Ex geht hops, weil er feiger Weise beim ersten Kontinentaldrift der Stärke Neunkommanochwas das Weite sucht und somit ein Charakterschwein ist was keiner braucht und völlig zurecht von Mutter Erde auf 90qm plattgewalzt wird. Dwayne's toughe Tochter hingegen nimmt den Kampf mit den Naturgewalten auf und kämpft sich mit einem edlen Recken, dem die irren Kurven der Amazone im handumdrehen alle Sinne geraubt haben, durch die einstürzenden Straßenschluchten der Stadt. Bis sie von Paps -Überrachung- in letzter Sekunde gerettet werden.
Danach Sonnenuntergang und Knutschen. Schluß!
Wie gesagt ist die Story dünn und vorhersehbar, mitunter sogar peinlich, wenn z.b. der obligatorische Wissenschaftler und Mahner logorröhisch von Mikroimpulsbeben fabuliert, die seine Theorie endlich beweisen (welche?).
Aber völlig egal. Bei San Andreas stellt sich endlich der Nervenkitzel und die Freude an sinnloser, brachialer Zerstörung ein, die man bei Filmen wie Emmerichs 2012 vergeblich suchte. Und nur Das zählt! In imposanten (aber nicht perfektem) 3D wird hier eine Zerstörungsorgie zelebriert, die keine Wünsche offen läßt und Vorfreude auf das echte Beben macht.
mit 3
mit 4
mit 4
mit 2
bewertet am 18.08.17 um 22:30
Top Angebote
kleinhirn
GEPRÜFTES MITGLIED
FSK 18
Aktivität
Forenbeiträge0
Kommentare41
Blogbeiträge0
Clubposts0
Bewertungen510
Mein Avatar
Weitere Funktionen
(510)
(16)
Beste Bewertungen
kleinhirn hat die folgenden 4 Blu-rays am besten bewertet:
Letzte Bewertungen
Filme suchen nach
Mit dem Blu-ray Filmfinder können Sie Blu-rays nach vielen unterschiedlichen Kriterien suchen.
Die Filmbewertungen von kleinhirn wurde 343x besucht.