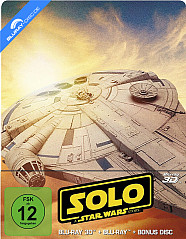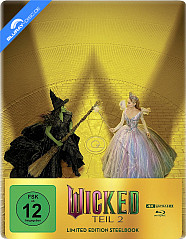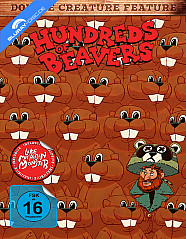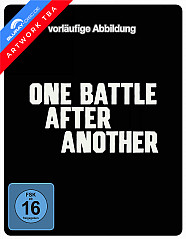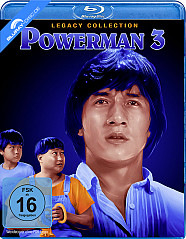"Terminator": James Camerons SciFi-Kult erscheint 2026 auf Ultra HD Blu-ray in limitierten SondereditionenCapelight Video: Independent bringt zehn Filme auf Blu-ray in Hartboxen herausLighthouse Home Entertainment: Zwei Horror-Neuheiten im Februar 2026 auf Blu-ray Disc"The Last Kingdom - Seven Kings Must Die": Bald auf Blu-ray und Ultra HD Blu-ray verfügbar"Black Friday 2025": Angebote mit Blu-rays, 4K UHDs und weitere Deals im Überblick - UPDATE 3"Turbine Weihnachtsrakete 2025": Phase 1 der Rabattaktion mit 22% Preisnachlass gestartet"Insel des Schreckens": Horrorfilm von William T. Naud erscheint 2026 hierzulande erstmals auf Blu-ray DiscAb 30.11. vorbestellbar: Deutschlandpremiere von "Sleepaway Camp" und mehr Filme auf Blu-ray in MediabooksÜber 140 Preise gewinnen: Am 01.12. startet der "bluray-disc.de Weihnachtskalender 2025"
NEWSTICKER
Filmbewertungen von kleinhirn
Jetzt wirds kritisch.
Um dem Transformersuniversum noch irgendeine Daseinsberechtigung zu verleihen, wird das Franchise nun zu allem Überdruß auch noch historisch/mythologisch aufgeladen: Schon im finsteren Mittelalter wurde ein britischer Clan mit der Behütung eines Transformer Artefaktes beauftragt.
Jetztzeit: Die gute Transformers kämpfen nun mit den Bösen um den Besitz dieses Superakkus. Mehr braucht man über die Handlung nicht zu wissen, sie spielt eh keine Rolle! Das am Ende wieder einmal Stonehedge als Realitätslink für van Däniken Spinner herhalten muß, na sei's drum.
Zur Ausführung: Während die erste Hälfte bis zweidrittel mit unruhigem Handkameragefuchtel und zu geringer Distanz zu dem Gezeigten noch für durchgehend nervende und aggressiv stimmende Momente sorgen, kehrt gegen Ende glücklicherweise mehr Ruhe und Gelassenheit in die Bildführung ein. Der Film wechselt nun seinen Focus von den Schauspielern auf die Schlacht der Transformers.
Und ab da wird's episch: gigantische Fights unter Wasser und in der Luft sorgen für spektakuläre und atemberaubende Scenen, die trotz der inflationären Produktion von CGI getränkten Blockbustern immer noch für staunendes wohlgefallen sorgen. Damit erhält Transformers - The last knight seine Daseinsberechtigung!
Das dieser Transformers Ableger der Einzige des Jahres 2017 war, der in real 3D gefilmt wurde, merkt man ihm in jeder Faser an. Die Plastizität und luftige Räumlichkeit der Realscenen erzeugen eine Tiefenwirkung, die durch nachträgliche Konvertierung nicht zu erreichen ist!
Um dem Transformersuniversum noch irgendeine Daseinsberechtigung zu verleihen, wird das Franchise nun zu allem Überdruß auch noch historisch/mythologisch aufgeladen: Schon im finsteren Mittelalter wurde ein britischer Clan mit der Behütung eines Transformer Artefaktes beauftragt.
Jetztzeit: Die gute Transformers kämpfen nun mit den Bösen um den Besitz dieses Superakkus. Mehr braucht man über die Handlung nicht zu wissen, sie spielt eh keine Rolle! Das am Ende wieder einmal Stonehedge als Realitätslink für van Däniken Spinner herhalten muß, na sei's drum.
Zur Ausführung: Während die erste Hälfte bis zweidrittel mit unruhigem Handkameragefuchtel und zu geringer Distanz zu dem Gezeigten noch für durchgehend nervende und aggressiv stimmende Momente sorgen, kehrt gegen Ende glücklicherweise mehr Ruhe und Gelassenheit in die Bildführung ein. Der Film wechselt nun seinen Focus von den Schauspielern auf die Schlacht der Transformers.
Und ab da wird's episch: gigantische Fights unter Wasser und in der Luft sorgen für spektakuläre und atemberaubende Scenen, die trotz der inflationären Produktion von CGI getränkten Blockbustern immer noch für staunendes wohlgefallen sorgen. Damit erhält Transformers - The last knight seine Daseinsberechtigung!
Das dieser Transformers Ableger der Einzige des Jahres 2017 war, der in real 3D gefilmt wurde, merkt man ihm in jeder Faser an. Die Plastizität und luftige Räumlichkeit der Realscenen erzeugen eine Tiefenwirkung, die durch nachträgliche Konvertierung nicht zu erreichen ist!
mit 3
mit 5
mit 4
mit 3
bewertet am 21.12.18 um 17:00
Schlecht, schlechter, am schlechtesten...Sindbab.
Leid , leider, am leidesten....war der Trashgott Luigi Cozzi (Star Crash, Hercules) nur periphäer an der Produktion beteiligt.
Obwohl Cozzi das Drehbuch geschrieben hatte und mit der Regie beauftragt wurde, wurde ihm das Zepter nach jahrelangem Warten aus der Hand genommen.
Cozzi, seit seiner Kindheit von der Kinomagie eines Ray Harryhausen in Beschlag genommen, plante ein ähnlich buntes Fantasyspektakel wie das seines großen amerikanischen Vorbildes. Bunte Spezialeffekte sollten die Suche Sindbads nach den kristallisierten Tränen einer Prinzessin spektakulär in Scene setzen.
Statt Cozzi wurde jedoch mit Enzo G. Castellari ein zwar recht solides Exemplar Regisseur engagiert, dieser war jedoch mit dem Mangel behaftet, die Welt ausschließlich durch die Augen eines Actionaffinen Erwachsenen zu betrachten. Statt das Auge des Zuschauers mit einem Fest an farbenfrohen und billigen Tricks zu schmeicheln, setzte Castellari mehr auf handfeste Keilereien mit schmierigen Halloweenpuppen.
Da Sindbad ursprünglich auch als Vierteiler fürs Fernsehen ausgeschlachtet werden sollte, drehte Castellari zuerst ein maßlos in die Länge gezogenes 6 Stunden Epos.
Dieses Schicksal blieb Sindbad letztendlich jedoch verwehrt, da es außer einer (abgewandelten) hahnebüchenen Geschichte, nix weiter als stundenlange ermüdende Keilereien gab. So wurde Cozzi am Ende doch wieder ins Boot geholt, um zu retten, was zu retten ist. Sindbad wurde schließlich umgeschnitten, heftig gekürzt und um eine Rahmenhandlung und einen Erzähler erweitert, da sonst niemand mehr durchgeblickt hätte. Einige Scenen wurden nachgedreht und ein paar schaurige Spezialeffekte auf üblichem 50er Jahre Niveau hinzugefügt.
So hält denn die wirre und dünne Handlung, das Versprechen, daß ein echter Cozzi verspricht. Die dilletantischen und lächerlichen Spezialeffekte, eigentlich das Salz in der Suppe, sind aber leider, wie gesagt, nur sehr spärlich gesäht.
Dennoch verströmt der Film eindeutig den unverwechselbaren Spirit des italienischen Ausnahmeregisseures, der von unbefangener Naivität und reiner Freude am Erzählen und Schaffen geprägt ist.
Man mag über seine Filme lachen, Cozzi hat sich jedoch etwas bewahrt, was in keiner spröden cineastischen Fakultät gelehrt werden kann: Er vermag die Welt noch mit unschuldigen Kinderaugen zu sehen!
Gerade diese Unbedarftheit, die Leichtigkeit der Erzählung, der Verzicht auf intellektuelle Zensur und die ungetrübte Freude über das Staunen über das Wunderbare sind es, die sich auf den Zuschauer übertragen und ihm 90 unbeschwerte Minuten bescheren. Somit verfügt auch Sindbad über mehr Charme, als so manch aktueller überproduzierter Superheldenblockbuster mit seiner Pseudodramatik und seelenlosem CGI Overkill. Cozzi drehte seine Filme eben, in dem er seinem leichten Herzen und nicht dem verklompizierendem Vertand folgte. Eine Tugend, für die die Trashfilmgemeinde ihm auf immer und ewig dankbar sein wird...
Leid , leider, am leidesten....war der Trashgott Luigi Cozzi (Star Crash, Hercules) nur periphäer an der Produktion beteiligt.
Obwohl Cozzi das Drehbuch geschrieben hatte und mit der Regie beauftragt wurde, wurde ihm das Zepter nach jahrelangem Warten aus der Hand genommen.
Cozzi, seit seiner Kindheit von der Kinomagie eines Ray Harryhausen in Beschlag genommen, plante ein ähnlich buntes Fantasyspektakel wie das seines großen amerikanischen Vorbildes. Bunte Spezialeffekte sollten die Suche Sindbads nach den kristallisierten Tränen einer Prinzessin spektakulär in Scene setzen.
Statt Cozzi wurde jedoch mit Enzo G. Castellari ein zwar recht solides Exemplar Regisseur engagiert, dieser war jedoch mit dem Mangel behaftet, die Welt ausschließlich durch die Augen eines Actionaffinen Erwachsenen zu betrachten. Statt das Auge des Zuschauers mit einem Fest an farbenfrohen und billigen Tricks zu schmeicheln, setzte Castellari mehr auf handfeste Keilereien mit schmierigen Halloweenpuppen.
Da Sindbad ursprünglich auch als Vierteiler fürs Fernsehen ausgeschlachtet werden sollte, drehte Castellari zuerst ein maßlos in die Länge gezogenes 6 Stunden Epos.
Dieses Schicksal blieb Sindbad letztendlich jedoch verwehrt, da es außer einer (abgewandelten) hahnebüchenen Geschichte, nix weiter als stundenlange ermüdende Keilereien gab. So wurde Cozzi am Ende doch wieder ins Boot geholt, um zu retten, was zu retten ist. Sindbad wurde schließlich umgeschnitten, heftig gekürzt und um eine Rahmenhandlung und einen Erzähler erweitert, da sonst niemand mehr durchgeblickt hätte. Einige Scenen wurden nachgedreht und ein paar schaurige Spezialeffekte auf üblichem 50er Jahre Niveau hinzugefügt.
So hält denn die wirre und dünne Handlung, das Versprechen, daß ein echter Cozzi verspricht. Die dilletantischen und lächerlichen Spezialeffekte, eigentlich das Salz in der Suppe, sind aber leider, wie gesagt, nur sehr spärlich gesäht.
Dennoch verströmt der Film eindeutig den unverwechselbaren Spirit des italienischen Ausnahmeregisseures, der von unbefangener Naivität und reiner Freude am Erzählen und Schaffen geprägt ist.
Man mag über seine Filme lachen, Cozzi hat sich jedoch etwas bewahrt, was in keiner spröden cineastischen Fakultät gelehrt werden kann: Er vermag die Welt noch mit unschuldigen Kinderaugen zu sehen!
Gerade diese Unbedarftheit, die Leichtigkeit der Erzählung, der Verzicht auf intellektuelle Zensur und die ungetrübte Freude über das Staunen über das Wunderbare sind es, die sich auf den Zuschauer übertragen und ihm 90 unbeschwerte Minuten bescheren. Somit verfügt auch Sindbad über mehr Charme, als so manch aktueller überproduzierter Superheldenblockbuster mit seiner Pseudodramatik und seelenlosem CGI Overkill. Cozzi drehte seine Filme eben, in dem er seinem leichten Herzen und nicht dem verklompizierendem Vertand folgte. Eine Tugend, für die die Trashfilmgemeinde ihm auf immer und ewig dankbar sein wird...
mit 4
mit 3
mit 3
mit 2
bewertet am 21.12.18 um 16:50
Eiderdaus, was war das wieder für eine Freude!
Cozzi hat seine Mission wieder mehr als einmal überfüllt!
Mein Nacken ist noch Heute vom ungläubigen Kopfschütteln schwer gezerrt. Was war das wieder ein Füllhorn an Quatsch und Unsinn, den sich der italienische Meisterregisseur da ausgedacht und mein Atlasgelenk an den Rande des Systemversagens gebracht hat.
Zum dritten mal hat Cozzi ein Feuerwerk an tumber Plumbheit und Diletantismus abgefeuert, welches hart an der Grenze zum Tatbestand der unfreiwilligen Zuschauererbelustigung manövriert.
Zeus sind 7 Blitze gestohlen und in dämonischen Wesen versteckt worden, die allesamt in düsteren und verwunschenen Orten hausen und zu allem Unglück auch noch mythologisch massiv aufgeladen sind. Hercules wird mit der schicksalsträchtigen Mission beauftragt, den Elektroschrott wiederzufinden und diesem seinem Göttervater zurückbringen. Eine böse Xanthippe jedoch erweckt Hercules Erzrivalen Minos zum Leben und will dies einer spontanen Laune folgend, dringendlich verhindern. Werden die Blitze nicht gefunden, wird die Welt in nicht enden wollendes Chaos und Zerstörung gestürzt. Der Mond fliegt schon bereits auf die Erde zu und droht mit Ungemach.
Kann Herkules die Welt noch rechtzeitig retten? Die Zeit rennt unerbittlich davon und den Monstern in ihren Latexanzügen wird es langsam ungemütlich...
Wieder einmal verzichtet Cozzi auf eine ausgefeilte Dramaturgie und läßt seinen kindlich naiven Vorstellungen über die Zauberwelt der Götter ihren freien Lauf. Spannung und Logik sind in seinen Hemisphären Glückssache. Man mag dies gehoben als antiambivalentes Geschichtenerzählen deklarieren. Im Grund genommen ist dies aber nichts weiter als dreifach gequirlte Scheiße.
Zum zweitenmal jagt Cozzi nun sein Muskelpaket und leicht bekleidete Heldinnen im Sauseschritt durch das mythologische Griechenland, um 1.000 Gefahren zu begegnen und 10.000 Hindernissen auszuweichen. Und wieder einmal muß der Hüne schwer auf der Hut sein: die Götter sind hinterhältig und spielen nicht immer fair. Und so gerät unser Held immer tiefer in einen Strudel aus Magie und dunklen Mächten.
In einer Welt, in der die Spezialeffekte mit der Handlung darum wetteifern, was wohl die größeren Zwerchfellerschütterungen auslöst, gehört vor allen Dingen den zwar hübschen aber stocksteifen Textaufsagerinnen ein großes Lob gespendet: Sie schaffen es, bei all dem verzapften, Hirnzellen zersetzenden Bockmist noch ernst zu bleiben!
Ist der Film die ersten 85min aber einfach nur amüsant/trashig wird es im Grande Finale jedoch richtig gruselig (SPOILER), als Herkules gegen seinen Widersacher auf dem Olymp um die Weltherrschaft ringt: Als Minos sich mit Lichtenergie auflädt, stärkt Zeus seinen Sprößling ebenfalls mit dieser unheilvollen Naturkraft.
Schlimm genug, daß die beiden nun in den Zeichentrickmodus wechseln, nein, sie verwandeln nun zu allem Überdruß nun auch noch ihre Gestalten: Minos wird zum Dinosaurier und Herkules verwandelt sich in einen Gorilla. Das ist so schlecht und so billig getrixt, daß ich bis Gestern überhaupt nicht wußte, daß so etwas dummes überhaupt erlaubt ist. Das beste daran ist, daß King Kong und Godzilla dabei gerademal aus einer handvoll kirmesbunter Striche bestehen, die in einem unseligen Reisen umeinander tanzen. Ach Kinders, das ist so übel, das müßt ihr einfach gesehen haben...
Tröstlich dabei ist die Tatsache, daß sich Cozzi seiner Verbrechen wohl voll bewußt gewesen ist.
In seinen Interviews äußert er sich wiederholt erstaunt über die Tatsache, warum die Zuschauer bei soviel Schwachsinn nicht einfach das Kino verlassen haben. Ja, wirklich, am liebsten möchte man weinen! Aber genau das ist ja der Reiz seiner Filme: Man mag gar nicht glauben was ma da sieht. Und dieses ungläubige Staunen über diesen kunterbunten sinnentleeren Reigen und die Bewunderung für den Mut des Regisseures, seinen Kunden so einen Nonses allen Ernstes unterzujubeln, sind es, die trotz einfachster Mittel höchstes, kindlich sinnentfreites Sehvergnügen hervorzurufen vermögen.
Cozzi hat seine Mission wieder mehr als einmal überfüllt!
Mein Nacken ist noch Heute vom ungläubigen Kopfschütteln schwer gezerrt. Was war das wieder ein Füllhorn an Quatsch und Unsinn, den sich der italienische Meisterregisseur da ausgedacht und mein Atlasgelenk an den Rande des Systemversagens gebracht hat.
Zum dritten mal hat Cozzi ein Feuerwerk an tumber Plumbheit und Diletantismus abgefeuert, welches hart an der Grenze zum Tatbestand der unfreiwilligen Zuschauererbelustigung manövriert.
Zeus sind 7 Blitze gestohlen und in dämonischen Wesen versteckt worden, die allesamt in düsteren und verwunschenen Orten hausen und zu allem Unglück auch noch mythologisch massiv aufgeladen sind. Hercules wird mit der schicksalsträchtigen Mission beauftragt, den Elektroschrott wiederzufinden und diesem seinem Göttervater zurückbringen. Eine böse Xanthippe jedoch erweckt Hercules Erzrivalen Minos zum Leben und will dies einer spontanen Laune folgend, dringendlich verhindern. Werden die Blitze nicht gefunden, wird die Welt in nicht enden wollendes Chaos und Zerstörung gestürzt. Der Mond fliegt schon bereits auf die Erde zu und droht mit Ungemach.
Kann Herkules die Welt noch rechtzeitig retten? Die Zeit rennt unerbittlich davon und den Monstern in ihren Latexanzügen wird es langsam ungemütlich...
Wieder einmal verzichtet Cozzi auf eine ausgefeilte Dramaturgie und läßt seinen kindlich naiven Vorstellungen über die Zauberwelt der Götter ihren freien Lauf. Spannung und Logik sind in seinen Hemisphären Glückssache. Man mag dies gehoben als antiambivalentes Geschichtenerzählen deklarieren. Im Grund genommen ist dies aber nichts weiter als dreifach gequirlte Scheiße.
Zum zweitenmal jagt Cozzi nun sein Muskelpaket und leicht bekleidete Heldinnen im Sauseschritt durch das mythologische Griechenland, um 1.000 Gefahren zu begegnen und 10.000 Hindernissen auszuweichen. Und wieder einmal muß der Hüne schwer auf der Hut sein: die Götter sind hinterhältig und spielen nicht immer fair. Und so gerät unser Held immer tiefer in einen Strudel aus Magie und dunklen Mächten.
In einer Welt, in der die Spezialeffekte mit der Handlung darum wetteifern, was wohl die größeren Zwerchfellerschütterungen auslöst, gehört vor allen Dingen den zwar hübschen aber stocksteifen Textaufsagerinnen ein großes Lob gespendet: Sie schaffen es, bei all dem verzapften, Hirnzellen zersetzenden Bockmist noch ernst zu bleiben!
Ist der Film die ersten 85min aber einfach nur amüsant/trashig wird es im Grande Finale jedoch richtig gruselig (SPOILER), als Herkules gegen seinen Widersacher auf dem Olymp um die Weltherrschaft ringt: Als Minos sich mit Lichtenergie auflädt, stärkt Zeus seinen Sprößling ebenfalls mit dieser unheilvollen Naturkraft.
Schlimm genug, daß die beiden nun in den Zeichentrickmodus wechseln, nein, sie verwandeln nun zu allem Überdruß nun auch noch ihre Gestalten: Minos wird zum Dinosaurier und Herkules verwandelt sich in einen Gorilla. Das ist so schlecht und so billig getrixt, daß ich bis Gestern überhaupt nicht wußte, daß so etwas dummes überhaupt erlaubt ist. Das beste daran ist, daß King Kong und Godzilla dabei gerademal aus einer handvoll kirmesbunter Striche bestehen, die in einem unseligen Reisen umeinander tanzen. Ach Kinders, das ist so übel, das müßt ihr einfach gesehen haben...
Tröstlich dabei ist die Tatsache, daß sich Cozzi seiner Verbrechen wohl voll bewußt gewesen ist.
In seinen Interviews äußert er sich wiederholt erstaunt über die Tatsache, warum die Zuschauer bei soviel Schwachsinn nicht einfach das Kino verlassen haben. Ja, wirklich, am liebsten möchte man weinen! Aber genau das ist ja der Reiz seiner Filme: Man mag gar nicht glauben was ma da sieht. Und dieses ungläubige Staunen über diesen kunterbunten sinnentleeren Reigen und die Bewunderung für den Mut des Regisseures, seinen Kunden so einen Nonses allen Ernstes unterzujubeln, sind es, die trotz einfachster Mittel höchstes, kindlich sinnentfreites Sehvergnügen hervorzurufen vermögen.
mit 5
mit 3
mit 3
mit 2
bewertet am 21.12.18 um 12:11
Grottige Spezialeffekte und an Peinlichkeit nicht zu übertreffende Spezialeffekte treiben dem Trashfilmfan Ozeane von Freudentränen in die Augen. Mit Hercules setzt Regisseur Luigi Cozzi ungeniert seinen Feldzug gegen die guten Sitten der bildenen Künste fort, den er Jahre zuvor mit dem inzwischen legendären Star Crash begonnen hatte.
Ich versuche erst garnicht, die Handlung zu beschreiben, da sie schamlos den Gesetzen des denkenden menschlichen Verstandes zuwiderläuft und ehrlich gesagt, hat sie mich auch nach 20min schon gar nicht mehr interessiert. Spätestens da wußte ich nämlich wo der Haas langläuft, habe mich einfach nur dem Genuß des Augenblickes ergeben und wehrlos diesem Meisterwerk des Dilettantismus hingegeben.
Gebannt verfolgte ich die kunterbunten Sci-Fi Spezialeffekte, die vermutlich nicht mal die Neandertaler aus ihrer warmen Höhle gelockt hätten. Sie reduzieren sich auf kitschige Lichteffekte, wie man sie aus jeder Dorfdisco kennt, Stop-Motion Einlagen, die ein paar zusammengelötete Konservendosen und Schrauben aus Vatis Werkzeugkiste zu einem fragwürdigen Leben erwecken und billige Pappmacheekulissen, die dazu dienen Hercules' vermeintlich infernalische Kräfte zu untermauern.
Es ist uns nicht überliefert, daß Lou Ferrigno ein Absolvent der New Yorker school of Method Acting wäre. Um sein verborgenes Talent aber nicht zu sehr der Lächerlichkeit preiszugeben, hat man sich daher eines genialen cineastischen Kniffes bedient: Man engagierte Nebendarsteller, die ihren Körper noch weniger unter Kontrolle haben als Lou!
Im harmonischen Vierklang dieser Kinosünden wird der geneigte Zuschauer von einem Wonnebad ins nächste gejagt.
Der Verlauf dieses Heldenepos ist dabei so hahnebüchen, daß die Götter im Olymp von Zeit zu Zeit die Lücken im Drehbuch selber kommentieren müßen, um dem Geschehen einen ungefähren Drall zu geben. Der schamlose Raubbau an der von mir in der Kindheit so geliebten griechischem Mythologie sorgt dabei bei dem ausgewachsenen B-Movie Fan für einen Extraschub Adrenalin. Wenn die Autoren mal wieder den roten Faden bei diesem antiken Potpouri verloren haben, greifen auch schon mal die Götter und Titanen höchsterprsönlich direkt von ihrer Ehrentribüne im Weltraum heraus in das Geschehen ein, um den Zuschauer nicht in völlige Konfusion zu stürzen.
Hilft das auch nicht weiter, muß Hercules' Sidekick, die schöne Circe, Zauberkräfte aus dem Arm schütteln, um den Plot voranzutreiben.
Noch Heute, einen Tag nach der Besichtigung, kann ich gar nicht fassen, was mir da Gestern wunderbares widerfahren ist und ich grüble noch immer, was wohl das Highlight dieses filmischen Unglückes gewesen ist. Wahrscheinlich war es Hercules Kampf mit dem Bären, den er nach dem Sieg einfach in den Weltraum geschleudert hat (MUß man gesehen haben). Oder der Pferdestall, der geflutet wird, nachdem er zwei Steine in den Fluß geworfen hat. Oder als Hercules Circe ihr Amulett wiederbesorgt und sein (schlecht auf das Celluloid projezierter) Unterarm zu Feuer und Eis wird. Oder...ach es ist einfach unmöglich, sich aus dem Füllhorn der Peinlichkeiten den größten Schwachsinn rauszupicken. Hercules strotzt vor monumentalen Schnitzern und kann deshalb getrost als der Ben Hur des B-Movies gekrönt werden. Er sollte als ein Gesamtgroßkunstwerk des schlechten Geschmackes betrachtet und entsprechend gewürdigt werden. Eine griechische Tragödie klassischen Ausmaßes eben!!!
Das Mediabook ist der historischen Bedeutung dieses Werkes angemeßen. Koch Media...Ich bin bereit für Teil 2!!!
Ich versuche erst garnicht, die Handlung zu beschreiben, da sie schamlos den Gesetzen des denkenden menschlichen Verstandes zuwiderläuft und ehrlich gesagt, hat sie mich auch nach 20min schon gar nicht mehr interessiert. Spätestens da wußte ich nämlich wo der Haas langläuft, habe mich einfach nur dem Genuß des Augenblickes ergeben und wehrlos diesem Meisterwerk des Dilettantismus hingegeben.
Gebannt verfolgte ich die kunterbunten Sci-Fi Spezialeffekte, die vermutlich nicht mal die Neandertaler aus ihrer warmen Höhle gelockt hätten. Sie reduzieren sich auf kitschige Lichteffekte, wie man sie aus jeder Dorfdisco kennt, Stop-Motion Einlagen, die ein paar zusammengelötete Konservendosen und Schrauben aus Vatis Werkzeugkiste zu einem fragwürdigen Leben erwecken und billige Pappmacheekulissen, die dazu dienen Hercules' vermeintlich infernalische Kräfte zu untermauern.
Es ist uns nicht überliefert, daß Lou Ferrigno ein Absolvent der New Yorker school of Method Acting wäre. Um sein verborgenes Talent aber nicht zu sehr der Lächerlichkeit preiszugeben, hat man sich daher eines genialen cineastischen Kniffes bedient: Man engagierte Nebendarsteller, die ihren Körper noch weniger unter Kontrolle haben als Lou!
Im harmonischen Vierklang dieser Kinosünden wird der geneigte Zuschauer von einem Wonnebad ins nächste gejagt.
Der Verlauf dieses Heldenepos ist dabei so hahnebüchen, daß die Götter im Olymp von Zeit zu Zeit die Lücken im Drehbuch selber kommentieren müßen, um dem Geschehen einen ungefähren Drall zu geben. Der schamlose Raubbau an der von mir in der Kindheit so geliebten griechischem Mythologie sorgt dabei bei dem ausgewachsenen B-Movie Fan für einen Extraschub Adrenalin. Wenn die Autoren mal wieder den roten Faden bei diesem antiken Potpouri verloren haben, greifen auch schon mal die Götter und Titanen höchsterprsönlich direkt von ihrer Ehrentribüne im Weltraum heraus in das Geschehen ein, um den Zuschauer nicht in völlige Konfusion zu stürzen.
Hilft das auch nicht weiter, muß Hercules' Sidekick, die schöne Circe, Zauberkräfte aus dem Arm schütteln, um den Plot voranzutreiben.
Noch Heute, einen Tag nach der Besichtigung, kann ich gar nicht fassen, was mir da Gestern wunderbares widerfahren ist und ich grüble noch immer, was wohl das Highlight dieses filmischen Unglückes gewesen ist. Wahrscheinlich war es Hercules Kampf mit dem Bären, den er nach dem Sieg einfach in den Weltraum geschleudert hat (MUß man gesehen haben). Oder der Pferdestall, der geflutet wird, nachdem er zwei Steine in den Fluß geworfen hat. Oder als Hercules Circe ihr Amulett wiederbesorgt und sein (schlecht auf das Celluloid projezierter) Unterarm zu Feuer und Eis wird. Oder...ach es ist einfach unmöglich, sich aus dem Füllhorn der Peinlichkeiten den größten Schwachsinn rauszupicken. Hercules strotzt vor monumentalen Schnitzern und kann deshalb getrost als der Ben Hur des B-Movies gekrönt werden. Er sollte als ein Gesamtgroßkunstwerk des schlechten Geschmackes betrachtet und entsprechend gewürdigt werden. Eine griechische Tragödie klassischen Ausmaßes eben!!!
Das Mediabook ist der historischen Bedeutung dieses Werkes angemeßen. Koch Media...Ich bin bereit für Teil 2!!!
mit 5
mit 4
mit 3
mit 3
bewertet am 16.11.18 um 12:53
Herausstechendes Werk aus dem OUvre des Ausnahmeschauspielers Anthony Quinn, daß maßgeblich zu seiner Reputation als Filmlegende beigetragen hat, auch wenn der Film für sich genommen eigentlich nur Mittelmaß ist.
Der britische Schriftsteller Basil hat auf Kreta Grund und Boden geerbt. Auf dem Weg zu seinem Besitz trifft er im Fährhafen den Gelegenheitsarbeiter Alexis Sorbas. Dieser drängt sich Basil auf der Suche nach Arbeit auf, da er bei dem schick gekleideten Ehrenmann etwas Brot und Geld wittert.
Basil geht nach einigem Zögern auf das Angebot ein, da er sich von dem Einheimischen einige Vorteile im Umgang mit Land und Leuten erhofft.
Vornehmlich will Basil auf der Insel Bergbau betreiben. Da kommen ihm die Eigenschaften des Bärenstarken Sorbas, der zudem noch über Kenntnisse als Minenarbeiter verfügt, gerade Recht. Um das Geschäft profitabler zu machen, beschließen die Beiden bald, eine Seilbahn zu dem nahegelegenen Hügel zu bauen, um von dort unkompliziert an das benötigte Stützholz zu kommen.
Sorbas kümmert sich zudem gleich nach der Ankunft auf der Insel um eine reiche, alternde Dorfbewohnerin französischer Abstammung, die sehnsüchtig schmachtend in ihrer glorreichen Vergangenheit lebt, in der sie vermeintlich von drei Generälen umschwärmt wurde.
Basil indess verliebt sich in eine schöne Witwe, der er nach anfänglichen, schüchternen Annährungsversuchen, den Hof macht.
Soviel zur Geschichte, die an sich nichts besonderes ist. Im Gegenteil, sie ist beliebig, bis an die Grenze zur Belanglosigkeit. Teilweise sogar richtig blöd, wenn z.b.(SPOILER) Basil emotional unbeteiligt zur Kenntniss nimmt, daß der Dorfmob seine Freundin steinigt, weil sie sich nicht für einen Eingeborenen entschieden hat und anschließend den Mob wieder für sich arbeiten läßt. Auch ist die alternde Freundin Sorbas mit ihrer fragwürdigen Vergangenheit, zu sehr übertrieben und klischeehaft gezeichnet, als das der Zuschauer mitfiebern würde.
Woher nährt sich denn der legendäre Ruf dieses Filmes, wenn nicht aus der Geschichte selber? Das hat zwei Gründe: Erstens ist der Film hervoragend gefilmt und der Kameramann hat einige expressionistische Einstellungen der Insel und seiner verschrobenen Einwohner für die eingefangen, die Ewigkeitswert besitzen.
Der Hauptgrund ist aber natütrlich Anthonny Quinn höchstpersönlich.
Während Basil den biedernden Kopfmensch, den intellektuellen Literaten repräsentiert, steht Alexis Sorbas für das genaue Gegenteil. Der Film ist eine Ode an die Lebenslust, an die Gefühle, das wilde ungezähmte, das spontane und natürliche Leben. Und tatsächlich, Quinn verkörpert die unbändige pure Vitalität wie kaum ein zweiter. Auch im wahren Leben war er die Inkarnation der Sinnesgenüße, war kein Zauderer, sondern ein Anpacker, der immer in die Vollen ging und sein Umfeld mitreißen konnte.
Quinns Präsenz bringt die Leinwand zu beben und der Funke springt auch auf den Zuschauer über. Gerade im Vergleich zu dem verstockten Kopfmensch sticht Sorbas Wesensart deutlich in den Vordergrund. Sorbas Überlegenheit der Unmittelbarkeit des Lebens, zeigt sich in allen Aspekten seines Handelns, wo nur ein bejahendes Fortschreiten zielführend ist und ein sich verkriechen im eigenen Schneckenhaus, bzw. Kopf, zwar Sicherheit verspricht, aber dem dahinsiechenden Lebensentwurfes eines Scheintoden gleicht.
Auch wenn die Botschaft sehr simpel und natürlich fernab jeder Realität ist, was jedem mit auch nur einem Pfund Lebenserfahrung im Hintern klar ist, ist das Abfeiern der Lebenslust mitreißend und macht Lust aufs nachahmen. Der Film avancierte in Griechenland schnell zum Kultfilm, da man in Alexis Sorbas Charakters die Verkörperung der hellenischen Seele sah. Ob die Vergötzung des Einfachen und Verdammung des Rationalen schließlich auch zur Eurokrise geführt hat, ist aber bloß reine Spekulation.
Der britische Schriftsteller Basil hat auf Kreta Grund und Boden geerbt. Auf dem Weg zu seinem Besitz trifft er im Fährhafen den Gelegenheitsarbeiter Alexis Sorbas. Dieser drängt sich Basil auf der Suche nach Arbeit auf, da er bei dem schick gekleideten Ehrenmann etwas Brot und Geld wittert.
Basil geht nach einigem Zögern auf das Angebot ein, da er sich von dem Einheimischen einige Vorteile im Umgang mit Land und Leuten erhofft.
Vornehmlich will Basil auf der Insel Bergbau betreiben. Da kommen ihm die Eigenschaften des Bärenstarken Sorbas, der zudem noch über Kenntnisse als Minenarbeiter verfügt, gerade Recht. Um das Geschäft profitabler zu machen, beschließen die Beiden bald, eine Seilbahn zu dem nahegelegenen Hügel zu bauen, um von dort unkompliziert an das benötigte Stützholz zu kommen.
Sorbas kümmert sich zudem gleich nach der Ankunft auf der Insel um eine reiche, alternde Dorfbewohnerin französischer Abstammung, die sehnsüchtig schmachtend in ihrer glorreichen Vergangenheit lebt, in der sie vermeintlich von drei Generälen umschwärmt wurde.
Basil indess verliebt sich in eine schöne Witwe, der er nach anfänglichen, schüchternen Annährungsversuchen, den Hof macht.
Soviel zur Geschichte, die an sich nichts besonderes ist. Im Gegenteil, sie ist beliebig, bis an die Grenze zur Belanglosigkeit. Teilweise sogar richtig blöd, wenn z.b.(SPOILER) Basil emotional unbeteiligt zur Kenntniss nimmt, daß der Dorfmob seine Freundin steinigt, weil sie sich nicht für einen Eingeborenen entschieden hat und anschließend den Mob wieder für sich arbeiten läßt. Auch ist die alternde Freundin Sorbas mit ihrer fragwürdigen Vergangenheit, zu sehr übertrieben und klischeehaft gezeichnet, als das der Zuschauer mitfiebern würde.
Woher nährt sich denn der legendäre Ruf dieses Filmes, wenn nicht aus der Geschichte selber? Das hat zwei Gründe: Erstens ist der Film hervoragend gefilmt und der Kameramann hat einige expressionistische Einstellungen der Insel und seiner verschrobenen Einwohner für die eingefangen, die Ewigkeitswert besitzen.
Der Hauptgrund ist aber natütrlich Anthonny Quinn höchstpersönlich.
Während Basil den biedernden Kopfmensch, den intellektuellen Literaten repräsentiert, steht Alexis Sorbas für das genaue Gegenteil. Der Film ist eine Ode an die Lebenslust, an die Gefühle, das wilde ungezähmte, das spontane und natürliche Leben. Und tatsächlich, Quinn verkörpert die unbändige pure Vitalität wie kaum ein zweiter. Auch im wahren Leben war er die Inkarnation der Sinnesgenüße, war kein Zauderer, sondern ein Anpacker, der immer in die Vollen ging und sein Umfeld mitreißen konnte.
Quinns Präsenz bringt die Leinwand zu beben und der Funke springt auch auf den Zuschauer über. Gerade im Vergleich zu dem verstockten Kopfmensch sticht Sorbas Wesensart deutlich in den Vordergrund. Sorbas Überlegenheit der Unmittelbarkeit des Lebens, zeigt sich in allen Aspekten seines Handelns, wo nur ein bejahendes Fortschreiten zielführend ist und ein sich verkriechen im eigenen Schneckenhaus, bzw. Kopf, zwar Sicherheit verspricht, aber dem dahinsiechenden Lebensentwurfes eines Scheintoden gleicht.
Auch wenn die Botschaft sehr simpel und natürlich fernab jeder Realität ist, was jedem mit auch nur einem Pfund Lebenserfahrung im Hintern klar ist, ist das Abfeiern der Lebenslust mitreißend und macht Lust aufs nachahmen. Der Film avancierte in Griechenland schnell zum Kultfilm, da man in Alexis Sorbas Charakters die Verkörperung der hellenischen Seele sah. Ob die Vergötzung des Einfachen und Verdammung des Rationalen schließlich auch zur Eurokrise geführt hat, ist aber bloß reine Spekulation.
mit 4
mit 4
mit 3
mit 2
bewertet am 11.11.18 um 15:24
Obwohl der Film sicherlich einige tausende Dollar an Produktionskosten verschlungen haben wird, haftet ihm der Nimbus eines B-Movies, bzw. Edeltrashmachwerkes an. Die Effekte wirken nicht konsequent zu Ende gedacht und der Look ist comichaft schlicht gehalten. Das wird oft kritisiert, hat für mich aber andererseits auch den gewißen naiven Charme, der an alte Ray Harryhausen erinnert.
Die Handlung ist blöd wie immer: Auf der Erde befinden sich 3 magische Würfel. Ein außerirdischer Superschurke will die reine Energie enthaltenen Artefakte an sich bringen, um die Erde in eine garstige Vorhölle zu verwandeln.
Die Superhelden scheinen gegen gegen den gottgleichen Bösewicht Steppenwolf am Ende ihrer Möglichkeiten. Aber dank einer lächerlichen Idee wird Superman mit Hilfe eines magischen Mutterwürfels reanimiert. Spätestens bei der lustlosen Umsetzung dieser Schlüßelscene verläßt den Zuschauer das Interesse an Justice League und läßt ihn ungebremst in die Kreisklasse der Superheldenverfilmungen abtauchen. Die Chance, den Zuschauer an den Film zu fesseln, wird spätestens hier vertan.
Am Ende gibts die obligatorische Keilerei und die Superhelden obsiegen. Welt gerettet. Fertig.
Lästig, wie so oft seit Matrix 3, ist das Gewinnsel von Präämonen, die im Geleit des Schurken wie ein Schwarm Schmeißfliegen unseren Helden um die Nase surren.
Da möchte man als Zuschauer am liebsten mit der Riesenfliegenpatsche Amoklaufen.
Klar muß der Regisseur irgendwie die Leinwand füllen, Masse ersetzt aber bekanntlich keine Klasse.
Wer das Superhelden Pendant der Avengers gesehen hat, ist bereits dem höherwertigen Original begegnet. Die Handlungen mit dem Artefakte sammelnden Weltraumschurken ähneln sich zu sehr, als daß man nicht von Ideenraub sprechen könnte. Wo die Avengers aber einen Actionoverkill zelebrieren und mit Bombast zu überzeugen zu versuchen, wirkt die Justice League mit seiner gedrosselten Produktion schon beinahe antiquiert.
Das eine gute Idee über Effektgewitter obsiegt, hat DC schon mit Wonder Woman erfolgreich unter Beweis gestellt. Aber an genau diesen Lichtblicken mangelt es Justice League, so daß man das schon fast als angenehm zu katogerisierende Downsize der Materialschlacht als nicht akzeptables Experiment bezeichnen muß...
Die Handlung ist blöd wie immer: Auf der Erde befinden sich 3 magische Würfel. Ein außerirdischer Superschurke will die reine Energie enthaltenen Artefakte an sich bringen, um die Erde in eine garstige Vorhölle zu verwandeln.
Die Superhelden scheinen gegen gegen den gottgleichen Bösewicht Steppenwolf am Ende ihrer Möglichkeiten. Aber dank einer lächerlichen Idee wird Superman mit Hilfe eines magischen Mutterwürfels reanimiert. Spätestens bei der lustlosen Umsetzung dieser Schlüßelscene verläßt den Zuschauer das Interesse an Justice League und läßt ihn ungebremst in die Kreisklasse der Superheldenverfilmungen abtauchen. Die Chance, den Zuschauer an den Film zu fesseln, wird spätestens hier vertan.
Am Ende gibts die obligatorische Keilerei und die Superhelden obsiegen. Welt gerettet. Fertig.
Lästig, wie so oft seit Matrix 3, ist das Gewinnsel von Präämonen, die im Geleit des Schurken wie ein Schwarm Schmeißfliegen unseren Helden um die Nase surren.
Da möchte man als Zuschauer am liebsten mit der Riesenfliegenpatsche Amoklaufen.
Klar muß der Regisseur irgendwie die Leinwand füllen, Masse ersetzt aber bekanntlich keine Klasse.
Wer das Superhelden Pendant der Avengers gesehen hat, ist bereits dem höherwertigen Original begegnet. Die Handlungen mit dem Artefakte sammelnden Weltraumschurken ähneln sich zu sehr, als daß man nicht von Ideenraub sprechen könnte. Wo die Avengers aber einen Actionoverkill zelebrieren und mit Bombast zu überzeugen zu versuchen, wirkt die Justice League mit seiner gedrosselten Produktion schon beinahe antiquiert.
Das eine gute Idee über Effektgewitter obsiegt, hat DC schon mit Wonder Woman erfolgreich unter Beweis gestellt. Aber an genau diesen Lichtblicken mangelt es Justice League, so daß man das schon fast als angenehm zu katogerisierende Downsize der Materialschlacht als nicht akzeptables Experiment bezeichnen muß...
mit 3
mit 5
mit 4
mit 3
bewertet am 04.11.18 um 22:44
Der amerikanische Roadmovie aus dem Jahr 1970 gilt als absoluter Klassiker und Kultfilm der desillusionierten Posthippie Generation. Dennoch: die Ikone des amerikanischen Independentkinos ist alles andere als eingänglich. Ehrlich gesagt, ist eher das glatte Gegenteil der Fall. Asphaltrennennen ist provokant, verstörend, ein Affront gegen die guten Sitten der Erzählkunst, lethargisch und, ja, auf Grund seiner kultivierten Belanglosigkeit auch langweilig. Er ist weit davon entfernt, sich dem Geschmack des Publikum anzubiedern, sondern eignet sich vielmehr als Wetzstein für intellektuelle Cineastenphantasien.
Wegen dem gewollten Bruch mit der in Jahrzehnten perfektionierten Logik des Unterhaltungskinos, ist Asphaltrennen genaugenommen ein Antiroadmovie, wenn nicht gar der Prototyp des Antifilm an sich.
Zeichnet sich der klassische Roadmovie durch einen unbändigen Freiheitsdrang und einer seelischen und landschaftlichen Weite aus, sind hier die Protagonisten in ihren statischen Verhaltensmustern limitiert und erzeugen mit ihren psychischen, beinahe autistischen Begrenzungen eher Mitleid, als daß sie die Fackel der Freiheit in die Welt tragen könnten.
Zwei junge Erwachsene (Singer Songwriter James Taylor und Beach Boy Dennis Wolson in ihren einzigen Filmrollen), treiben durch die Provinz der USA, um sich mit ihrem Chevrolet One-Fifty in illegalen Autorennen ihr Lebensunterhalt zu verdienen. Während ihres Trips durch den Südwesten treffen sie auf den exzentrischen Aussteiger GTO (benannt nach seinem Pontiac), mit dem sie ein Wettrennen nach Washington vereinbaren. Während GTO auf dem Weg zum Ziel zu Lasten seiner Siegeschance ständig skurrile Tramper in sein Auto schaufelt, unterbrechen der "Driver" und der "Mechanic" die Herausforderung durch Wettrennen mit den Dorfproleten am Rande der Landstraße.
An der Widersprüchlichkeit zwischen der Wette (dem Rennen) und dem tatsächlichen, diesem Ziel reziprok widersprechenden Verhalten der Figuren, läßt sich exzemplarisch herauslesen, was den verstörenden Reiz und die destruktive Besondersheit dieses Filmes ausmacht. Asphaltrennen spielt mit den Erwartungen der Zuschauer und mit den hergebrachten Motiven der Filmkultur. Wo ein Wettrennen an sich der Startschuß und Garant für einen spannenden Plot ist, führt Regisseur Monte Hellmann alle Errungenschaften dieser Kunstform ad absurdum. Statt donnerndes Highspeedgewitter bekommt der Zuschauer zwei schlafwandelnde Protagonisten serviert, die sich fast desinteressiert durch ihr Leben lavieren. Nichts ist konkret, alles ist in der Schwebe. Gelebt wird für den Moment und eine tiefenpsychologische, hippieideal getränkte Unterfütterung ihres Lifestyles ist hier Fehlanzeige.
Die beiden setzen kein Infernal für die Freiheit, sondern erfüllen stattdessen, fast spießig-pflichtbewußt, einfach die Aufgabe, die das Leben ihnen so zugewiesen hat. Hier ist das Straßenrennen austauschbar mit einem Bürojob.
Man könnte dem Geschehen fast die konfuzianische Philosophie der Schicksalsergebenheit zu Grunde legen. Diese Irrationalität wirkt auf den westlichen, zweckorietiert denkenden Menschen verstörend.
Aber es hört ja bei dem Rennen nicht auf: Der ganze Film ist ein einziger Affront gegen die liebgewonnenen Sehgewohnheiten. Der Schnitt wirkt dilletantisch und stümperhaft, einzelne Scenen wirken deplaziert, vielversprechende Handlungsstränge verenden unspektakulär im Nichts, selbst die Beziehung zu einer mitfahrenden Tramperin, sonst herzzerreißender Höhepunkt, ist frei von emotionalen, intimen Momenten und verliert sich durch die Antiheldenhaften, Ottonarmalverbraucher typischen Verhaltensblockaden, im belanglosen Geplänkel. Die Schauspieler, inkl. die Statisten, sind allesamt Amateure oder (manchmal heimlich gefilmte) Einheimische, die immer genau das nicht machen, was ein dressierter Mime nach guter alter Drehbuchmanier in den jeweiligen Situationen tun würde. Dadurch wird jegliches Flair einer Hollywoodproduktion zerstört und ein dokumentarischer Touch erzeugt.
Ebenso wie das unspektakuläre Gebaren der Akteure, ist die Geschichte in allen ihren einzelnen Aspekten unkonventionell, da sie auf alle gewohnten Spannungsmuster verzichtet und die Handlungsstränge stattdessen im erzählerischen Niemandsland mäandern. So irritierend der Film für den Zuschauer ist und so wenig er die Unterhatungssynapsen stimuliert, so sehr beißt sich der Film dennoch im Kopf fest. Denn: all die Vopas und Beleidigungen der Erwartungshaltungen können natürlich kein Zufall sein. Also was soll der ganze Spuk denn nun bedeuten?
Ganz einfach: Regisseur Hellmann dreht den Spieß der akademischen Filmtheorie einfach auf den Kopf!
Die Freiheit, das zentrale Motiv der Roadmovies ergibt sich hier eben nicht durch das Gezeigte, sondern wird durch die unkonventionelle Art der Inszenierung zelebriert! So begrenzt die Personen in ihren Verhaltensmustern sind, so wenig der Erzählstil dem Verstand behagt, desto mehr inszenatorische Freiheiten nimmt sich der Regisseur im Zerstören der Publikumserwartungen heraus. Dieser Drang, alles hinter sich zu lassen, auf die Konventionen zu pfeiffen und in die große Weite zu reisen; all diese Komponenten liegen jenseits der Ebene des visuell Dargestellten. Der große Spaß des Reisens der Roadmovieheroen wird hier durch die anarchische Inszenierung in Hellmanns großen Spaß an der Parodie und des Spottes des klassischen Hollywoodkinos verkehrt.
Wer nicht in der Lage oder Willens ist, hinter die Fassade des sensorisch erfaßbaren zu schauen, wird nur ein kleines, stümperhaft zusammengeschustertes und höhepunktloses Zelluloidzaubers zu Gesicht zu kommen.
Wer sich aber von der auf Unterhaltung fixierten Funktionsweise seines Stammhirnes emanzipieren kann, der wird mit einer ganz spezielle Odysee im Geiste des französischen Autorenkinos ala Jean-Luc Godards Elf Uhr Nachts belohnt.
Das sollte man wissen. Sonst sieht man die Leinwand vor lauter Fragezeichen nicht.
Oder man schläft eben ein.
Asphaltrennen ist kein großer, wuchtiger Film, sondern ein Werk für den stillen Genießer, der die feinen Nuancen zu schätzen und die ironischen Untertöne zu lesen weiß. Selten hat sich das New Hollywood Kino Amerikas der späten sechziger und frühen siebziger dem europäischen Autorenkino der Nouvelle Vague so angenähert wie hier. Und deßhalb ist das kleine, düster-schmutzig schimmernde Juwel, aus dem Kanon der Filmgeschichte nicht mehr wegzudenken...
Wegen dem gewollten Bruch mit der in Jahrzehnten perfektionierten Logik des Unterhaltungskinos, ist Asphaltrennen genaugenommen ein Antiroadmovie, wenn nicht gar der Prototyp des Antifilm an sich.
Zeichnet sich der klassische Roadmovie durch einen unbändigen Freiheitsdrang und einer seelischen und landschaftlichen Weite aus, sind hier die Protagonisten in ihren statischen Verhaltensmustern limitiert und erzeugen mit ihren psychischen, beinahe autistischen Begrenzungen eher Mitleid, als daß sie die Fackel der Freiheit in die Welt tragen könnten.
Zwei junge Erwachsene (Singer Songwriter James Taylor und Beach Boy Dennis Wolson in ihren einzigen Filmrollen), treiben durch die Provinz der USA, um sich mit ihrem Chevrolet One-Fifty in illegalen Autorennen ihr Lebensunterhalt zu verdienen. Während ihres Trips durch den Südwesten treffen sie auf den exzentrischen Aussteiger GTO (benannt nach seinem Pontiac), mit dem sie ein Wettrennen nach Washington vereinbaren. Während GTO auf dem Weg zum Ziel zu Lasten seiner Siegeschance ständig skurrile Tramper in sein Auto schaufelt, unterbrechen der "Driver" und der "Mechanic" die Herausforderung durch Wettrennen mit den Dorfproleten am Rande der Landstraße.
An der Widersprüchlichkeit zwischen der Wette (dem Rennen) und dem tatsächlichen, diesem Ziel reziprok widersprechenden Verhalten der Figuren, läßt sich exzemplarisch herauslesen, was den verstörenden Reiz und die destruktive Besondersheit dieses Filmes ausmacht. Asphaltrennen spielt mit den Erwartungen der Zuschauer und mit den hergebrachten Motiven der Filmkultur. Wo ein Wettrennen an sich der Startschuß und Garant für einen spannenden Plot ist, führt Regisseur Monte Hellmann alle Errungenschaften dieser Kunstform ad absurdum. Statt donnerndes Highspeedgewitter bekommt der Zuschauer zwei schlafwandelnde Protagonisten serviert, die sich fast desinteressiert durch ihr Leben lavieren. Nichts ist konkret, alles ist in der Schwebe. Gelebt wird für den Moment und eine tiefenpsychologische, hippieideal getränkte Unterfütterung ihres Lifestyles ist hier Fehlanzeige.
Die beiden setzen kein Infernal für die Freiheit, sondern erfüllen stattdessen, fast spießig-pflichtbewußt, einfach die Aufgabe, die das Leben ihnen so zugewiesen hat. Hier ist das Straßenrennen austauschbar mit einem Bürojob.
Man könnte dem Geschehen fast die konfuzianische Philosophie der Schicksalsergebenheit zu Grunde legen. Diese Irrationalität wirkt auf den westlichen, zweckorietiert denkenden Menschen verstörend.
Aber es hört ja bei dem Rennen nicht auf: Der ganze Film ist ein einziger Affront gegen die liebgewonnenen Sehgewohnheiten. Der Schnitt wirkt dilletantisch und stümperhaft, einzelne Scenen wirken deplaziert, vielversprechende Handlungsstränge verenden unspektakulär im Nichts, selbst die Beziehung zu einer mitfahrenden Tramperin, sonst herzzerreißender Höhepunkt, ist frei von emotionalen, intimen Momenten und verliert sich durch die Antiheldenhaften, Ottonarmalverbraucher typischen Verhaltensblockaden, im belanglosen Geplänkel. Die Schauspieler, inkl. die Statisten, sind allesamt Amateure oder (manchmal heimlich gefilmte) Einheimische, die immer genau das nicht machen, was ein dressierter Mime nach guter alter Drehbuchmanier in den jeweiligen Situationen tun würde. Dadurch wird jegliches Flair einer Hollywoodproduktion zerstört und ein dokumentarischer Touch erzeugt.
Ebenso wie das unspektakuläre Gebaren der Akteure, ist die Geschichte in allen ihren einzelnen Aspekten unkonventionell, da sie auf alle gewohnten Spannungsmuster verzichtet und die Handlungsstränge stattdessen im erzählerischen Niemandsland mäandern. So irritierend der Film für den Zuschauer ist und so wenig er die Unterhatungssynapsen stimuliert, so sehr beißt sich der Film dennoch im Kopf fest. Denn: all die Vopas und Beleidigungen der Erwartungshaltungen können natürlich kein Zufall sein. Also was soll der ganze Spuk denn nun bedeuten?
Ganz einfach: Regisseur Hellmann dreht den Spieß der akademischen Filmtheorie einfach auf den Kopf!
Die Freiheit, das zentrale Motiv der Roadmovies ergibt sich hier eben nicht durch das Gezeigte, sondern wird durch die unkonventionelle Art der Inszenierung zelebriert! So begrenzt die Personen in ihren Verhaltensmustern sind, so wenig der Erzählstil dem Verstand behagt, desto mehr inszenatorische Freiheiten nimmt sich der Regisseur im Zerstören der Publikumserwartungen heraus. Dieser Drang, alles hinter sich zu lassen, auf die Konventionen zu pfeiffen und in die große Weite zu reisen; all diese Komponenten liegen jenseits der Ebene des visuell Dargestellten. Der große Spaß des Reisens der Roadmovieheroen wird hier durch die anarchische Inszenierung in Hellmanns großen Spaß an der Parodie und des Spottes des klassischen Hollywoodkinos verkehrt.
Wer nicht in der Lage oder Willens ist, hinter die Fassade des sensorisch erfaßbaren zu schauen, wird nur ein kleines, stümperhaft zusammengeschustertes und höhepunktloses Zelluloidzaubers zu Gesicht zu kommen.
Wer sich aber von der auf Unterhaltung fixierten Funktionsweise seines Stammhirnes emanzipieren kann, der wird mit einer ganz spezielle Odysee im Geiste des französischen Autorenkinos ala Jean-Luc Godards Elf Uhr Nachts belohnt.
Das sollte man wissen. Sonst sieht man die Leinwand vor lauter Fragezeichen nicht.
Oder man schläft eben ein.
Asphaltrennen ist kein großer, wuchtiger Film, sondern ein Werk für den stillen Genießer, der die feinen Nuancen zu schätzen und die ironischen Untertöne zu lesen weiß. Selten hat sich das New Hollywood Kino Amerikas der späten sechziger und frühen siebziger dem europäischen Autorenkino der Nouvelle Vague so angenähert wie hier. Und deßhalb ist das kleine, düster-schmutzig schimmernde Juwel, aus dem Kanon der Filmgeschichte nicht mehr wegzudenken...
mit 3
mit 3
mit 3
mit 3
bewertet am 03.11.18 um 11:28
Statt makaberer Horror nur gespenstisches Zähnegeklapper.
Wo Stephen King in seiner literarischen Vorlage mit seiner morbider Schauergeschichte um 7 heranwachsende Kids und einem durchgedrehten Clown mit subtilem Grauen die Spannungsschraube bis an die Schmerzgrenze schraubte und für so manch eingenäßtes Bettlaken sorgte, setzt Regisseur Andres Muschietti vermehrt auf Gebißakrobatik.
Natürlich kann ein Film beim Vergleich mit der eigenen Fantasie fast nur verlieren, die Neuverfilmung setzt aber statt auf beklemmende Athmosphäre zu sehr auf visuelle Effekte und wohlbekannte Schockelemente. Durch das Raubbauen im Fundus an zeitgenößischer Spuk- und Geistermovies, heimelt sich Es zu sehr dem Mainstreamkonsens an und entfernt sich zu weit von der unverwechselbaren Stimmung des Romanes.
Mag der Clown mit seiner Kauleiste noch so klappern wie der Klabautermann auf Fuselentzug; die Effekthascherei wirkt allzu anbiedernd und mutlos.
Auch wenn die Produzenten sicherlich auch die Ansprüche und abgestumpften Sehgewohnheiten der jugendlichen Konsumenten im Auge haben mußten, die mit knirschenden Spukschloßdielen und flackernden Kerzenlichtern nicht mehr in Todesangst zu versetzen sind: Aus Kings Clown eine Popkulturikone ala Freddy Krüger kreieren zu wollen mag aus pekuniärer Sicht nachvollziehbar erscheinen, sorgt sicherlich auch für einige schaurigen Showeinlagen, lenkt aber letztendlich von der klaustrophobischen Bedrücktheit der Vorlage ab.
Inwieweit der Film dem Buch treu bleibt, kann ich nicht mehr mit Gewißheit sagen. Es ist zu lange her, als daß ich mich an Details des Schauerepos erinnern könnte. Etwas künstlerische Freiheit ist bei der Umsetzung von einem Medium in ein Anderes ja unter Umständen auch sehr hilfreich, wenn nicht unabdingbar.
Ich bin mir aber ziemlich sicher, daß Stephen King nicht so auf dem dentalem Wildwuchs des Clowns rumgeritten ist, wie Maschietti, der hier einen regelrechten Fetisch zu entwickeln scheint.
Das ist zwar alles recht ordentlich anzuschauen, ebenso wie die gymnastischen Verrenkungen des Berufsbespaßers, leider wurde aber, wie bereits vermerkt, die Einbettung in ein überzeugendes Spannungskorsett versäumt.
Wo Es hingegen Punkten kann, ist die Beleuchtung des Seelenlebens der heranwachsenden Kiddies. Im Buch macht dieser Aspekt mindestens die Hälfte des Lesevergnügens aus. Stephen King ist nicht nur ein Meister des Über- und Unnatürlichen, sondern auch ein exzellenter psychischer Feinzeichner, insbesondere der Kinderseele. Es ist faszinierend, sich beim Lesen einiger seiner Bücher wieder in die eigene Gefühlswelt dieser Lebensphase zurückversetzt zu fühlen und verschüttet geglaubten Seelenregungen zu begegnen. Das kennt man eigentlich nur aus den Erzählungen von Hermann Hesse, Hans Carossa, Gottfried Keller und anderen Helden der Romantik.
Auch wenn es der Film nicht schafft, so tief in der Seele zu graben, wie es das Buch vermag, so bohrt er doch unter der Oberfläche der Wahrnehmung und offenbart damit ein außergewöhnliches erzählerisches Können. Sicherlich ist dies nicht der Fokus des Filmes und ein sensationslüsternes Publikum wird dadurch eher verstört als begeistert. Doch zieht Es durch seine gewiße Sensibilität genau hieraus seine Berechtigung und huldigt damit dem Genie seines Erschaffers und seiner großen Fangemeinde.
Ohne diese "Stand by me" Elemente wäre Es wohl kaum mehr als eine weitere zeitgenößisch aufgepimpte Variante des Monsterfilmes und würde alsbald im endlosen Meer des Creaturehorrors untergehen. So aber hinterläßt er einen Fußabdruck, der mehr ist als bloßes Schaulaufen einer breakdancenden Haifischfresse...
Wo Stephen King in seiner literarischen Vorlage mit seiner morbider Schauergeschichte um 7 heranwachsende Kids und einem durchgedrehten Clown mit subtilem Grauen die Spannungsschraube bis an die Schmerzgrenze schraubte und für so manch eingenäßtes Bettlaken sorgte, setzt Regisseur Andres Muschietti vermehrt auf Gebißakrobatik.
Natürlich kann ein Film beim Vergleich mit der eigenen Fantasie fast nur verlieren, die Neuverfilmung setzt aber statt auf beklemmende Athmosphäre zu sehr auf visuelle Effekte und wohlbekannte Schockelemente. Durch das Raubbauen im Fundus an zeitgenößischer Spuk- und Geistermovies, heimelt sich Es zu sehr dem Mainstreamkonsens an und entfernt sich zu weit von der unverwechselbaren Stimmung des Romanes.
Mag der Clown mit seiner Kauleiste noch so klappern wie der Klabautermann auf Fuselentzug; die Effekthascherei wirkt allzu anbiedernd und mutlos.
Auch wenn die Produzenten sicherlich auch die Ansprüche und abgestumpften Sehgewohnheiten der jugendlichen Konsumenten im Auge haben mußten, die mit knirschenden Spukschloßdielen und flackernden Kerzenlichtern nicht mehr in Todesangst zu versetzen sind: Aus Kings Clown eine Popkulturikone ala Freddy Krüger kreieren zu wollen mag aus pekuniärer Sicht nachvollziehbar erscheinen, sorgt sicherlich auch für einige schaurigen Showeinlagen, lenkt aber letztendlich von der klaustrophobischen Bedrücktheit der Vorlage ab.
Inwieweit der Film dem Buch treu bleibt, kann ich nicht mehr mit Gewißheit sagen. Es ist zu lange her, als daß ich mich an Details des Schauerepos erinnern könnte. Etwas künstlerische Freiheit ist bei der Umsetzung von einem Medium in ein Anderes ja unter Umständen auch sehr hilfreich, wenn nicht unabdingbar.
Ich bin mir aber ziemlich sicher, daß Stephen King nicht so auf dem dentalem Wildwuchs des Clowns rumgeritten ist, wie Maschietti, der hier einen regelrechten Fetisch zu entwickeln scheint.
Das ist zwar alles recht ordentlich anzuschauen, ebenso wie die gymnastischen Verrenkungen des Berufsbespaßers, leider wurde aber, wie bereits vermerkt, die Einbettung in ein überzeugendes Spannungskorsett versäumt.
Wo Es hingegen Punkten kann, ist die Beleuchtung des Seelenlebens der heranwachsenden Kiddies. Im Buch macht dieser Aspekt mindestens die Hälfte des Lesevergnügens aus. Stephen King ist nicht nur ein Meister des Über- und Unnatürlichen, sondern auch ein exzellenter psychischer Feinzeichner, insbesondere der Kinderseele. Es ist faszinierend, sich beim Lesen einiger seiner Bücher wieder in die eigene Gefühlswelt dieser Lebensphase zurückversetzt zu fühlen und verschüttet geglaubten Seelenregungen zu begegnen. Das kennt man eigentlich nur aus den Erzählungen von Hermann Hesse, Hans Carossa, Gottfried Keller und anderen Helden der Romantik.
Auch wenn es der Film nicht schafft, so tief in der Seele zu graben, wie es das Buch vermag, so bohrt er doch unter der Oberfläche der Wahrnehmung und offenbart damit ein außergewöhnliches erzählerisches Können. Sicherlich ist dies nicht der Fokus des Filmes und ein sensationslüsternes Publikum wird dadurch eher verstört als begeistert. Doch zieht Es durch seine gewiße Sensibilität genau hieraus seine Berechtigung und huldigt damit dem Genie seines Erschaffers und seiner großen Fangemeinde.
Ohne diese "Stand by me" Elemente wäre Es wohl kaum mehr als eine weitere zeitgenößisch aufgepimpte Variante des Monsterfilmes und würde alsbald im endlosen Meer des Creaturehorrors untergehen. So aber hinterläßt er einen Fußabdruck, der mehr ist als bloßes Schaulaufen einer breakdancenden Haifischfresse...
mit 3
mit 4
mit 4
mit 3
bewertet am 27.10.18 um 13:04
Ich habe den Film für 5,- Euro auf dem Flohmarkt geschoßen.....und Voila, allein damit wurden die Produktionskosten schon wieder eingespielt.
Aber ernsthaft: Wer sich City Spiders kauft, erwartet kein Ben Hur, sondern ein B-Movie mit allen ihm üblichen Tücken, als da wären: Ein Drehbuch, bei dem plausible Handlungen mit juristischen Konsequenzen geahndet werden, Schauspieler die ihre Rollen auf dem Sozialamt angeboten bekommen haben und Spezialeffekte, die im wahrsten Sinne des Wortes sehr "Spezial" sind.
So bleiben einem Enttäuschungen erspart.
An diesem Maßstab gemessen, spielt City Spiders sicher in der unteren Liga der B-Movies mit, denn... kein Akteur schafft es, sich bis auf die Knochen zu blamieren, mit viel Phantasie und Feierabendbier ist eine Handlung rekonstruierbar und das Beastcreaturedesign ist zu monströs, um Lachsalven zu provozieren.
Den Kommentaren zufolge wurde der Film anscheinend in Real 3D gedreht. Ich äußere daran allerdings berechtigte Zweifel, denn die Tiefenwirkung ist durchaus überschaubar und die Objekte im Raum wirken zweidimensional. Perspektivische Verschiebungen bei Kameraschwenks scheinen ebenso eher für eine nachträgliche Konvertierung zu sprechen.
Sei's drum: Das Bild ist schön scharf und weitesgehendst frei von Doppelkonturen, was für ein entspanntes Filmvergnügen sorgt. Bei den New Yorker Panoramabildern und beim Veitztanz des Mutterungeheuers, keimt sogar kurzzeitig richtiges 3D Feeling auf.
Wer auf B-Movies steht, wird hier gut bedient, auch wenn sich der Trashfaktor in Grenzen hält. City Spiders ist nämlich keine Parodie wie Sharknado, denn dafür ist er zu ambitioniert produziert. Man ist hier sichtlich um Seriösität bemüht und so richtige Fremdschämmomente gibt es eigentlich keine.
Peinlich sind somit nur die Interviews der Extras, bei dem die Protagonisten über die psychologische Komplexität des Werkes referieren wird, als wäre gerade Citizen Cane eine Symbiose mit den Tragödien des Ayschilos und Sophokles eingegangen und als würde die Komplexität der Spezialeffekte die Transformers wie Klappstühle aussehen lassen.
Somit ist City Spiders ein kleiner harmloser Snack für zwischendurch, den man sich mal zum Durchschnaufen gönnen darf, bevor man das Marvel Universum wieder durch die gute Stube wüten läßt...
Und ACHTUNG: Nur die Version kaufen, bei der links unten auf dem Cover "Neue 3D Version" steht. Die erste 3D Version war anscheinend ein technisches Armageddon...
Aber ernsthaft: Wer sich City Spiders kauft, erwartet kein Ben Hur, sondern ein B-Movie mit allen ihm üblichen Tücken, als da wären: Ein Drehbuch, bei dem plausible Handlungen mit juristischen Konsequenzen geahndet werden, Schauspieler die ihre Rollen auf dem Sozialamt angeboten bekommen haben und Spezialeffekte, die im wahrsten Sinne des Wortes sehr "Spezial" sind.
So bleiben einem Enttäuschungen erspart.
An diesem Maßstab gemessen, spielt City Spiders sicher in der unteren Liga der B-Movies mit, denn... kein Akteur schafft es, sich bis auf die Knochen zu blamieren, mit viel Phantasie und Feierabendbier ist eine Handlung rekonstruierbar und das Beastcreaturedesign ist zu monströs, um Lachsalven zu provozieren.
Den Kommentaren zufolge wurde der Film anscheinend in Real 3D gedreht. Ich äußere daran allerdings berechtigte Zweifel, denn die Tiefenwirkung ist durchaus überschaubar und die Objekte im Raum wirken zweidimensional. Perspektivische Verschiebungen bei Kameraschwenks scheinen ebenso eher für eine nachträgliche Konvertierung zu sprechen.
Sei's drum: Das Bild ist schön scharf und weitesgehendst frei von Doppelkonturen, was für ein entspanntes Filmvergnügen sorgt. Bei den New Yorker Panoramabildern und beim Veitztanz des Mutterungeheuers, keimt sogar kurzzeitig richtiges 3D Feeling auf.
Wer auf B-Movies steht, wird hier gut bedient, auch wenn sich der Trashfaktor in Grenzen hält. City Spiders ist nämlich keine Parodie wie Sharknado, denn dafür ist er zu ambitioniert produziert. Man ist hier sichtlich um Seriösität bemüht und so richtige Fremdschämmomente gibt es eigentlich keine.
Peinlich sind somit nur die Interviews der Extras, bei dem die Protagonisten über die psychologische Komplexität des Werkes referieren wird, als wäre gerade Citizen Cane eine Symbiose mit den Tragödien des Ayschilos und Sophokles eingegangen und als würde die Komplexität der Spezialeffekte die Transformers wie Klappstühle aussehen lassen.
Somit ist City Spiders ein kleiner harmloser Snack für zwischendurch, den man sich mal zum Durchschnaufen gönnen darf, bevor man das Marvel Universum wieder durch die gute Stube wüten läßt...
Und ACHTUNG: Nur die Version kaufen, bei der links unten auf dem Cover "Neue 3D Version" steht. Die erste 3D Version war anscheinend ein technisches Armageddon...
mit 3
mit 3
mit 3
mit 2
bewertet am 17.10.18 um 17:14
Ich muß mir wohl Recht geben, wenn ich behaupte, daß da scheinbar jemand von immensem Groll geplagt war, weil er sich nicht im Besitz der King Kong gegen Godzilla Filmrechte wähnte. Dieserjenige beschloß wohl aus reinem Spaß am Trotz und Plagieren, auf eigene Faust als Ersatz für den Clash der Originalurzeitgiganten, zwei Monsterdummies aus der B-Liga aufeinander zu hetzen.
Als Kong Double muß ein Albino Silberrücken, der mehr Buddy als Affentier von Tierpfleger (und Ex-Tierschutz Rambo) Dwayne Johnson ist, den Arsch hinhalten. Das tagesaktuelle Klein Klein zwischen den beiden Alphas wird mit Mimik und Gesten besprochen, für kompliziertere Debatten und den gehobenen Ulk benutzt man die universelle Zeichensprache.
Für Godzilla muß eine hypertrophierte Turboversion eines See you later Alligators in die Bresche springen.
Mehr Drache als Riesenechse schnorchelt das Panzertier, von einer myteriösen Frequenz angelockt, nach Chicago. Gleiches Verhalten wiederum zeigt auch King Kong und ebenso ein furchteinflößendem Wolfungetüm, welches metzelnd und mordend eine Schneise von Tod und Verwüstung auf dem Weg in die Metropole hinter sich herzieht.
Dort angekommen, batteln sich die 3 Mutanten bis zum tödlichen Finish, bei dem am Ende schließlich zwei Riesenkadaver für ein Überangebot an billigem BBQ Fleisch in Chicago sorgen.
Warum aber zieht es die 3 Naturburschen überhaupt in die Großstadt? Die Antwort ist verblüffend einfach: Im Weltraum wurde mit einer geheimen, genverändernden Substanz experimentiert. Den Angriff einer mutierten Laborratte überlebt irgendwie niemand an Bord und die Behälter mit dem Gift regnen aus der Rettungskapsel auf die Erde hernieder. Eben einer in einen Wolfrudel, einer einem miesgelauntem Alligator vor die Schnauze und einer ins Affengehege. Noch Fragen?
Und natürlich, ihr habt's sicherlich schon geraten, haben die boshaften Geningenieure eine Mutation in das Gift eingebaut (eine biophonare Gensequenz !!!), welchem die mutierte Wesen nicht widerstehen können. Einmal in den Bann des Äthers geraten, verspüren die Biester den unkontrollierbaren Drang, aktiv gegen die Geräuschverschmutzung zu intervenieren, welche die fiesen Kapitalistenschweine und korrupten Schweinesauwissenschaftler aus Chicago aussenden, um ihre Kreaturen wieder zurück in Muttis Schoß zu lotsen. Dort eingefangen, will man sie wieder als Kampfwaffe höchstbietend bei E-Bay verhökern.
Oder so ähnlich.
Näher auf die Handlung einzugehen, beleidigt meine Ehre als seriöser Nichtsnutz. Nur noch soviel: Allen Schauspielern merkt man an, daß sie nicht viel mehr sind als Staffage und Statisten, die den Stars der Manege nicht die Show stehlen dürfen. So treten denn auch die Handlung und die Akteure niemals aus den Schatten Johnsons und seiner CGI Heroen heraus, sondern agieren stattdessen monotyp, statisch und zurückhaltend.
Eine ähnliche Rolle kommt auch dem Megawerwolf zu. Er fristet ein Mauerblümchendasein und seine Auftritte wirken trotz seiner grimmigen Präsenz allzu hastig abgedreht. Sie scheinen vor allen Dingen die Funktion zu erfüllen, den Zuschauer während der Pseudohandlung nicht in einen Dämmerschlaf versinken zu lassen und ihn bis zum Finale Furiosum wach zu halten. Hier wäre trotz seines knackigen Vernichtungsfeldzuges einiges mehr an Dramatik drin gewesen.
Wer am Creaturehorror Vergnügen hat, kommt allerdings spätestens am Ende doch auf seine Kosten. Der Showdown macht Spaß und in der Zerstörungsorgie wird an nichts gespart. Selbstverständlich setzt man auch hier nicht auf Spannung, geschweige denn auf raffinierte oder dramatische Handlungssegmente, sondern spielt routiniert mit den visuellen Vorzügen ausufernder Materialschlachten.
Natürl ich sind auch die Handlungen in den japanischen Godzillafilmen hahnebüchen. Was dort aber herrlich albern und augenzwinkernd umgesetzt wird und sich nahtlos in das triviale Gummimonsteruniversum einfügt, wird in Rampage dem Zuschauer zu bierernst aufgetischt. Auch wenn Rampage sich um Unlogik bemüht und damit versucht auf der Sharknadowelle zu reiten, so geht ihm doch der trashige Charme des Haiepos, bzw. der Nipponkröten ab. Entweder dreht man einen echten Actionkracher, oder aber man parodiert denselben. Das unentschloßene Lavieren zwischen Bad Taste und solider Actionkost muß man wohl der Mutlosigkeit der Produzenten zuschreiben, die es wohl allen Recht machen wollten, damit aber letztendlich niemanden so richtig glücklich gemacht haben. Beide Varianten können für sich allein genommen ihren Reiz haben und zufriedenstellend unterhalten. In diesem Falle aber verstören die (hoffentlich) gewollten Logikdefizite der Story und die blassen Schubladencharaktere den Zuschauer bis zum Grande Finale. Ein wenig mehr Eindeutigkeit im Tenor hätte für ein gelungenes Kintopvergnügen gesorgt. So aber läßt man sich, mal angeregt, mal gähnend durch den Blockbuster treiben, wie ein Trapper auf seinem Floß den Yukon herunter.
Heute, einen Tag nach dem Ronezvous mit Rampage, verblaßt die Erinnerung an ihn schon allmählich und er entgleitet langsam aber unaufhaltsam in die nebelige Dämmerung des Vergessens....
Kann man sich den Film ein zweites mal anschauen? Selbstverständlich. Aber ein Finger sollte immer auf Tuchfühlung mit der Vorspultaste bleiben...!
Das 3D ist recht ordentlich und bereichert den Film definitiv!
Als Kong Double muß ein Albino Silberrücken, der mehr Buddy als Affentier von Tierpfleger (und Ex-Tierschutz Rambo) Dwayne Johnson ist, den Arsch hinhalten. Das tagesaktuelle Klein Klein zwischen den beiden Alphas wird mit Mimik und Gesten besprochen, für kompliziertere Debatten und den gehobenen Ulk benutzt man die universelle Zeichensprache.
Für Godzilla muß eine hypertrophierte Turboversion eines See you later Alligators in die Bresche springen.
Mehr Drache als Riesenechse schnorchelt das Panzertier, von einer myteriösen Frequenz angelockt, nach Chicago. Gleiches Verhalten wiederum zeigt auch King Kong und ebenso ein furchteinflößendem Wolfungetüm, welches metzelnd und mordend eine Schneise von Tod und Verwüstung auf dem Weg in die Metropole hinter sich herzieht.
Dort angekommen, batteln sich die 3 Mutanten bis zum tödlichen Finish, bei dem am Ende schließlich zwei Riesenkadaver für ein Überangebot an billigem BBQ Fleisch in Chicago sorgen.
Warum aber zieht es die 3 Naturburschen überhaupt in die Großstadt? Die Antwort ist verblüffend einfach: Im Weltraum wurde mit einer geheimen, genverändernden Substanz experimentiert. Den Angriff einer mutierten Laborratte überlebt irgendwie niemand an Bord und die Behälter mit dem Gift regnen aus der Rettungskapsel auf die Erde hernieder. Eben einer in einen Wolfrudel, einer einem miesgelauntem Alligator vor die Schnauze und einer ins Affengehege. Noch Fragen?
Und natürlich, ihr habt's sicherlich schon geraten, haben die boshaften Geningenieure eine Mutation in das Gift eingebaut (eine biophonare Gensequenz !!!), welchem die mutierte Wesen nicht widerstehen können. Einmal in den Bann des Äthers geraten, verspüren die Biester den unkontrollierbaren Drang, aktiv gegen die Geräuschverschmutzung zu intervenieren, welche die fiesen Kapitalistenschweine und korrupten Schweinesauwissenschaftler aus Chicago aussenden, um ihre Kreaturen wieder zurück in Muttis Schoß zu lotsen. Dort eingefangen, will man sie wieder als Kampfwaffe höchstbietend bei E-Bay verhökern.
Oder so ähnlich.
Näher auf die Handlung einzugehen, beleidigt meine Ehre als seriöser Nichtsnutz. Nur noch soviel: Allen Schauspielern merkt man an, daß sie nicht viel mehr sind als Staffage und Statisten, die den Stars der Manege nicht die Show stehlen dürfen. So treten denn auch die Handlung und die Akteure niemals aus den Schatten Johnsons und seiner CGI Heroen heraus, sondern agieren stattdessen monotyp, statisch und zurückhaltend.
Eine ähnliche Rolle kommt auch dem Megawerwolf zu. Er fristet ein Mauerblümchendasein und seine Auftritte wirken trotz seiner grimmigen Präsenz allzu hastig abgedreht. Sie scheinen vor allen Dingen die Funktion zu erfüllen, den Zuschauer während der Pseudohandlung nicht in einen Dämmerschlaf versinken zu lassen und ihn bis zum Finale Furiosum wach zu halten. Hier wäre trotz seines knackigen Vernichtungsfeldzuges einiges mehr an Dramatik drin gewesen.
Wer am Creaturehorror Vergnügen hat, kommt allerdings spätestens am Ende doch auf seine Kosten. Der Showdown macht Spaß und in der Zerstörungsorgie wird an nichts gespart. Selbstverständlich setzt man auch hier nicht auf Spannung, geschweige denn auf raffinierte oder dramatische Handlungssegmente, sondern spielt routiniert mit den visuellen Vorzügen ausufernder Materialschlachten.
Natürl ich sind auch die Handlungen in den japanischen Godzillafilmen hahnebüchen. Was dort aber herrlich albern und augenzwinkernd umgesetzt wird und sich nahtlos in das triviale Gummimonsteruniversum einfügt, wird in Rampage dem Zuschauer zu bierernst aufgetischt. Auch wenn Rampage sich um Unlogik bemüht und damit versucht auf der Sharknadowelle zu reiten, so geht ihm doch der trashige Charme des Haiepos, bzw. der Nipponkröten ab. Entweder dreht man einen echten Actionkracher, oder aber man parodiert denselben. Das unentschloßene Lavieren zwischen Bad Taste und solider Actionkost muß man wohl der Mutlosigkeit der Produzenten zuschreiben, die es wohl allen Recht machen wollten, damit aber letztendlich niemanden so richtig glücklich gemacht haben. Beide Varianten können für sich allein genommen ihren Reiz haben und zufriedenstellend unterhalten. In diesem Falle aber verstören die (hoffentlich) gewollten Logikdefizite der Story und die blassen Schubladencharaktere den Zuschauer bis zum Grande Finale. Ein wenig mehr Eindeutigkeit im Tenor hätte für ein gelungenes Kintopvergnügen gesorgt. So aber läßt man sich, mal angeregt, mal gähnend durch den Blockbuster treiben, wie ein Trapper auf seinem Floß den Yukon herunter.
Heute, einen Tag nach dem Ronezvous mit Rampage, verblaßt die Erinnerung an ihn schon allmählich und er entgleitet langsam aber unaufhaltsam in die nebelige Dämmerung des Vergessens....
Kann man sich den Film ein zweites mal anschauen? Selbstverständlich. Aber ein Finger sollte immer auf Tuchfühlung mit der Vorspultaste bleiben...!
Das 3D ist recht ordentlich und bereichert den Film definitiv!
mit 2
mit 4
mit 4
mit 3
bewertet am 14.10.18 um 18:35
Solo: A Star Wars Story (2018) 3D (Limited Steelbook Edition) (Blu-ray 3D + Blu-ray + Bonus Blu-ray)
Die Frohlockung zuerst: Alden Ehrenreich, Han Solos Alter Ego, ist überraschender Weise nicht der große Griff ins Klo, wie der Trailer zunächst befürchten ließ.
Die Ernüchterung folgt jedoch sogleich auf dem Fuß: Ehrenreich kann die Fußstapfen, die Ford in die Filmgeschichte geschmiedet hat, nicht mal ansatzweise ausfüllen. Wo Ford mit seiner Ganovenverve noch authentisch und mitreißend war, ist Ehrenreich eben nur ein Imitat desselben. Verzichtet man jedoch auf den unfairen Vergleich, spielt er den jungen Han Solo ganz passabel und man sollte nicht das Kreuz über ihn brechen. Er bereitet seinem Schauspiellehrer keine Schande, und erfüllt bloß die Anforderungen des immer seichter werdenden Star Wars Universums.
Solo: A Star Wars Story nudelt die bekannten Themen der Serie routiniert rauf und runter und backt altbekannte Charaktere und Scenen neu auf: Ja, ich hab jetzt verstanden, daß sich in Weltraumkneipen zwielichtige Aliens tummeln. Genug davon!!! Gerade bei den Charakteren der Spin Offs aber läßt sich auch allmählich der Zerfall und die Zerfaserung des Franchises abzeichnen. Es waren ja neben den innovativen Spezialeffekten eben gerade die handvoll gutgelaunt aufspielenden Weltraumhassadeure, die den Kult um die Weltraumsaga begründeten. Diese sind nun aber entweder von ihrer eigenen Brut ins Jedinirvana geschleudert worden oder rotten kreuz und quer über die Galaxie verteilt vor sich hin.
Die charakterliche Ausdünnung ist wohl auch für den finanziellen Mißerfolg des Filmes verantwortlich, denn, ehrlich gesagt, wen interessiert es heute denn überhaupt noch, wann und wo eine Hosentaschenausgabe von Han Solo, ein Ersatz Chewbacca und Reserve Lando ihr erstes Rondevouz hatten?
Die Rahmenhandlung indess ist ebenso überraschend und innovativ wie ein neues Stones Album und läßt sich am ehesten mit einem ausgetretenem Patchworkteppich x-mal gesehener Versatzstücke vergleichen. Ungeniert berichten die beiden ursprünglichen Regisseure Phil Lord und Christopher Miller auch gerne, bei welchen literarischen Vorbildern sie 3 Jahre lang völlig ungeniert alles abgekupfert haben.
Trotz der bemitleidenswürdigen Ideenarmut ist die Weltraumoperette dennoch recht kurzweilig gelungen und vermag dem actionaffinen Zuschauer einige prickelnde Schauwerte zu bescheren. Diese sind allerdings CGI typisch technisch-kalt-überästhetisc h-perfekt geraten und entfalten nicht dieselbe nervenzerrende Wirkung wie eine gute alte handgemachte Stuntkunsteinlage. Besondere Erwähnung verdient hier vor allen Dingen die Heistscene im Schneeexpress und die Jagd durch den von Monstern verseuchten intergalaktischem Malmstrom, bei der temporär trotz Videospielästhetik sogar mal richtig Laune aufkommt.
Alles in allem entfaltet SOLO: A Star Wars Story den Zuschauer trotz einiger packender Momente aber nicht den Sog, der nötig gewesen wäre, den Zuschauer in das Geschehen hineinzuziehen und an die Handlung zu fesseln. Zu schablonenhaft ist eben die Handlung und zu uncharismatisch sind die Protagonisten.
40 Jahre nach dem Start des ersten Teiles schwebt eben noch immer die schwere Last der Originaltrilogie über den Fortsetzungen und lähmt mit seinem übergroßem, epochemachenden Kultstatus, eine von allem Altballast befreite Neuorientierung der Erzählung. So sehr es den Nerd freuen mag, mit den Helden seiner Kindheit erneut im Fighting Falcon durch die Galaxien zu kreuzen, so sehr unterdrückt auch das das Festhalten am Erbe Lucas die Möglichkeiten einer Weiterentwicklung der Geschichte.
Will man nicht im eigenen Mief ersticken, ist eine Emanzipation von den Altvorderen der Saga aber unumgänglich. Zwar kann die Kuh wohl noch etwas gemolken werden, im Grunde ist die Mär um Prinzessin Leia aber auserzählt und wird nur noch künstlich am Leben erhalten, um den harten Kern der Fangemeinde nicht zu verprellen. Will man in die Zukunft gehen, ist eine Frischzellenkur jedoch unerläßlich.
Was dem Film indess auf der handwerklichen Seite schweren Schaden zufügt, ist die Ambivalenz zwischen dem gewollt heiteren Grundtenor des Protagonisten und dem düsteren Look des Filmes, in dem fast ganze Sets in der Dunkelheit verschwinden. Es ist müßig, darüber zu spekulieren, ob der Regiesseurwechsel für den Spagat verantwortlich ist oder nicht. Fakt aber ist, daß die ursprüngliche Crew einen deutlich ernsteren Ableger im Auge hatte und Ron Howard schließlich für die leichte Muse angeheuert wurde. So oder so, welche Philosophie hier auch verfolgt wurde, die Symbiose funktioniert nur Ansatzweise. Einen eigenständigen, selbstbewußten Esprit sucht man hier vergebens. So wird man den Charme der alten Filme, trotz technischer Hochrüstung, wohl nie wieder erreichen.
Den größten Schnitzer erlaubt sich Disney bei der Bluray-Disc Veröffentlichung jedoch bei der technischen Umsetzung. Speziell die Bildqualität ist ein Ärgernis der gehobenen Kategorie. Sind die dunklen Scenen nur ein wenig verwaschen, kann man in der 3D Konvertierung schon von einer glatten Frechheit, bzw Betrug am Kunden sprechen. "Wenn ihr unseren Film schon nicht zu würdigen wißt (das Box Office war katastrophal), dann habt ihr undankbaren Proleten auch kein besseres Bild verdient", mögen sich die Produzenten bei der Veröffentlichung der Scheibe wohl hämisch mit gekreuzten Fingern hinterm Rücken zugeraunt haben.
Wie dem auch sei: Das 3D Bild strotzt nur so vor lauter stereoskopischen Doppelkonturen, so daß eine permanente, störende Tiefenschärfenachregelung während des Filmbetriebes unabläßlich ist, will man nach überstandener Tortur nicht mit einem Silberblick in die Federn gleiten.
Ich unterstelle Disney hier grobe Fahrläßigkeit, da sich auch Rogue One in der 3D Version schon auf Discounterniveau befunden hat.
Ready Player One setzt hier ganz andere Maßstäbe. Siehe dort!
Die Ernüchterung folgt jedoch sogleich auf dem Fuß: Ehrenreich kann die Fußstapfen, die Ford in die Filmgeschichte geschmiedet hat, nicht mal ansatzweise ausfüllen. Wo Ford mit seiner Ganovenverve noch authentisch und mitreißend war, ist Ehrenreich eben nur ein Imitat desselben. Verzichtet man jedoch auf den unfairen Vergleich, spielt er den jungen Han Solo ganz passabel und man sollte nicht das Kreuz über ihn brechen. Er bereitet seinem Schauspiellehrer keine Schande, und erfüllt bloß die Anforderungen des immer seichter werdenden Star Wars Universums.
Solo: A Star Wars Story nudelt die bekannten Themen der Serie routiniert rauf und runter und backt altbekannte Charaktere und Scenen neu auf: Ja, ich hab jetzt verstanden, daß sich in Weltraumkneipen zwielichtige Aliens tummeln. Genug davon!!! Gerade bei den Charakteren der Spin Offs aber läßt sich auch allmählich der Zerfall und die Zerfaserung des Franchises abzeichnen. Es waren ja neben den innovativen Spezialeffekten eben gerade die handvoll gutgelaunt aufspielenden Weltraumhassadeure, die den Kult um die Weltraumsaga begründeten. Diese sind nun aber entweder von ihrer eigenen Brut ins Jedinirvana geschleudert worden oder rotten kreuz und quer über die Galaxie verteilt vor sich hin.
Die charakterliche Ausdünnung ist wohl auch für den finanziellen Mißerfolg des Filmes verantwortlich, denn, ehrlich gesagt, wen interessiert es heute denn überhaupt noch, wann und wo eine Hosentaschenausgabe von Han Solo, ein Ersatz Chewbacca und Reserve Lando ihr erstes Rondevouz hatten?
Die Rahmenhandlung indess ist ebenso überraschend und innovativ wie ein neues Stones Album und läßt sich am ehesten mit einem ausgetretenem Patchworkteppich x-mal gesehener Versatzstücke vergleichen. Ungeniert berichten die beiden ursprünglichen Regisseure Phil Lord und Christopher Miller auch gerne, bei welchen literarischen Vorbildern sie 3 Jahre lang völlig ungeniert alles abgekupfert haben.
Trotz der bemitleidenswürdigen Ideenarmut ist die Weltraumoperette dennoch recht kurzweilig gelungen und vermag dem actionaffinen Zuschauer einige prickelnde Schauwerte zu bescheren. Diese sind allerdings CGI typisch technisch-kalt-überästhetisc h-perfekt geraten und entfalten nicht dieselbe nervenzerrende Wirkung wie eine gute alte handgemachte Stuntkunsteinlage. Besondere Erwähnung verdient hier vor allen Dingen die Heistscene im Schneeexpress und die Jagd durch den von Monstern verseuchten intergalaktischem Malmstrom, bei der temporär trotz Videospielästhetik sogar mal richtig Laune aufkommt.
Alles in allem entfaltet SOLO: A Star Wars Story den Zuschauer trotz einiger packender Momente aber nicht den Sog, der nötig gewesen wäre, den Zuschauer in das Geschehen hineinzuziehen und an die Handlung zu fesseln. Zu schablonenhaft ist eben die Handlung und zu uncharismatisch sind die Protagonisten.
40 Jahre nach dem Start des ersten Teiles schwebt eben noch immer die schwere Last der Originaltrilogie über den Fortsetzungen und lähmt mit seinem übergroßem, epochemachenden Kultstatus, eine von allem Altballast befreite Neuorientierung der Erzählung. So sehr es den Nerd freuen mag, mit den Helden seiner Kindheit erneut im Fighting Falcon durch die Galaxien zu kreuzen, so sehr unterdrückt auch das das Festhalten am Erbe Lucas die Möglichkeiten einer Weiterentwicklung der Geschichte.
Will man nicht im eigenen Mief ersticken, ist eine Emanzipation von den Altvorderen der Saga aber unumgänglich. Zwar kann die Kuh wohl noch etwas gemolken werden, im Grunde ist die Mär um Prinzessin Leia aber auserzählt und wird nur noch künstlich am Leben erhalten, um den harten Kern der Fangemeinde nicht zu verprellen. Will man in die Zukunft gehen, ist eine Frischzellenkur jedoch unerläßlich.
Was dem Film indess auf der handwerklichen Seite schweren Schaden zufügt, ist die Ambivalenz zwischen dem gewollt heiteren Grundtenor des Protagonisten und dem düsteren Look des Filmes, in dem fast ganze Sets in der Dunkelheit verschwinden. Es ist müßig, darüber zu spekulieren, ob der Regiesseurwechsel für den Spagat verantwortlich ist oder nicht. Fakt aber ist, daß die ursprüngliche Crew einen deutlich ernsteren Ableger im Auge hatte und Ron Howard schließlich für die leichte Muse angeheuert wurde. So oder so, welche Philosophie hier auch verfolgt wurde, die Symbiose funktioniert nur Ansatzweise. Einen eigenständigen, selbstbewußten Esprit sucht man hier vergebens. So wird man den Charme der alten Filme, trotz technischer Hochrüstung, wohl nie wieder erreichen.
Den größten Schnitzer erlaubt sich Disney bei der Bluray-Disc Veröffentlichung jedoch bei der technischen Umsetzung. Speziell die Bildqualität ist ein Ärgernis der gehobenen Kategorie. Sind die dunklen Scenen nur ein wenig verwaschen, kann man in der 3D Konvertierung schon von einer glatten Frechheit, bzw Betrug am Kunden sprechen. "Wenn ihr unseren Film schon nicht zu würdigen wißt (das Box Office war katastrophal), dann habt ihr undankbaren Proleten auch kein besseres Bild verdient", mögen sich die Produzenten bei der Veröffentlichung der Scheibe wohl hämisch mit gekreuzten Fingern hinterm Rücken zugeraunt haben.
Wie dem auch sei: Das 3D Bild strotzt nur so vor lauter stereoskopischen Doppelkonturen, so daß eine permanente, störende Tiefenschärfenachregelung während des Filmbetriebes unabläßlich ist, will man nach überstandener Tortur nicht mit einem Silberblick in die Federn gleiten.
Ich unterstelle Disney hier grobe Fahrläßigkeit, da sich auch Rogue One in der 3D Version schon auf Discounterniveau befunden hat.
Ready Player One setzt hier ganz andere Maßstäbe. Siehe dort!
mit 3
mit 3
mit 4
mit 3
bewertet am 11.10.18 um 22:23
Kathryn Bygelows adrenalingetränkte Verfilmung einer Gruppe Außenseiter, die im grenzüberschreitenden Lebensstil nach der ultimativen Freiheit sucht, braucht um seine Kultstatus nicht zu fürchten: Der Nachfolger kratzt nicht ansatzweise am Lack der 90er Jahre Ikone!
Während die 91er Verfilmung mit Patrick Swayze und Keanu Reeves noch immer Athmosphäre, Vitalität und Esprit versprüht und von einem glaubwürdigem Hauch Spiritualität umweht ist, versagt die Neuverfilmung in allen genannten Disziplinen auf voller Länge.
Statt fesselnden Dialogen, die ein Mindestmaß an Kenntnis der buddhistischen Lehre erkennen laßen und einen unbändigen Freiheitsdrang verströmen, wird nun versucht, mit den peinlichsten Plattitüden aus Luis Trenkers Memoiren zu punkten. Hier wird nicht mit fundamentalen philosophischen Betrachtungen operiert, sondern auf plumpe Allgemeinplätze der dümmlichsten Kategorie gesetzt, die nur in einem sauerstoffuntersättigten Xtremsportlergehirn jenseits der Todszone entstanden sein können und von den Schauspielern mit keinerlei Authentizität vorgetragen werden. Die hohlen Phrasen der Schauspielern scheinen ihnen fremdkörperartig wie Hasenköttel aus den Mund zu plumpsen.
Abgesehen von mangelnder philosophischer Substanz, spielt auch die Rahmenhandlung bestenfalls in der 6. Amateurliga. Das Katz und Mausspiel zwischen dem Ex-Motorradextremsportler Utah und dem Anführer der Abenteurerrasselbande, Bodhi, ist so spannungsarm aufs unerfreulichste miteinander verquickt, daß man sich ernsthaft Sorgen um die intellektuellen Defizite der Filmschaffenden machen muß. Selten wurde in einem Film so offensichtlich auf eine substanzielle Unterfütterung der Bilder verzichtet wie in diesem Fall. Unlogische Zeitsprünge sind hier ebenso herzlich Willkommen wie die stümperhaft inszenierte Dynamik zwischen Utah und seinem Vorgesetzten, die den mitdenkenden Zuschauer vor unüberwindbare intellektuelle Hürden stellt. Auf Paralellen zur Realität wurde hier scheinbar bewußt verzichtet!
Kommen wir nun aber zum eigentlichem Sinn und Zweck des ganzen Spektakels, den Actionscenen: Ob im Schnee, in der Luft, am Berg, auf dem Motorrad oder im und auf dem Wasser, hier haben sich wohl einige der besten Extremsportler der ganzen Welt versammelt, um sich im prächtigem 3D in die Elemente zu werfen. So kann man alle Actionscenen als geglückt betrachten, auch wenn viele davon dem regelmäßigem n-tv Zuschauer mittlerweile schon wie kalter Kaffe vorkommen müßen. Besonders heraus sticht hier dennoch die (aber extrem lächerliche) Freeclimbverfolgungsjagd an Venezuelas 1.000m hohen Angel Falls. Die ist in 3D wirklich atemberaubend und sehenswert. Allerdings wurde auch hier reichlich CGI verwendet, so daß sich der Nervenkitzel in Grenzen hält. Der finale Wellenritt ist denn wohl trotz einigen optischen Reizen auch eine reine Computergeburt.
Jemand der das Original nicht kennt, mag sich meinetwegen an den Actionclips erfreuen. Mich hat der Raubbau am Vorgänger und dessen psychologische Entkernung jedoch eher abgestoßen, denn unterhalten, zumahl im direkten Vergleich, das Original, Gefährliche Brandung, selbst heute noch etwas verströmt, worin es Point Break in allen Belangen mangelt: Charisma!
So aber hatten Ericson Core und seine Taurinbrauseabusus betreibenden lebensmüden Freunde wenigstens eine schöne gemeinsame Zeit. Ist doch auch was...
Während die 91er Verfilmung mit Patrick Swayze und Keanu Reeves noch immer Athmosphäre, Vitalität und Esprit versprüht und von einem glaubwürdigem Hauch Spiritualität umweht ist, versagt die Neuverfilmung in allen genannten Disziplinen auf voller Länge.
Statt fesselnden Dialogen, die ein Mindestmaß an Kenntnis der buddhistischen Lehre erkennen laßen und einen unbändigen Freiheitsdrang verströmen, wird nun versucht, mit den peinlichsten Plattitüden aus Luis Trenkers Memoiren zu punkten. Hier wird nicht mit fundamentalen philosophischen Betrachtungen operiert, sondern auf plumpe Allgemeinplätze der dümmlichsten Kategorie gesetzt, die nur in einem sauerstoffuntersättigten Xtremsportlergehirn jenseits der Todszone entstanden sein können und von den Schauspielern mit keinerlei Authentizität vorgetragen werden. Die hohlen Phrasen der Schauspielern scheinen ihnen fremdkörperartig wie Hasenköttel aus den Mund zu plumpsen.
Abgesehen von mangelnder philosophischer Substanz, spielt auch die Rahmenhandlung bestenfalls in der 6. Amateurliga. Das Katz und Mausspiel zwischen dem Ex-Motorradextremsportler Utah und dem Anführer der Abenteurerrasselbande, Bodhi, ist so spannungsarm aufs unerfreulichste miteinander verquickt, daß man sich ernsthaft Sorgen um die intellektuellen Defizite der Filmschaffenden machen muß. Selten wurde in einem Film so offensichtlich auf eine substanzielle Unterfütterung der Bilder verzichtet wie in diesem Fall. Unlogische Zeitsprünge sind hier ebenso herzlich Willkommen wie die stümperhaft inszenierte Dynamik zwischen Utah und seinem Vorgesetzten, die den mitdenkenden Zuschauer vor unüberwindbare intellektuelle Hürden stellt. Auf Paralellen zur Realität wurde hier scheinbar bewußt verzichtet!
Kommen wir nun aber zum eigentlichem Sinn und Zweck des ganzen Spektakels, den Actionscenen: Ob im Schnee, in der Luft, am Berg, auf dem Motorrad oder im und auf dem Wasser, hier haben sich wohl einige der besten Extremsportler der ganzen Welt versammelt, um sich im prächtigem 3D in die Elemente zu werfen. So kann man alle Actionscenen als geglückt betrachten, auch wenn viele davon dem regelmäßigem n-tv Zuschauer mittlerweile schon wie kalter Kaffe vorkommen müßen. Besonders heraus sticht hier dennoch die (aber extrem lächerliche) Freeclimbverfolgungsjagd an Venezuelas 1.000m hohen Angel Falls. Die ist in 3D wirklich atemberaubend und sehenswert. Allerdings wurde auch hier reichlich CGI verwendet, so daß sich der Nervenkitzel in Grenzen hält. Der finale Wellenritt ist denn wohl trotz einigen optischen Reizen auch eine reine Computergeburt.
Jemand der das Original nicht kennt, mag sich meinetwegen an den Actionclips erfreuen. Mich hat der Raubbau am Vorgänger und dessen psychologische Entkernung jedoch eher abgestoßen, denn unterhalten, zumahl im direkten Vergleich, das Original, Gefährliche Brandung, selbst heute noch etwas verströmt, worin es Point Break in allen Belangen mangelt: Charisma!
So aber hatten Ericson Core und seine Taurinbrauseabusus betreibenden lebensmüden Freunde wenigstens eine schöne gemeinsame Zeit. Ist doch auch was...
mit 2
mit 5
mit 4
mit 2
bewertet am 10.10.18 um 11:46
Ready Player One ist an sich keine Geschichte, sondern eine Hommage an die Popkultur insgesamt und an die 80er insbesondere.
Wir schreiben das Jahr 2045. Die virtuellen Welt ist der einzige Weg einer dystopischen Zukunft zu entkommen. Der Erschaffer dieses Paralelluniversums, ein mit allen Klischees behafteter Bilderbuchnerd hat in seiner digitalen Welt drei Schlüßel versteckt, die dem Besitzer die Kontrolle über seinen bunte Phantasiereigen verleiht.
Eine handvoll Teenies liefern sich auf der Jagd nach dem Schatz ein bitteres Rennen mit einem skrupellosem Industriellen, der das Pixelparadies kommerziell ausschlachten und für mediale Manipulation ausnutzen will...
Ich möchte die Handlung garnicht groß vertiefen, da sie weder besonders raffiniert, mit intellektueller Substanz gesegnet, bzw. spannend ist. Soger ein spiritueller Überbau wird hier anscheinend als störend empfunden.
Sie folgt vielmehr dem üblichem Videospielmuster, in dem sich der Protagonist durch immer schwierigere Levels kämpfen muß, um im schweißtreibenden Sieg gegen einen Endgegner einen kurzen Moment der Erlösung genießen zu dürfen..
Der Mangel an Innovation wird allerdings durch ein Übermaß an visuellen Schauwerten wieder mehr als wettgemacht. Das Schaulaufen unzähliger Film- und Videospielikonen, die sich in bombastischen Materialschlachten titanische Kämpfe liefern, befinden sich auf technisch höchstem Niveau und erstrahlen in astraler 3D Bearbeitung, erzeugen somit also einen Unterhaltungswert, der kaum zu toppen ist.
Erzählerisch kann sich Ready Player One wie bereits gesagt nicht von der erzählerischen Blutarmut der Superheldenfilme distanzieren. Aber ehrlich: wer will sich beim Tänzchen von Godzillas Schergen, King Kong und Konsorten schon von platonischer Klugscheißerei und Pseudophilosophie und -gesellschaftskritik den wohlverdienten Videoabend vergallen lassen?
Das Deja Vu und kaleidoscopeartige, anarchische durcheinanderwirbeln und zusammenfügen des Hu is Hu der Popkultur entschädigt für die simple, kindgerechte Handlung auf aufgebohrtem drei ??? Niveau, ist somit ein Vergnügen der gehobenen Sorte und verlockt zum wiederholten eintauchen in das exzentrische Schlachtengetümmel ein.
Alle Referenzen an die Trivialikonen zu entschlüßeln, dauert sicherlich Äonen und liefert Stoff unzählige Magisterarbeiten der Herren Kulturwissenschaftler.
Für den Ottonormalschauer ist es aber einfach eine Reise in seine eigene cineastische Vergangenheit, bzw. eine Geburtstagsfeier mit seinem eigener Mediensammlung.
Und nochmals: Das 3D Bild gehört zur absoluten Referenz, dessen was ich bisher genießen durfte. Mit gelegentlichen Abstrichen ist das Bild durchgehend gleichzeitig im Vorder- sowie im Hintergrund knackescharf. Das ist eine absolute Rarität und erlaubt dem Auge entspannt durch die digitalen Weiten zu schweifen.
Wenn man sieht, was mit einer gewißen Akribie und Liebe zum Medium möglich ist, sollten solche optischen (3D) Beleidigungen wie SOLO: A Star Wars Story 3D eigentlich verschrottet, im Erdkern eingeschmolzen und von einem Sternenzerstörer in einem Gammastrahlenblitz in seine zuckende Minuskeln zerlegt werden.
Wir schreiben das Jahr 2045. Die virtuellen Welt ist der einzige Weg einer dystopischen Zukunft zu entkommen. Der Erschaffer dieses Paralelluniversums, ein mit allen Klischees behafteter Bilderbuchnerd hat in seiner digitalen Welt drei Schlüßel versteckt, die dem Besitzer die Kontrolle über seinen bunte Phantasiereigen verleiht.
Eine handvoll Teenies liefern sich auf der Jagd nach dem Schatz ein bitteres Rennen mit einem skrupellosem Industriellen, der das Pixelparadies kommerziell ausschlachten und für mediale Manipulation ausnutzen will...
Ich möchte die Handlung garnicht groß vertiefen, da sie weder besonders raffiniert, mit intellektueller Substanz gesegnet, bzw. spannend ist. Soger ein spiritueller Überbau wird hier anscheinend als störend empfunden.
Sie folgt vielmehr dem üblichem Videospielmuster, in dem sich der Protagonist durch immer schwierigere Levels kämpfen muß, um im schweißtreibenden Sieg gegen einen Endgegner einen kurzen Moment der Erlösung genießen zu dürfen..
Der Mangel an Innovation wird allerdings durch ein Übermaß an visuellen Schauwerten wieder mehr als wettgemacht. Das Schaulaufen unzähliger Film- und Videospielikonen, die sich in bombastischen Materialschlachten titanische Kämpfe liefern, befinden sich auf technisch höchstem Niveau und erstrahlen in astraler 3D Bearbeitung, erzeugen somit also einen Unterhaltungswert, der kaum zu toppen ist.
Erzählerisch kann sich Ready Player One wie bereits gesagt nicht von der erzählerischen Blutarmut der Superheldenfilme distanzieren. Aber ehrlich: wer will sich beim Tänzchen von Godzillas Schergen, King Kong und Konsorten schon von platonischer Klugscheißerei und Pseudophilosophie und -gesellschaftskritik den wohlverdienten Videoabend vergallen lassen?
Das Deja Vu und kaleidoscopeartige, anarchische durcheinanderwirbeln und zusammenfügen des Hu is Hu der Popkultur entschädigt für die simple, kindgerechte Handlung auf aufgebohrtem drei ??? Niveau, ist somit ein Vergnügen der gehobenen Sorte und verlockt zum wiederholten eintauchen in das exzentrische Schlachtengetümmel ein.
Alle Referenzen an die Trivialikonen zu entschlüßeln, dauert sicherlich Äonen und liefert Stoff unzählige Magisterarbeiten der Herren Kulturwissenschaftler.
Für den Ottonormalschauer ist es aber einfach eine Reise in seine eigene cineastische Vergangenheit, bzw. eine Geburtstagsfeier mit seinem eigener Mediensammlung.
Und nochmals: Das 3D Bild gehört zur absoluten Referenz, dessen was ich bisher genießen durfte. Mit gelegentlichen Abstrichen ist das Bild durchgehend gleichzeitig im Vorder- sowie im Hintergrund knackescharf. Das ist eine absolute Rarität und erlaubt dem Auge entspannt durch die digitalen Weiten zu schweifen.
Wenn man sieht, was mit einer gewißen Akribie und Liebe zum Medium möglich ist, sollten solche optischen (3D) Beleidigungen wie SOLO: A Star Wars Story 3D eigentlich verschrottet, im Erdkern eingeschmolzen und von einem Sternenzerstörer in einem Gammastrahlenblitz in seine zuckende Minuskeln zerlegt werden.
mit 4
mit 5
mit 5
mit 0
bewertet am 04.10.18 um 20:54
Ein Film der nachhaltig begeistert!
Und ich kann mich immer noch nicht entscheiden, ob mich das Overacting des Pickelkönigs oder das Underacting der Paul Brüder mehr in seinen Bann geschlagen hat.
1987 habe ich den Film verpasst. Das lag wahrscheinlich daran, daß ich mich damals eher für gute Filme interessierte. Mein Faible für Trash entwickelte sich also im Lauf der Jahrzehnte eher retrospektiv. Aber das war auch gut so. Man muß schon bis zum erbrechen Filme konsumiert haben, um Sensoren dafür zu entwickeln, was ganz OK, was superb, was grottenschlecht und was geniale Grütze ist.
"Die Barbaren" ist geniale Grütze doppelgold hoch zwei!
Im Erscheinungsjahr wären die Vorzüge von "Die Barbaren" meinen unausgereiften Geschmacksfühlern wohl noch durch seine Lappen gerutscht. "Eine billige Kopie des ambitionierten Conan-der Barbar mit seinen epischen Anwandlungen", hätte ich wohl damals hochnäsig gerümpft.
Heute kann ich ihn unvoreingenommen mit dem geschulten Blick eines Videogeschädigten betrachten und muß sagen, ich amüsiere mich hier köstlicher, als bei manch einer überproduzierten 200 Millionen Dollar CGI Schlacht. Die Naivität der Geschichte und der kindliche Spaß, mit dem dieses filmähnliche Fantasymärchen vorgetragen wird, kann in keinem Quantencomputer der Welt künstlich generiert werden. Das ich mir bei soviel geballten Stuß sogar den Kopf aus dem Atlasgelenk beim verschähmten weggucken ausgerengt habe, adelt mich beinahe, denn: mit welch größerem Kompliment könnte ich den Film sonst überschütten?
Regisseur Ruggero Deodato (Nackt und zerfleischt) scheint dabei die endgültige Weltenformel für Edeltrash gefunden zu haben: Beim Drehbuchschreiben das Gehirn ausschalten, Schauspieler engagieren, die an der Aufnahmeprüfung zur Komparsenschule gescheitert sind, in den unpassendsten Momenten Titten und billige Splatterelemente platzieren und dann mal, ohne sich allzuviel komplizierte Gedanken über die Handlung zu machen, fröhlich mit einer Kamera unterm Arm zur Tat schreiten und den Dingen, die da kommen mögen, frisch und frei seinen Lauf lassen.
Das Element, das sich dabei durch den ganzen Film zieht und den Zuschauer in angenehme Verzückung versetzt, ist seine heitere Unbekümmertheit, mit der alle Beteiligten ihr beschähmendes Werk vollbringen. Ob Deodato dabei nicht in der Lage war, einen packenden Fantasyfilm zu drehen, sei dahingestellt. Fest steht jedenfalls, daß die Scenen sich so locker aneinanderreihen, wie die Sproßen einer Strickleiter, also nur vage etwas miteinander zu tun haben. So wird zwar etwas wie eine "Geschichte" vorangetrieben, Spannung, Thrill, Romantik oder Abenteuerstimmung werden hier aber großmeisterlich gekonnt umschifft. Kopfschüttelnd läßt man "Die Barbaren" so an sich vorüberziehen und bewundert mit ungläubig staunenden, weitaufgerissenen und verdatterten Glubschaugen den Mut der Filmgilde, dem Zuschauer diese Melange aus cineastischen Diletantismus und zweitklassiker Kirmesdeko zuzumuten.
Ich war ja immer der Meinung, die Qualität einer Geschichte läßt sich bereits an den erfundenen Namen ableiten. "Die Barbaren" bestätigen meine Hypothese punktgenau. Denn es ist der Stamm der "RAGNICKS", aus dem die Paulbrüder von dem Bösewicht "KADAR" aus ihrem sozialem Gefüge gerißen und in Gefangenschaft geknechtet werden. Die Ragnicks sind ein fahrendes Volk von Gauklern und Artisten und gleichen einer munteren Zirkustruppe, die vergessen hat, sich nach der Show abzuschminken.
Conan ähnlich ackern die beiden Zwillinge Kutchek und Gore bis zur Pubertät, bis ihre Muskeln pathologisch hypertrophiert sind und sie in der Arena aufeinandergehetzt werden. Man erkennt sich im Kampf wieder und geht fortan gemeinsam auf die Suche nach einem roten Rubin, der einst das Heiligtum der Ragnicks gewesen ist und dem Besitzer ewigwährenden Friede, Freude und natürlich auch Eierkuchen satt verspricht. Dabei muß ein Drachen getötet, der Bösewicht bekämpft, die Mutter der Kompanie befreit, der Körper eingeölt und eine Prinzessin gefunden werden. Der Storyverlauf folgt dabei selbstverständlich stringent und unnachgiebig den unerbittlichen Gesetzen des Zufalls.
Das Vergnügen, welches "Die Barbaren" vermittelt läßt sich aber nicht nur auf den holprigen Storyverlauf und den grottigen Dialogen, die ständig mit den "Schauspielern" um die schlechteste Darbietung wetteifern zurückführen, nein, sogar der Humor, der das Markenzeichen des Filmes sein sollte, ist funktioniert nicht mal ordentlich. Grunzwitze und ein mißlungener Running Gag müßen hier leider intelligenten Pointen weichen.
Der Film hat aber auch seine kleinen Vorzüge, die nicht verhelt werden sollen. Dazu zählen einmal die Kulissen, die zwar den Charme einer DDR Version von Indiana Jones verströmen, aber dennoch, kunterbunt grün, rot und blau ausgeleuchtet, eine annehmbare Athmosphäre erzeugen. Die Beleuchtung ist dabei selbstverständlich ebenso Bad Taste 80s wie die Filmmusik. Synthipophymnen in der Steinzeit. Das hat was. Dabei hämmert der Elektrobeat so unerbittlich, wie ein Alleinunterhalter, der eine müde Goldhochzeitschar nach dem fünften Gang Erdbeersahnetorte wieder auf die Tanzfläche treiben möchte.
Der einzige Könner seines Faches aber ist, und das meine ich ernst, der Kameramann. Gianlorenzo Battaglia überzeugt mit der einen oder anderen Kameraeinstellung, der man guten Gewissens das Ettikett Kunst verleihen kann. Er vermag es tatsächlich, aus den Pappkulissen, der misratenen Ausleuchtung und den Handlungsfragmenten mit seinem geschicktem Kameraspiel, eine visuelle Ästhetik zu konstruieren, die dem Auge angenehm schmeichelt.
Es ist diese Mischung aus ambitioniertem Handwerk auf der einen, und Totalversagen auf der intellektuellen Seite, der diese unterhaltsame Spannung erzeugt, der der Trashfilmfan verfallen ist.
Und mal ehrlich: Die Technomusik, die Lightshow in den Spektralfarben, Pappmacheeungeheuer mit grobmechanischen Eingeweiden, eingeölte Bodybuilder auf Anabolika, halbnackte Frauen und wilde Freaks, die sich aufführen wie eine entfesselte Urzeithorde: Sind das nicht auch die gleichen Zutaten, die das Burning Man Festival so populär gemacht haben....? So gesehen, war "Die Barbaren" seiner Zeit wohl bloß einfach 20 Jahre voraus...
Jetzt zu behaupten, Ruggero Deodato wäre ein visionärer Regisseur gewesen, geht mir dann allerdings doch ein paar Meilen zu weit...
Bild und Ton sind OK. Die Bluray startet allerdings nicht so ohne Weiteres...werde sie wohl umtauschen...
Und ich kann mich immer noch nicht entscheiden, ob mich das Overacting des Pickelkönigs oder das Underacting der Paul Brüder mehr in seinen Bann geschlagen hat.
1987 habe ich den Film verpasst. Das lag wahrscheinlich daran, daß ich mich damals eher für gute Filme interessierte. Mein Faible für Trash entwickelte sich also im Lauf der Jahrzehnte eher retrospektiv. Aber das war auch gut so. Man muß schon bis zum erbrechen Filme konsumiert haben, um Sensoren dafür zu entwickeln, was ganz OK, was superb, was grottenschlecht und was geniale Grütze ist.
"Die Barbaren" ist geniale Grütze doppelgold hoch zwei!
Im Erscheinungsjahr wären die Vorzüge von "Die Barbaren" meinen unausgereiften Geschmacksfühlern wohl noch durch seine Lappen gerutscht. "Eine billige Kopie des ambitionierten Conan-der Barbar mit seinen epischen Anwandlungen", hätte ich wohl damals hochnäsig gerümpft.
Heute kann ich ihn unvoreingenommen mit dem geschulten Blick eines Videogeschädigten betrachten und muß sagen, ich amüsiere mich hier köstlicher, als bei manch einer überproduzierten 200 Millionen Dollar CGI Schlacht. Die Naivität der Geschichte und der kindliche Spaß, mit dem dieses filmähnliche Fantasymärchen vorgetragen wird, kann in keinem Quantencomputer der Welt künstlich generiert werden. Das ich mir bei soviel geballten Stuß sogar den Kopf aus dem Atlasgelenk beim verschähmten weggucken ausgerengt habe, adelt mich beinahe, denn: mit welch größerem Kompliment könnte ich den Film sonst überschütten?
Regisseur Ruggero Deodato (Nackt und zerfleischt) scheint dabei die endgültige Weltenformel für Edeltrash gefunden zu haben: Beim Drehbuchschreiben das Gehirn ausschalten, Schauspieler engagieren, die an der Aufnahmeprüfung zur Komparsenschule gescheitert sind, in den unpassendsten Momenten Titten und billige Splatterelemente platzieren und dann mal, ohne sich allzuviel komplizierte Gedanken über die Handlung zu machen, fröhlich mit einer Kamera unterm Arm zur Tat schreiten und den Dingen, die da kommen mögen, frisch und frei seinen Lauf lassen.
Das Element, das sich dabei durch den ganzen Film zieht und den Zuschauer in angenehme Verzückung versetzt, ist seine heitere Unbekümmertheit, mit der alle Beteiligten ihr beschähmendes Werk vollbringen. Ob Deodato dabei nicht in der Lage war, einen packenden Fantasyfilm zu drehen, sei dahingestellt. Fest steht jedenfalls, daß die Scenen sich so locker aneinanderreihen, wie die Sproßen einer Strickleiter, also nur vage etwas miteinander zu tun haben. So wird zwar etwas wie eine "Geschichte" vorangetrieben, Spannung, Thrill, Romantik oder Abenteuerstimmung werden hier aber großmeisterlich gekonnt umschifft. Kopfschüttelnd läßt man "Die Barbaren" so an sich vorüberziehen und bewundert mit ungläubig staunenden, weitaufgerissenen und verdatterten Glubschaugen den Mut der Filmgilde, dem Zuschauer diese Melange aus cineastischen Diletantismus und zweitklassiker Kirmesdeko zuzumuten.
Ich war ja immer der Meinung, die Qualität einer Geschichte läßt sich bereits an den erfundenen Namen ableiten. "Die Barbaren" bestätigen meine Hypothese punktgenau. Denn es ist der Stamm der "RAGNICKS", aus dem die Paulbrüder von dem Bösewicht "KADAR" aus ihrem sozialem Gefüge gerißen und in Gefangenschaft geknechtet werden. Die Ragnicks sind ein fahrendes Volk von Gauklern und Artisten und gleichen einer munteren Zirkustruppe, die vergessen hat, sich nach der Show abzuschminken.
Conan ähnlich ackern die beiden Zwillinge Kutchek und Gore bis zur Pubertät, bis ihre Muskeln pathologisch hypertrophiert sind und sie in der Arena aufeinandergehetzt werden. Man erkennt sich im Kampf wieder und geht fortan gemeinsam auf die Suche nach einem roten Rubin, der einst das Heiligtum der Ragnicks gewesen ist und dem Besitzer ewigwährenden Friede, Freude und natürlich auch Eierkuchen satt verspricht. Dabei muß ein Drachen getötet, der Bösewicht bekämpft, die Mutter der Kompanie befreit, der Körper eingeölt und eine Prinzessin gefunden werden. Der Storyverlauf folgt dabei selbstverständlich stringent und unnachgiebig den unerbittlichen Gesetzen des Zufalls.
Das Vergnügen, welches "Die Barbaren" vermittelt läßt sich aber nicht nur auf den holprigen Storyverlauf und den grottigen Dialogen, die ständig mit den "Schauspielern" um die schlechteste Darbietung wetteifern zurückführen, nein, sogar der Humor, der das Markenzeichen des Filmes sein sollte, ist funktioniert nicht mal ordentlich. Grunzwitze und ein mißlungener Running Gag müßen hier leider intelligenten Pointen weichen.
Der Film hat aber auch seine kleinen Vorzüge, die nicht verhelt werden sollen. Dazu zählen einmal die Kulissen, die zwar den Charme einer DDR Version von Indiana Jones verströmen, aber dennoch, kunterbunt grün, rot und blau ausgeleuchtet, eine annehmbare Athmosphäre erzeugen. Die Beleuchtung ist dabei selbstverständlich ebenso Bad Taste 80s wie die Filmmusik. Synthipophymnen in der Steinzeit. Das hat was. Dabei hämmert der Elektrobeat so unerbittlich, wie ein Alleinunterhalter, der eine müde Goldhochzeitschar nach dem fünften Gang Erdbeersahnetorte wieder auf die Tanzfläche treiben möchte.
Der einzige Könner seines Faches aber ist, und das meine ich ernst, der Kameramann. Gianlorenzo Battaglia überzeugt mit der einen oder anderen Kameraeinstellung, der man guten Gewissens das Ettikett Kunst verleihen kann. Er vermag es tatsächlich, aus den Pappkulissen, der misratenen Ausleuchtung und den Handlungsfragmenten mit seinem geschicktem Kameraspiel, eine visuelle Ästhetik zu konstruieren, die dem Auge angenehm schmeichelt.
Es ist diese Mischung aus ambitioniertem Handwerk auf der einen, und Totalversagen auf der intellektuellen Seite, der diese unterhaltsame Spannung erzeugt, der der Trashfilmfan verfallen ist.
Und mal ehrlich: Die Technomusik, die Lightshow in den Spektralfarben, Pappmacheeungeheuer mit grobmechanischen Eingeweiden, eingeölte Bodybuilder auf Anabolika, halbnackte Frauen und wilde Freaks, die sich aufführen wie eine entfesselte Urzeithorde: Sind das nicht auch die gleichen Zutaten, die das Burning Man Festival so populär gemacht haben....? So gesehen, war "Die Barbaren" seiner Zeit wohl bloß einfach 20 Jahre voraus...
Jetzt zu behaupten, Ruggero Deodato wäre ein visionärer Regisseur gewesen, geht mir dann allerdings doch ein paar Meilen zu weit...
Bild und Ton sind OK. Die Bluray startet allerdings nicht so ohne Weiteres...werde sie wohl umtauschen...
mit 4
mit 3
mit 3
mit 3
bewertet am 18.06.18 um 14:03
Einer der allerbesten Filme aller Zeiten in einer würdigen Veröffentlichung.
Nach dem Oscargewinn für "Die durch die Hölle gehen" erhielt Regisseur Michael Cimino grünes Licht für ein Westernepos, das alle bekannten Maßstäbe für Ästhetik und und Detailverliebtheit sprengte. Das ursprüngliche Etat von 7,5 Millionen wurde durch den immens betriebenen Aufwand an Kulissen und Ausstattung binnen kürzester Zeit auf 40 Millionen Dollar geschraubt. Nachdem die Studiobosse aber die ersten Testvorführungen gesichtet hatten, wußte man, daß mit dem Geld kein Schindluder getrieben, sondern einem imposanten Spätwestern von außerordentlicher Schönheit der Weg ins Leben geebnet wurde - und lehnte sich entspannt zurück.... Eine Geste allerdings, die man schon bald bitter bereuen sollte...
In elegischen, weitschweifigen und bis ins letzte Detail durchkomponierten Bildern wird ein dunkles Kapitel aus den verborgenen Winkeln des amerikanischen Gedächtnisses ans Licht der Leinwände gezerrt: Der Johnston County War. Europäische Siedler, die den beschwerlichen Weg aus ihrer alten Heimat in die neue Welt auf sich genommen haben, machten sich auf den mühsamen Weg in den gelobten Westen der noch jungen USA. Ausgemergelt und mittellos blieb ihnen auf dem Weg ins vermeintliche Glück oftmals nichts anderes übrig, als sich gelegentlich ein Stück Vieh aus dem unzähligen Bestand der Rinderbarone zu schlachten. Es ging dabei ja schließlich um nichts weniger als das nackte Überleben.
Die Herdenbesitzer haben sich indes zu einem Interessenverbund zusammengeschmiedet und beschloßen, skrupellos gegen die Viehdiebe vorzugehen: Eine verwegene Meute von 50 Kopfgeldjäger wird rekrutiert und jedem eine Abschußprämie garantiert, der einen Einwanderer aus einer "Todesliste" von 125 Namen eliminiert. Das sie bei dieser Menschenhatz die Rückendeckung des Gouverneurs von Montana und des amerikanischen Präsidenten hatten, wirft einen blutroten Schatten auf die verklärte Ethik der Gründungsväter der vereinigten Staaten.
Die Ammenmär des von edler Moral durchtränkten Westernhelden ala John Wayne, James Stewart oder Gregory Peck wird hier mittels historischer Fakten der Geschichtsverklitterung überführt.
Das Fundament der amerikanischen Gesellschafft beruht eben nicht auf Altruismus und nobler Gottesgefälligkeit, wie es die Gründungsmythen künden, sondern stand schon von Beginn an im Zeichen von Profitgier und dem Sozialdarwinismus im Geiste des Überleben des Stärkeren.
In der Tatsache, daß der selbstgefälligen amerikanischen Volkseele der Spiegel vorgehalten und am Lack der auf Lügen basierenden Legendenbildung durch die Hollywoodproduktionen gekratzt wurde, ist auch das finanzielle Fiasko zu erklären, welches Heavens Gate zu seiner Zeit, der beginnenden Reagen Ära mit seinem Neopatriotismus, beschieden war. Die Zeit des amerikanischen Selbsthasses der Postvietnamära war endgültig abgelaufen und man sehnte sich nach Neuem. Die Kritiker der ersten Vorstellungen zerrissen demnach den Film in der Luft. Ein antipatriotischer Film entsprach über Nacht nicht mehr dem Zeitgeist Amerikas. Selbst der Reporter der renomierten New York Times vermochte nicht die emotionale Schmach der Realität zu ertragen und die über Jahrzehnte eingebleute Grossmannsillusion, ein direkter Nachkomme hochheiliger Pilgerväter zu sein, angewiedert abzuschütteln. So äußerste er sich dementsprechend auch grob abfällig über das Werk. Ob folgende Kritiker danach nicht mehr Willens oder in der Lage waren, ihrer Koriphäre zu widersprechen und sich damit womöglich fachlich zu disqualifizieren, sei dahingestellt und bleibt Spekulation. Tasache aber ist, daß sie ins gleiche Horn bliesen. Die vernichtenden Kritiken entwickelten so eine sich selbstverstärkende Eigendynamik, die den Film schlußendlich in den Abgrund stürzte.
Aus heutiger Sicht unfaßbar, wurde Heavens Gate für 5 goldene Himbeeren nominiert. U.a. für den schlechtesten Schauspieler, den schlechtesten Film und die schlechteste Regie. In letztgenannter Kategorie wurde er beschämender Weise sogar prämiert. Man jaulte lieber mit den Wölfen, als dem eigenen Empfinden für wahre Größe zu folgen.
Aber Qualität läßt sich eben doch nicht totkriegen. Und so eroberte sich Heavens Gate im Laufe der Zeit seinen verdienten Platz im Filmolymp und gilt Heute unwidersprochen als absolutes Meisterwerk. Jahrzehnte später erhielt Cimino für Heavens Gate die goldene Ehrenpalme der Filmfestspiele von Cannes und erfuhr so die ihm gebührende Reputation. Das es jahrzehntelang als größter Flop der Filmgeschichte galt, der den Ruin des u.a. von Charlie Chaplin und Douglas Fairbanks gegründeten United Artist Studios zur Folge hatte und das glorreiche Kapitel des amerikanischen Autorenkinos endgültig zu Grabe trug, sind Heute allerdings nur noch Randnotizen und allenfalls für Filmhistoriker interessant.
Was Cimino bei kommerziellem Erfolg von Heavens Gate noch für imposante Werke geschaffen haben mag, ist Spekulation. Sein Talent hätte dem werten Freund hochkalorischer Filmkost bei entsprechend pekunärer Unterstützung aber sicher noch den einen oder anderen unsterblichen Klassiker beschert...
Die Handlung in aller Kürze
1890 in Montana. Der Anwalt James Averill (Kris Kristofferson) unterstützt die armen Farmer in ihrem Kampf gegen die Viehzüchterlobby. Einer von ihnen ist sein alter Freund Billy aus Studienzeiten. Gemeinsam feierten sie 1870 ihren Abschluß an der Eliteuniversität Harvard. Obwohl beide ihre elitären Wurzeln nicht ablegen können, kämpft Averill auf der Seite der "kleinen Leute", während Billy die Fesseln seines Standes nicht abschütteln kann und sich den Viehbaronen verbunden fühlt. Er ist zwar von ihrem skrupellosen Verhalten angewidert, vermag es aber nicht, sich von seiner Kaste zu distanzieren. Seinen Frust darüber ertränkt er im Alkohol. Und hier überschneiden sich die beiden Charaktere wieder. Denn auch der Anwalt ist dem Feuerwasser seit der guten alten Jugendzeit mehr als nur zugeneigt und hat seinen Flachmann Hochprozentiges ebenfalls immer gutgefüllt und griffbereit am Mann.
Einer der größten Kritikpunkte war immer das schwache Spiel der Hauptdarsteller, vor allem von Kristofferson. Aber hier gehen meiner Meinung nach die Kritiker völlig fehl und verknüpfen das Westerngenre zu reflexartig mit glänzenden schablonenhaften Hollywoodhelden, die mit einer übermenschlichen Moral und männlichen Kraft ausstaffiert sind, welche Natur und Feind zu bändigen vermag, um schlußendlich im aufnahmebereiten Schoß der tagesaktuellen Hollywoodschönheit zu landen.
Aber genau dieses Klischee sollen die Protagonisten hier eben nicht erfüllen. Im Gegenteil: Averill ist ein gebrochener Mensch, vom Leben gezeichnet, und sucht im Alkohol Trost und Erleichterung von der Schwere des Daseins. Im gewißen Sinne ist er damit ein Antiheld, ein schlichter Mensch, aus Fleisch und Blut gestrickt und mit Makeln behaftet.
Als er 1890 in dem Westernkaff Casper ankommt, ist von der Euphorie seiner zurückliegenden Harvardzeit nichts mehr zu spüren. Was in den 20 Jahren passiert ist, darüber erfährt der Zuschauer nichts. Gestik und Mimik sprechen aber eine eindeutige Sprache: Averill ist vom Leben desillusioniert und sein jugendlicher Elan hat die Kollision mit der Wirklichkeit nicht überlebt. Man darf also nicht den Fehler begehen, hier einen strahlenden Helden aus der klassischen Westernepoche zu erwarten. Denn auch hier trifft wieder eher das Gegenteil zu: Averill schleppt sich mühsam und zäh durch sein Leben, welches ihn zu einem wortkargen und introvertierten Menschen geschliffen hat.
Trost findet er nur in der Armen der Hure Ella, die ihr Bordell weit außerhalb der Siedlung, auf einem wunderschönen Fleckchen Erde errichtet hat. Da aber einige Einwanderer ihre Dienste im Tausch gegen gestohlenes Fleisch in Anspruch nehmen, steht auch ihr Name ganz oben auf der Todesliste.
Averills Nebenbuhler um die schöne Bordellbesitzerin ist der im Auftrag der Rinderbarone tötende Scharfschütze Nate Champion (Christopher Walken). Als dieser Ella einen Heiratsantrag macht, muß Averill den nächsten Schicksalschlag überstehen.
Am Boden zerstört und zu kraftlos um um Ella zu kämpfen, liefert sich Averill dem Alkohol aus. Während er verkatert im Bett liegt, beschließen die Einwanderer, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und gehen zum Angriff auf die Rinderbarone und ihre Kopfgeldjäger über...Weiters soll aus Spoilergründen im Verborgenen bleiben
Nur noch soviel: Das Ende des Filmes, also die Scene in 1903, zählt für mich zu den stärksten Momenten des Filmes. Ohne das Kristofferson ein Wort spricht, offenbart sich das Drama Averills gesamten Lebens und man gewinnt den Eindruck, ihm bis auf den Grund seiner Seele schauen zu können. Das ist Filmkunst in Vollendung.
Für mich steht Heavens Gate deshalb auf einer Stufe mit den besten Filmen überhaupt. Er spielt damit in derselben Liga wie Leones Klassiker "Es war einmal in Amerika", "Spiel mir das Lied vom Tod", etc.
Die Bilder, die hier von dem Kameragenie Vilmos Zsigmond eingefangen wurden und maßgeblich den Status des Filmes begründen, sind von erhabener Schönheit und zeitloser Ästethik. In monumentalen Landschaftspanoramen schwelgend entführt Zsigmond den Zuschauer in eine dampfende, zischende und staubende märchenhafte Westernwelt, die mit überbordener Ausstattung gespickt und bevölkert von charismatischen Individualisten ist. Der Authentizitismus der Ausstattungsschlacht, gepart mit dem Dreck in den Straßen und den schmutzig schwieligen Gesichtern der Pioniere, geht mit der visuellen Ästhetik Zsigmonds eine in sich stimmige Symbiose ein, so daß sich der Stil Ciminos vielleicht am treffensten als poetischer Realismus bezeichnen läßt.
Ohne CGI, nur geprägt von handwerklicher Kunst und geschultem Auge, reihen sich Bilder an Bilder, die an Perfektion kaum zu überbieten sind und in denen sich der Zuschauer verlieren möchte.
So ist Heavens Gate denn auch ein Film für Genießer. Wer keine Muße mitbringt und sich nicht in den episch elegischen Bidern verlieren kann, hat in dem Film nichts verloren. Die Bilder sind sich oft selbst genug und die Handlung schleppt sich nur ähnlich zäh voran, wie das Leben Averills. Sie weicht sogar oft hinter den visuellen Schauwerten zurück. Wo Bilder aber zu Kunstwerken werden, gleicht dies einem Museumsbesuch alter Meister, den man bis zum letzten Atemzug auskosten möchte. So überkommt einen auch nach 217min ein Gefühl von Wehmut, die Welt überbordener Pracht wieder verlassen zu müßen.
Mit dem entsprechenden Gemüt und einer bestimmten seelischen Prädisposition ausgestattet, die notwendig ist, um den Film ganz in sich hineinsinken zu lassen, ist der vermeintliche Handlungsmangel für den Geniesser also eher ein Lustgewinn als eine Zumutung.
Und ich bedauere jeden, der auf Grund seiner emotionalen Strukturierung zu diesem gehobenen Genuss nicht in der Lage ist...
Das Bild ist der Größe des Werkes angemeßen restauriert. Cimino persönlich überwachte das Mastering und gab glückseelig frohjauchzend grünes Licht, ob des gelungenen Prozesses. Die Farben erstrahlen in ihrer matten Pracht und das Originalfilmkorn wurde bei der digitalen Überarbeitung nicht herausgeglättet. So kommt die Bluray dem Original wohl so nah wie nur möglich.
Der Ton ist sauber und gut verständlich, jedoch naturgemäß unspektakulär. Die Musik ist unauffällig minimalistisch, unterstreicht in den geeigneten Momenten aber punktgenau die Erhabenheit der Bilder.
Der Recut
Als abzusehen war, daß der Film kolossal an den Kinokassen floppte, entschied sich das Produzententeam hektisch, Heavens Gate um eine Std. verkürzt in die Kinos zu bringen.
Angeblich kostete der Recut (inkl. Kopien) nochmal 10 Mio Dollar und brach dem Studio somit endgültig das Genick.
Der Recut ist stringenter erzählt und man hoffte so, dem Actionverwöhnten Zuschauer weniger stille Momente zuzumuten. Aber vergebens. Die Reputation des Filmes war endgültig hinüber und der gewünschte Erfolg blieb aus.
Aber interessant ist die Version allemal. Zum einen, weil das Finale des Filmes eine neue Akzentuierung erfährt und zweitens, weil er Scenen beinhaltet, die im Director's Cut fehlen.
Es mag sein, daß die Scenen in der Originalkinoversion auch enthalten waren, erinnern kann ich mich aber nicht mehr (ich sah den Film Ende der 80'er erstmals im Fernsehen).
Zu erwähnen ist aber, das der Directors Cut um 2 min. gegenüber der ursprünglichen Kinoversion gekürzt war.
Wer einmal die Langversion gesehen hat, wird sich aber niemals mehr mit der gekürzten Fassung zufrieden geben. Die Erzählung ist zwar kompakter, das epigonenhafte, episch-weitschweifige flackert jedoch nur in kurzen Augenblicken durch. Das aber ist ja genau die Seele des Filmes, der diese Faszination ausübt und um die er letztendlich betrogen wurde.
Bleibt noch nachzutragen, daß auf der Berlinale eine nochmals um 20min längere Version aufgeführt wurde. Gebenedeit seien die Genießer dieser filmhistorischen Sternstunde...
Nach dem Oscargewinn für "Die durch die Hölle gehen" erhielt Regisseur Michael Cimino grünes Licht für ein Westernepos, das alle bekannten Maßstäbe für Ästhetik und und Detailverliebtheit sprengte. Das ursprüngliche Etat von 7,5 Millionen wurde durch den immens betriebenen Aufwand an Kulissen und Ausstattung binnen kürzester Zeit auf 40 Millionen Dollar geschraubt. Nachdem die Studiobosse aber die ersten Testvorführungen gesichtet hatten, wußte man, daß mit dem Geld kein Schindluder getrieben, sondern einem imposanten Spätwestern von außerordentlicher Schönheit der Weg ins Leben geebnet wurde - und lehnte sich entspannt zurück.... Eine Geste allerdings, die man schon bald bitter bereuen sollte...
In elegischen, weitschweifigen und bis ins letzte Detail durchkomponierten Bildern wird ein dunkles Kapitel aus den verborgenen Winkeln des amerikanischen Gedächtnisses ans Licht der Leinwände gezerrt: Der Johnston County War. Europäische Siedler, die den beschwerlichen Weg aus ihrer alten Heimat in die neue Welt auf sich genommen haben, machten sich auf den mühsamen Weg in den gelobten Westen der noch jungen USA. Ausgemergelt und mittellos blieb ihnen auf dem Weg ins vermeintliche Glück oftmals nichts anderes übrig, als sich gelegentlich ein Stück Vieh aus dem unzähligen Bestand der Rinderbarone zu schlachten. Es ging dabei ja schließlich um nichts weniger als das nackte Überleben.
Die Herdenbesitzer haben sich indes zu einem Interessenverbund zusammengeschmiedet und beschloßen, skrupellos gegen die Viehdiebe vorzugehen: Eine verwegene Meute von 50 Kopfgeldjäger wird rekrutiert und jedem eine Abschußprämie garantiert, der einen Einwanderer aus einer "Todesliste" von 125 Namen eliminiert. Das sie bei dieser Menschenhatz die Rückendeckung des Gouverneurs von Montana und des amerikanischen Präsidenten hatten, wirft einen blutroten Schatten auf die verklärte Ethik der Gründungsväter der vereinigten Staaten.
Die Ammenmär des von edler Moral durchtränkten Westernhelden ala John Wayne, James Stewart oder Gregory Peck wird hier mittels historischer Fakten der Geschichtsverklitterung überführt.
Das Fundament der amerikanischen Gesellschafft beruht eben nicht auf Altruismus und nobler Gottesgefälligkeit, wie es die Gründungsmythen künden, sondern stand schon von Beginn an im Zeichen von Profitgier und dem Sozialdarwinismus im Geiste des Überleben des Stärkeren.
In der Tatsache, daß der selbstgefälligen amerikanischen Volkseele der Spiegel vorgehalten und am Lack der auf Lügen basierenden Legendenbildung durch die Hollywoodproduktionen gekratzt wurde, ist auch das finanzielle Fiasko zu erklären, welches Heavens Gate zu seiner Zeit, der beginnenden Reagen Ära mit seinem Neopatriotismus, beschieden war. Die Zeit des amerikanischen Selbsthasses der Postvietnamära war endgültig abgelaufen und man sehnte sich nach Neuem. Die Kritiker der ersten Vorstellungen zerrissen demnach den Film in der Luft. Ein antipatriotischer Film entsprach über Nacht nicht mehr dem Zeitgeist Amerikas. Selbst der Reporter der renomierten New York Times vermochte nicht die emotionale Schmach der Realität zu ertragen und die über Jahrzehnte eingebleute Grossmannsillusion, ein direkter Nachkomme hochheiliger Pilgerväter zu sein, angewiedert abzuschütteln. So äußerste er sich dementsprechend auch grob abfällig über das Werk. Ob folgende Kritiker danach nicht mehr Willens oder in der Lage waren, ihrer Koriphäre zu widersprechen und sich damit womöglich fachlich zu disqualifizieren, sei dahingestellt und bleibt Spekulation. Tasache aber ist, daß sie ins gleiche Horn bliesen. Die vernichtenden Kritiken entwickelten so eine sich selbstverstärkende Eigendynamik, die den Film schlußendlich in den Abgrund stürzte.
Aus heutiger Sicht unfaßbar, wurde Heavens Gate für 5 goldene Himbeeren nominiert. U.a. für den schlechtesten Schauspieler, den schlechtesten Film und die schlechteste Regie. In letztgenannter Kategorie wurde er beschämender Weise sogar prämiert. Man jaulte lieber mit den Wölfen, als dem eigenen Empfinden für wahre Größe zu folgen.
Aber Qualität läßt sich eben doch nicht totkriegen. Und so eroberte sich Heavens Gate im Laufe der Zeit seinen verdienten Platz im Filmolymp und gilt Heute unwidersprochen als absolutes Meisterwerk. Jahrzehnte später erhielt Cimino für Heavens Gate die goldene Ehrenpalme der Filmfestspiele von Cannes und erfuhr so die ihm gebührende Reputation. Das es jahrzehntelang als größter Flop der Filmgeschichte galt, der den Ruin des u.a. von Charlie Chaplin und Douglas Fairbanks gegründeten United Artist Studios zur Folge hatte und das glorreiche Kapitel des amerikanischen Autorenkinos endgültig zu Grabe trug, sind Heute allerdings nur noch Randnotizen und allenfalls für Filmhistoriker interessant.
Was Cimino bei kommerziellem Erfolg von Heavens Gate noch für imposante Werke geschaffen haben mag, ist Spekulation. Sein Talent hätte dem werten Freund hochkalorischer Filmkost bei entsprechend pekunärer Unterstützung aber sicher noch den einen oder anderen unsterblichen Klassiker beschert...
Die Handlung in aller Kürze
1890 in Montana. Der Anwalt James Averill (Kris Kristofferson) unterstützt die armen Farmer in ihrem Kampf gegen die Viehzüchterlobby. Einer von ihnen ist sein alter Freund Billy aus Studienzeiten. Gemeinsam feierten sie 1870 ihren Abschluß an der Eliteuniversität Harvard. Obwohl beide ihre elitären Wurzeln nicht ablegen können, kämpft Averill auf der Seite der "kleinen Leute", während Billy die Fesseln seines Standes nicht abschütteln kann und sich den Viehbaronen verbunden fühlt. Er ist zwar von ihrem skrupellosen Verhalten angewidert, vermag es aber nicht, sich von seiner Kaste zu distanzieren. Seinen Frust darüber ertränkt er im Alkohol. Und hier überschneiden sich die beiden Charaktere wieder. Denn auch der Anwalt ist dem Feuerwasser seit der guten alten Jugendzeit mehr als nur zugeneigt und hat seinen Flachmann Hochprozentiges ebenfalls immer gutgefüllt und griffbereit am Mann.
Einer der größten Kritikpunkte war immer das schwache Spiel der Hauptdarsteller, vor allem von Kristofferson. Aber hier gehen meiner Meinung nach die Kritiker völlig fehl und verknüpfen das Westerngenre zu reflexartig mit glänzenden schablonenhaften Hollywoodhelden, die mit einer übermenschlichen Moral und männlichen Kraft ausstaffiert sind, welche Natur und Feind zu bändigen vermag, um schlußendlich im aufnahmebereiten Schoß der tagesaktuellen Hollywoodschönheit zu landen.
Aber genau dieses Klischee sollen die Protagonisten hier eben nicht erfüllen. Im Gegenteil: Averill ist ein gebrochener Mensch, vom Leben gezeichnet, und sucht im Alkohol Trost und Erleichterung von der Schwere des Daseins. Im gewißen Sinne ist er damit ein Antiheld, ein schlichter Mensch, aus Fleisch und Blut gestrickt und mit Makeln behaftet.
Als er 1890 in dem Westernkaff Casper ankommt, ist von der Euphorie seiner zurückliegenden Harvardzeit nichts mehr zu spüren. Was in den 20 Jahren passiert ist, darüber erfährt der Zuschauer nichts. Gestik und Mimik sprechen aber eine eindeutige Sprache: Averill ist vom Leben desillusioniert und sein jugendlicher Elan hat die Kollision mit der Wirklichkeit nicht überlebt. Man darf also nicht den Fehler begehen, hier einen strahlenden Helden aus der klassischen Westernepoche zu erwarten. Denn auch hier trifft wieder eher das Gegenteil zu: Averill schleppt sich mühsam und zäh durch sein Leben, welches ihn zu einem wortkargen und introvertierten Menschen geschliffen hat.
Trost findet er nur in der Armen der Hure Ella, die ihr Bordell weit außerhalb der Siedlung, auf einem wunderschönen Fleckchen Erde errichtet hat. Da aber einige Einwanderer ihre Dienste im Tausch gegen gestohlenes Fleisch in Anspruch nehmen, steht auch ihr Name ganz oben auf der Todesliste.
Averills Nebenbuhler um die schöne Bordellbesitzerin ist der im Auftrag der Rinderbarone tötende Scharfschütze Nate Champion (Christopher Walken). Als dieser Ella einen Heiratsantrag macht, muß Averill den nächsten Schicksalschlag überstehen.
Am Boden zerstört und zu kraftlos um um Ella zu kämpfen, liefert sich Averill dem Alkohol aus. Während er verkatert im Bett liegt, beschließen die Einwanderer, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und gehen zum Angriff auf die Rinderbarone und ihre Kopfgeldjäger über...Weiters soll aus Spoilergründen im Verborgenen bleiben
Nur noch soviel: Das Ende des Filmes, also die Scene in 1903, zählt für mich zu den stärksten Momenten des Filmes. Ohne das Kristofferson ein Wort spricht, offenbart sich das Drama Averills gesamten Lebens und man gewinnt den Eindruck, ihm bis auf den Grund seiner Seele schauen zu können. Das ist Filmkunst in Vollendung.
Für mich steht Heavens Gate deshalb auf einer Stufe mit den besten Filmen überhaupt. Er spielt damit in derselben Liga wie Leones Klassiker "Es war einmal in Amerika", "Spiel mir das Lied vom Tod", etc.
Die Bilder, die hier von dem Kameragenie Vilmos Zsigmond eingefangen wurden und maßgeblich den Status des Filmes begründen, sind von erhabener Schönheit und zeitloser Ästethik. In monumentalen Landschaftspanoramen schwelgend entführt Zsigmond den Zuschauer in eine dampfende, zischende und staubende märchenhafte Westernwelt, die mit überbordener Ausstattung gespickt und bevölkert von charismatischen Individualisten ist. Der Authentizitismus der Ausstattungsschlacht, gepart mit dem Dreck in den Straßen und den schmutzig schwieligen Gesichtern der Pioniere, geht mit der visuellen Ästhetik Zsigmonds eine in sich stimmige Symbiose ein, so daß sich der Stil Ciminos vielleicht am treffensten als poetischer Realismus bezeichnen läßt.
Ohne CGI, nur geprägt von handwerklicher Kunst und geschultem Auge, reihen sich Bilder an Bilder, die an Perfektion kaum zu überbieten sind und in denen sich der Zuschauer verlieren möchte.
So ist Heavens Gate denn auch ein Film für Genießer. Wer keine Muße mitbringt und sich nicht in den episch elegischen Bidern verlieren kann, hat in dem Film nichts verloren. Die Bilder sind sich oft selbst genug und die Handlung schleppt sich nur ähnlich zäh voran, wie das Leben Averills. Sie weicht sogar oft hinter den visuellen Schauwerten zurück. Wo Bilder aber zu Kunstwerken werden, gleicht dies einem Museumsbesuch alter Meister, den man bis zum letzten Atemzug auskosten möchte. So überkommt einen auch nach 217min ein Gefühl von Wehmut, die Welt überbordener Pracht wieder verlassen zu müßen.
Mit dem entsprechenden Gemüt und einer bestimmten seelischen Prädisposition ausgestattet, die notwendig ist, um den Film ganz in sich hineinsinken zu lassen, ist der vermeintliche Handlungsmangel für den Geniesser also eher ein Lustgewinn als eine Zumutung.
Und ich bedauere jeden, der auf Grund seiner emotionalen Strukturierung zu diesem gehobenen Genuss nicht in der Lage ist...
Das Bild ist der Größe des Werkes angemeßen restauriert. Cimino persönlich überwachte das Mastering und gab glückseelig frohjauchzend grünes Licht, ob des gelungenen Prozesses. Die Farben erstrahlen in ihrer matten Pracht und das Originalfilmkorn wurde bei der digitalen Überarbeitung nicht herausgeglättet. So kommt die Bluray dem Original wohl so nah wie nur möglich.
Der Ton ist sauber und gut verständlich, jedoch naturgemäß unspektakulär. Die Musik ist unauffällig minimalistisch, unterstreicht in den geeigneten Momenten aber punktgenau die Erhabenheit der Bilder.
Der Recut
Als abzusehen war, daß der Film kolossal an den Kinokassen floppte, entschied sich das Produzententeam hektisch, Heavens Gate um eine Std. verkürzt in die Kinos zu bringen.
Angeblich kostete der Recut (inkl. Kopien) nochmal 10 Mio Dollar und brach dem Studio somit endgültig das Genick.
Der Recut ist stringenter erzählt und man hoffte so, dem Actionverwöhnten Zuschauer weniger stille Momente zuzumuten. Aber vergebens. Die Reputation des Filmes war endgültig hinüber und der gewünschte Erfolg blieb aus.
Aber interessant ist die Version allemal. Zum einen, weil das Finale des Filmes eine neue Akzentuierung erfährt und zweitens, weil er Scenen beinhaltet, die im Director's Cut fehlen.
Es mag sein, daß die Scenen in der Originalkinoversion auch enthalten waren, erinnern kann ich mich aber nicht mehr (ich sah den Film Ende der 80'er erstmals im Fernsehen).
Zu erwähnen ist aber, das der Directors Cut um 2 min. gegenüber der ursprünglichen Kinoversion gekürzt war.
Wer einmal die Langversion gesehen hat, wird sich aber niemals mehr mit der gekürzten Fassung zufrieden geben. Die Erzählung ist zwar kompakter, das epigonenhafte, episch-weitschweifige flackert jedoch nur in kurzen Augenblicken durch. Das aber ist ja genau die Seele des Filmes, der diese Faszination ausübt und um die er letztendlich betrogen wurde.
Bleibt noch nachzutragen, daß auf der Berlinale eine nochmals um 20min längere Version aufgeführt wurde. Gebenedeit seien die Genießer dieser filmhistorischen Sternstunde...
mit 5
mit 4
mit 3
mit 3
bewertet am 18.06.18 um 13:47
Zwei Filmperlen und ein echtes Juwel belohnen denjenigen Cinearchäologen, der die Muße auf sich genommen hat, sich in den modrigen Archiven lange vergangener Jahrzehnte auf Schatzsuche zu begeben.
In den "Aussergewöhnlichen Geschichten" geben sich drei Ausnahmeregisseure und eine Handvoll Stars ein Stelldichein und setzen drei Geschichten des Gruselpoeten Edgar Allan Poe lose in die Sprache der bewegten Bilder um. Roger Vadim (Barbarella), Louis Malle (Fahrstuhl zum Schaffott) und Fellini La Strada) wählten dabei je eine Episode, die ihren persönlichen Vorlieben entsprach.
Metzgenerstein
Bei Vadim war dies natürlich, seinem Hang zum schönen Geschlecht folgend, eine leicht frivole Geschichte. So stehen in seiner Episode "Metzengerstein" die erotischen Ausschweifungen der 20jährigen Contessa Frederica im Zentrum seiner Abhandlung. Schon in frühesten Erwachsenenjahren erbt die schöne Contessa ein prächtiges Schloß. Fortan, charakterlich noch unausgereift und mit einer dunklen Ader zum Herrschen geschlagen, treibt sie allerlei böse Späße mit Angestellten und Untergebenen und lebt ihre sexuellen Obzessionen bis zur letzten Sinnesfreude aus.
Frederices ungezügeltes Gebaren erhält jäh eine unerwartete Wendung, als ihr der verschwiegende Baron Frederick von Metzengerstein (Peter Fonda) in einer Waldlichtung offenbar wird. Die beiden Geschlechter der Berlifitzing (Frederica) und Metzengerstein leben schon seit Jahrhunderten in tiefer Abneigung gegeneinander. Den Grund hierfür hat die Zeit längst vergessen gemacht. Magisch fühlt sich die Gräfin seit dem ersten Augenkontakt zu dem Schönling hingezogen und macht ihm Complimente und Avancen. Er wäre endlich mal eine echte Herausforderung und das I-Tüpfelchen in ihrer Sammlung erotischer Abenteuer. Von Metzgenerstein allerdings erwiedert ihr Werben nicht. Lieber möchte der sensible Feingeist dem Glück, das er mit seinen Tieren teilt, und dem Einklang mit der Natur und seiner Seele fröhnen, als dem herrschsüchtigen High-Society Flittchen als Dildo zu dienen.
Frederice ist von dieser Zurückweisung jedoch bis aufs Mark gekränkt, ist sie doch in einer Welt aus Befehl und Gehorsam aufgewachsen, und sinnt auf Rache.
Was läge da näher, als Wilhelm an seiner empfindlichsten Stelle, seinen Pferden zu treffen? Also entschließt das besessene Weib sich, den Pferdestall des Rivalen den Flammen zu opfern. Beim Versuch, des Stall zu löschen und seine geliebten Tiere zu retten, verliert allerdings auch Wilhelm sein eigenes Leben...In derselben Nacht taucht jedoch plötzlich ein riesiger schwarzer (im Buch feuerroter) Hengst aus der tiefen Stille des Waldes am Hofe der Contesse auf. Seltsamer Weise entflammt zeitgleich ein sich wild aufbäumendes Pferd auf einem edlen Wandteppich der Burgbewohnerin scheinbar wie von Geisterhand.
Auf unerklärliche Weise fühlt sich Frederica zu dem starken Tier hingezogen. Nach und nach verliert sie das Interesse an ihren extravaganten Ausschweifungen und geniesst ihr Leben auf dem Rücken des Pferdes in der weiten unberührten Natur ihrer Ländereien. Als eines Tages ein heftiges Gewitter einen nahegelegenen Wald in Feuer setzt, sieht man das Pferd mit der verängstigten Reiterin unaufhaltsam der Flammenhölle entgegengaloppieren...
Poe greift hier das alte Thema der Seelenwanderung auf und flechtet es in düstere Gruselgeschichte ein, die jedoch nicht weit über das Niveau einer Pfadfinderlagerfeuergruselgesc hichte hinausreicht. Vadim wandelt das literarische Vorbild, wo die Gräfin Frederica ursprünglich der Graf Frederick war, in eine erotisch-romantische Legende um, die nur mäßig Spannung erzeugt, aber die körperlichen Vorzüge seiner damaligen Frau Jane Fonda kameragerecht in Stellung bringt. So ist es denn auch die Bildsprache und die Freizügigkeit der Schauermär, die dieser Episode ihre Berechtigung verschaffen. Großes Kino ist dies allerdings nicht und die Metapher des auf dem wilden Hengst reitenden Frau ist nur allzu platt. Daher nicht mehr als 3 Punkte.
William Wilson
Mit William Wilson nimmt die Bluray etwas Fahrt auf. Er beginnt mit einer Beichte, in der der Kadett William Wilson (Alain Delon) eine Predigt stürmt und sich angstschlotternd Gehör erzwingt. Hier erzählt er in kurzen Abrissen dem Priester die Geschichte seines Lebens.
William Wilson ist ein pathologischer Sadist. Seit seiner Schulzeit zieht er aus der Qual ihm ausgelieferter Mitmenschen kranke Gelüste. Seine sadistischen Aktionen werden jedoch immer kurz vor ihrem Höhepunkt von einer plötzlich auftretenden Person, die sich ebenfalls William Wilson nennt und ihm bis aufs Haar gleicht, unterbrochen. Im Kadettenalter betrügt er eine schöne Spielerin (Bridget Bardot) beim Pokern um ihren Gewinn und peitscht sie als Abgeltung ihres Schuldendienstes vor den Augen seiner Kameraden aus. Als Wilsons Lust sich steigert, taucht sein alter Ego wieder auf und verdirbt dem Psychopathen seinen Spass. Vor den Augen seiner Kameraden wird Willson als Falschspieler entlarvt, und als Konsequenz daraus unehrenhaft aus dem Kreis seiner Kameraden ausgeschlossen. Erzürnt von dieser Demütigung, entscheidet sich Wilson, seinen Doppelgänger aus der Welt zu schaffen, ahnend, daß er damit sein eigenes Schicksal besiegelt...
Regisseur Melle, der sich zum albtraumhaft-klaustrophobische n hingezogen fühlt, zieht hier in Punkto Spannung und Beklemmung schon deutlich die Schrauben an. Nicht zuletzt die eindringliche Kameraführung und die voyeuristische Unerbittlichkeit tragen zu dem unangenehmen Gefühl bei, die die Bilder erzeugen. Die Härte, die sich 1968 wohl an der Grenze des damals zumutbaren bewegte und nicht zuletzt die überzeugende schauspielerische Leistung Delons, der hier bereit war, sein positives Image zu konterkarieren, sind allemal 4 Punkte wert.
Psychologisch könnte man die die Geschichte als Abspaltung unerlaubter, sadistischer Triebe verstehen, die sozial als Böse gebrandmarkt und von der Guten Seite eingedämmt werden müßen, um gesellschaftlich nicht geächtet zu werden. Sinngemäß durfte das Dunkle ohne die kontrollierenden hellen Seelenattribute nicht überlebensfähig sein. So betrachtet erhält William Wilson auch eine theologisch-moralische Komponente.
Toby Dammit
Fellinis Toby Dammit bildet den Schluß- und Höhepunkt der Triologie und ist für sich genommen ein kleines verstörendes Meisterwerk.
Zeichnen sich die beiden ersten Beiträge noch durch unheimliche und übernatürliche Elemente aus und folgen dabei den Grundstrukturen frühromantischer Texte, geht Toby Dammit ganz eigene Wege und traut sich auf das Terrain des Experimentalfilmes vor. Fellinis Episode spielt in der Gegenwart und greift auf zeitgenößische Themen zurück. Toby Dammit ist ein in Ungnade gefallener amerikanischer Filmstar, der für seine Industrie nichts als Verschtung übrig hat. Zynismus und Alkoholsucht sind sein Markenzeichen geworden. Letzteres hat ihm in Hollywood nur Scherereien beschert und so begegnen wir Toby in einem italienischen Taxi, wo er mit seinen Produzenten die Bedingungen für seine neue Rolle in einem religiösen Western aushandelt. Die Produzenten befinden sich dabei auf ähnlich intellektuellen Höhenflügen wie die Protagonisten in Fellinis kontroversem Meisterstück 8 1/2. Der Spannungsbogen zwischen den auf der Metaebene philosophierenden Filmschaffenden und dem bissigen Spot des vom Alkohol zerfressenen Toby Dammit könnte größer kaum sein. Dammit weiß aus seinem dillirantem Seinszustand der Welt nur mit Spott und bissigem Sarkasmus zu begegnen. Alkoholbenebelt wie der Geist des Amerikaners ist auch die Inszenierung gestaltet. Die Bilder erzeugen eine rauschhaft entrückte, beinahe halluzinatorische Athmosphäre, in der die Welt als Inhaltslos und auf die bloße glitzernde Fassade reduziert, definiert wird. Dammit und die Bildsprache entfernen sich von der Ebene der reinen Venunft und flirten mit den Abgründen der Verrücktheit. Obwohl kaum gruselig, ist Fellinis Episode grausamer als seine beiden Vorgänger, da das Grauen des immerwährenden Wahnsinns als permanente Bedrohung über unseren Köpfen schwebt. Die Athmosphäre der betäubten Volltrunkenheit, in der die Welt nur noch fragmentarische Bedeutung besitzt, ist uns wohl allen bestens aus diversen adoleszenten Rauscherfahrungen in Erinnerung. Der Horror ergibt sich somit aus der unmittelbaren Nähe, des selbst erlebten Pseudowahnsinns zu dem Reich des entsetzlichen Kontrollverlustes. Er ist nur einen halben Schritt von unserer Ratio entfernt und unser ständiger Begleiter. Ein falscher Schritt und der Wahnsinn zerrt uns aus unserer sicher geglaubten Existenz.
Dammit hat die Ebene der Realität bereits verlassen. Körperlich noch im System präsent, fühlt er sich jedoch an die Welt (seinen Beruf) nicht mehr gebunden. Sein ganzes Ansinnen gilt nun einem Ferrari, in dem er sich einem letzten Rausch, aus dem es kein Entkommen mehr gibt, hingibt: Dem Rausch der Geschwindigkeit.
Der Rausch, dem süßen Engel, der Toby Erlösung verheißt, birgt jedoch den Teufel des Verfalles und der Vernichtung bereits in seinen Gefiedern.
In der letzten Scene ist dies grausam schön symbolisiert.
Fellinis Toby Dammit ist trotz seiner nur 45min nichts weniger als ein filmisches Meisterwerk, aufgeladen mit einer kaum zu überschaubaren Fülle von Metaphern und Symbolismus und einer vollrauschdurchtränkten Bildsprache, die den Zuschauer in den dumpf seeligen Zustand eines Narkotikers versetzt. Ein Film, der den Vergleich mit Jodorowskys frühen Meisterwerken nicht zu scheuen braucht, und, wer weiß, vielleicht hat die Idee des religiösen Westerns ja den Grundstein für El Topo gelegt...so oder so, für dieses seltene Juwel extravaganter Filmkunst wäre es ein unverzeihlicher Frevel, weniger als 5 Punkte zu geben.
In den "Aussergewöhnlichen Geschichten" geben sich drei Ausnahmeregisseure und eine Handvoll Stars ein Stelldichein und setzen drei Geschichten des Gruselpoeten Edgar Allan Poe lose in die Sprache der bewegten Bilder um. Roger Vadim (Barbarella), Louis Malle (Fahrstuhl zum Schaffott) und Fellini La Strada) wählten dabei je eine Episode, die ihren persönlichen Vorlieben entsprach.
Metzgenerstein
Bei Vadim war dies natürlich, seinem Hang zum schönen Geschlecht folgend, eine leicht frivole Geschichte. So stehen in seiner Episode "Metzengerstein" die erotischen Ausschweifungen der 20jährigen Contessa Frederica im Zentrum seiner Abhandlung. Schon in frühesten Erwachsenenjahren erbt die schöne Contessa ein prächtiges Schloß. Fortan, charakterlich noch unausgereift und mit einer dunklen Ader zum Herrschen geschlagen, treibt sie allerlei böse Späße mit Angestellten und Untergebenen und lebt ihre sexuellen Obzessionen bis zur letzten Sinnesfreude aus.
Frederices ungezügeltes Gebaren erhält jäh eine unerwartete Wendung, als ihr der verschwiegende Baron Frederick von Metzengerstein (Peter Fonda) in einer Waldlichtung offenbar wird. Die beiden Geschlechter der Berlifitzing (Frederica) und Metzengerstein leben schon seit Jahrhunderten in tiefer Abneigung gegeneinander. Den Grund hierfür hat die Zeit längst vergessen gemacht. Magisch fühlt sich die Gräfin seit dem ersten Augenkontakt zu dem Schönling hingezogen und macht ihm Complimente und Avancen. Er wäre endlich mal eine echte Herausforderung und das I-Tüpfelchen in ihrer Sammlung erotischer Abenteuer. Von Metzgenerstein allerdings erwiedert ihr Werben nicht. Lieber möchte der sensible Feingeist dem Glück, das er mit seinen Tieren teilt, und dem Einklang mit der Natur und seiner Seele fröhnen, als dem herrschsüchtigen High-Society Flittchen als Dildo zu dienen.
Frederice ist von dieser Zurückweisung jedoch bis aufs Mark gekränkt, ist sie doch in einer Welt aus Befehl und Gehorsam aufgewachsen, und sinnt auf Rache.
Was läge da näher, als Wilhelm an seiner empfindlichsten Stelle, seinen Pferden zu treffen? Also entschließt das besessene Weib sich, den Pferdestall des Rivalen den Flammen zu opfern. Beim Versuch, des Stall zu löschen und seine geliebten Tiere zu retten, verliert allerdings auch Wilhelm sein eigenes Leben...In derselben Nacht taucht jedoch plötzlich ein riesiger schwarzer (im Buch feuerroter) Hengst aus der tiefen Stille des Waldes am Hofe der Contesse auf. Seltsamer Weise entflammt zeitgleich ein sich wild aufbäumendes Pferd auf einem edlen Wandteppich der Burgbewohnerin scheinbar wie von Geisterhand.
Auf unerklärliche Weise fühlt sich Frederica zu dem starken Tier hingezogen. Nach und nach verliert sie das Interesse an ihren extravaganten Ausschweifungen und geniesst ihr Leben auf dem Rücken des Pferdes in der weiten unberührten Natur ihrer Ländereien. Als eines Tages ein heftiges Gewitter einen nahegelegenen Wald in Feuer setzt, sieht man das Pferd mit der verängstigten Reiterin unaufhaltsam der Flammenhölle entgegengaloppieren...
Poe greift hier das alte Thema der Seelenwanderung auf und flechtet es in düstere Gruselgeschichte ein, die jedoch nicht weit über das Niveau einer Pfadfinderlagerfeuergruselgesc hichte hinausreicht. Vadim wandelt das literarische Vorbild, wo die Gräfin Frederica ursprünglich der Graf Frederick war, in eine erotisch-romantische Legende um, die nur mäßig Spannung erzeugt, aber die körperlichen Vorzüge seiner damaligen Frau Jane Fonda kameragerecht in Stellung bringt. So ist es denn auch die Bildsprache und die Freizügigkeit der Schauermär, die dieser Episode ihre Berechtigung verschaffen. Großes Kino ist dies allerdings nicht und die Metapher des auf dem wilden Hengst reitenden Frau ist nur allzu platt. Daher nicht mehr als 3 Punkte.
William Wilson
Mit William Wilson nimmt die Bluray etwas Fahrt auf. Er beginnt mit einer Beichte, in der der Kadett William Wilson (Alain Delon) eine Predigt stürmt und sich angstschlotternd Gehör erzwingt. Hier erzählt er in kurzen Abrissen dem Priester die Geschichte seines Lebens.
William Wilson ist ein pathologischer Sadist. Seit seiner Schulzeit zieht er aus der Qual ihm ausgelieferter Mitmenschen kranke Gelüste. Seine sadistischen Aktionen werden jedoch immer kurz vor ihrem Höhepunkt von einer plötzlich auftretenden Person, die sich ebenfalls William Wilson nennt und ihm bis aufs Haar gleicht, unterbrochen. Im Kadettenalter betrügt er eine schöne Spielerin (Bridget Bardot) beim Pokern um ihren Gewinn und peitscht sie als Abgeltung ihres Schuldendienstes vor den Augen seiner Kameraden aus. Als Wilsons Lust sich steigert, taucht sein alter Ego wieder auf und verdirbt dem Psychopathen seinen Spass. Vor den Augen seiner Kameraden wird Willson als Falschspieler entlarvt, und als Konsequenz daraus unehrenhaft aus dem Kreis seiner Kameraden ausgeschlossen. Erzürnt von dieser Demütigung, entscheidet sich Wilson, seinen Doppelgänger aus der Welt zu schaffen, ahnend, daß er damit sein eigenes Schicksal besiegelt...
Regisseur Melle, der sich zum albtraumhaft-klaustrophobische n hingezogen fühlt, zieht hier in Punkto Spannung und Beklemmung schon deutlich die Schrauben an. Nicht zuletzt die eindringliche Kameraführung und die voyeuristische Unerbittlichkeit tragen zu dem unangenehmen Gefühl bei, die die Bilder erzeugen. Die Härte, die sich 1968 wohl an der Grenze des damals zumutbaren bewegte und nicht zuletzt die überzeugende schauspielerische Leistung Delons, der hier bereit war, sein positives Image zu konterkarieren, sind allemal 4 Punkte wert.
Psychologisch könnte man die die Geschichte als Abspaltung unerlaubter, sadistischer Triebe verstehen, die sozial als Böse gebrandmarkt und von der Guten Seite eingedämmt werden müßen, um gesellschaftlich nicht geächtet zu werden. Sinngemäß durfte das Dunkle ohne die kontrollierenden hellen Seelenattribute nicht überlebensfähig sein. So betrachtet erhält William Wilson auch eine theologisch-moralische Komponente.
Toby Dammit
Fellinis Toby Dammit bildet den Schluß- und Höhepunkt der Triologie und ist für sich genommen ein kleines verstörendes Meisterwerk.
Zeichnen sich die beiden ersten Beiträge noch durch unheimliche und übernatürliche Elemente aus und folgen dabei den Grundstrukturen frühromantischer Texte, geht Toby Dammit ganz eigene Wege und traut sich auf das Terrain des Experimentalfilmes vor. Fellinis Episode spielt in der Gegenwart und greift auf zeitgenößische Themen zurück. Toby Dammit ist ein in Ungnade gefallener amerikanischer Filmstar, der für seine Industrie nichts als Verschtung übrig hat. Zynismus und Alkoholsucht sind sein Markenzeichen geworden. Letzteres hat ihm in Hollywood nur Scherereien beschert und so begegnen wir Toby in einem italienischen Taxi, wo er mit seinen Produzenten die Bedingungen für seine neue Rolle in einem religiösen Western aushandelt. Die Produzenten befinden sich dabei auf ähnlich intellektuellen Höhenflügen wie die Protagonisten in Fellinis kontroversem Meisterstück 8 1/2. Der Spannungsbogen zwischen den auf der Metaebene philosophierenden Filmschaffenden und dem bissigen Spot des vom Alkohol zerfressenen Toby Dammit könnte größer kaum sein. Dammit weiß aus seinem dillirantem Seinszustand der Welt nur mit Spott und bissigem Sarkasmus zu begegnen. Alkoholbenebelt wie der Geist des Amerikaners ist auch die Inszenierung gestaltet. Die Bilder erzeugen eine rauschhaft entrückte, beinahe halluzinatorische Athmosphäre, in der die Welt als Inhaltslos und auf die bloße glitzernde Fassade reduziert, definiert wird. Dammit und die Bildsprache entfernen sich von der Ebene der reinen Venunft und flirten mit den Abgründen der Verrücktheit. Obwohl kaum gruselig, ist Fellinis Episode grausamer als seine beiden Vorgänger, da das Grauen des immerwährenden Wahnsinns als permanente Bedrohung über unseren Köpfen schwebt. Die Athmosphäre der betäubten Volltrunkenheit, in der die Welt nur noch fragmentarische Bedeutung besitzt, ist uns wohl allen bestens aus diversen adoleszenten Rauscherfahrungen in Erinnerung. Der Horror ergibt sich somit aus der unmittelbaren Nähe, des selbst erlebten Pseudowahnsinns zu dem Reich des entsetzlichen Kontrollverlustes. Er ist nur einen halben Schritt von unserer Ratio entfernt und unser ständiger Begleiter. Ein falscher Schritt und der Wahnsinn zerrt uns aus unserer sicher geglaubten Existenz.
Dammit hat die Ebene der Realität bereits verlassen. Körperlich noch im System präsent, fühlt er sich jedoch an die Welt (seinen Beruf) nicht mehr gebunden. Sein ganzes Ansinnen gilt nun einem Ferrari, in dem er sich einem letzten Rausch, aus dem es kein Entkommen mehr gibt, hingibt: Dem Rausch der Geschwindigkeit.
Der Rausch, dem süßen Engel, der Toby Erlösung verheißt, birgt jedoch den Teufel des Verfalles und der Vernichtung bereits in seinen Gefiedern.
In der letzten Scene ist dies grausam schön symbolisiert.
Fellinis Toby Dammit ist trotz seiner nur 45min nichts weniger als ein filmisches Meisterwerk, aufgeladen mit einer kaum zu überschaubaren Fülle von Metaphern und Symbolismus und einer vollrauschdurchtränkten Bildsprache, die den Zuschauer in den dumpf seeligen Zustand eines Narkotikers versetzt. Ein Film, der den Vergleich mit Jodorowskys frühen Meisterwerken nicht zu scheuen braucht, und, wer weiß, vielleicht hat die Idee des religiösen Westerns ja den Grundstein für El Topo gelegt...so oder so, für dieses seltene Juwel extravaganter Filmkunst wäre es ein unverzeihlicher Frevel, weniger als 5 Punkte zu geben.
mit 4
mit 3
mit 3
mit 1
bewertet am 14.06.18 um 10:51
Erste Gehversuche des hochbegabten Regisseurs Michael Cimino auf dem brüchigen Parkett Hollywoods. Aus der Werbebranche kommend und als Co-Autor von "Lautlos im Weltraum" bereits mit Lorbeeren geschmückt, vertraute Eastwoods Produktionsfirma dem Drehbuchautor von "Thundebolt and Lightfoot" auch sogleich die Verantwortung für die Regie an und er konzentrierte sich selber lieber auf die Produktion und Schauspielerei.
Eastwood, der selber immer gerne einen Roadmovie drehen wollte aber keine geeignete Rolle für sich fand, sah das Drehbuch Ciminos als Wink des Schicksals an und gab sofort grünes Licht für die Realisierung des Filmes.
Als Eastwoods Buddy wurde der aufkommende Stern der Schauspielergilde, Jeff Bridges, engagiert. Bridges hatte erst jüngst eine Oscarnominierung für "Die letzte Vorstellung" von Peter Bogdanovich erhalten und galt somit als qualifiziert genug, um neben dem sperrigen Star bestehen zu können.
Thunderbolt (Eastwood) und Lightfoot (Bridges) leben außerhalb der Gesellschaft. Sie sind Rumtreiber und halten nicht viel von Gesetz und dem Recht auf Privateigentum. 3...2...meins ist ihr Lebensmotto. So ist es auch folgerichtig, daß die beiden Taugenichtse während der Flucht vor ihren aufgebrachten Verfolgern aufeinander geworfen werden. Lightfoot hat gerade einen Autoverkäufer um seine Ware erleichtert und Thunderbolts Tarnung als Pfarrer ist während der heiligen Messe aufgeflogen. Kurz zuvor hatte er eine Bank überfallen und anscheinend seinen Arbeitskollegen ihre wohlverdiente Beute vorenthalten. Nun ist er auf der Flucht vor ihren nach Vergeltung suchenden Bleisalven, als er Lightfoot vor die Motothaube stolpert. Schutzsuchend hechtet er in dessen Auto und gemeinsam reisen die Outlaws erstmal gen Süden, um durchzuschnaufen.
Als der Jungspund Lightfoot erfährt, daß ihm ein legendären Bankräuber in sein Auto gestolpert ist, kennt seine Bewunderung keine Grenzen mehr und er buhlt um die Freundschaft des deutlich älteren, reiferen und vor allen Dingen auch kernigeren Thunderbolt. Der will jedoch von dem Greenhorn zuerst wenig wissen, rauft sich dann aber, zunächst aus taktischen Gründen, mit Lightfoot zusammen. So erlebt man gemeinsam eine Zeit von Freiheit, Abenteuer und Frauengeschichten, bevor zur Finanzierung des exklusiven Lebenstils neues Geld aquiriert werden muß. Thunderbolt erfüllt nun Lightfoots Wunsch und lobt ihn kurzerhand zu seinem neuen Schüler und Kollegen für den nächsten großen Coup aus: In knappen 7 Minuten soll ein schwer gesicherter Tresor geknackt, zerschoßen und geplündert werden. Passiert nur ein kleiner Fehler, endet die Unternehmung in den schmierigen Krallen der gehaßten Cops....
"Die letzten beißen die Hunde" von 1973 gehört zum Kanon der Roadmovies der frühen 70er Jahre. Die Flower Power Zeit war ausgeträumt, Charles Mansons Morde hatten die letzen Vibes der Hippieära zerfetzt, der Vietnamkrieg war vorbei und die Babys der Kinder des Sommers der Liebe wollten materiell versorgt sein. Die Mehrheit der 68er kämpfte nun mit dem Alltag und versklavte sich wieder an die Konzerne und ihr Kapital, um überleben zu können. Eine neue Zeit mit neuen Idealen war noch nicht geboren. Die Kommunen waren zerfallen oder zerstritten und die Freiheitssuchende mußten sich neue Lebensentwürfe selbst erschaffen. Weil die großen fernen Ziele aber fehlten, ließ man sich sinnentleert über die endlosen Highways des Südwesten der USA treiben und hoffte, die Erfüllung der Sehnsüchte hinter der nächsten Kurve oder im rot-orange schillernden Sonnenuntergang zu finden. So gleiten auch Thunderbolt und Lighfoot schwerelos in ihrer Limousine durch die Weiten der Prärien und genießen ihr bloßes Dasein im heißen Fahrtwind des Freeways. Mehr Freiheit ist nicht möglich.
Genau diese Stimmung von Freiheit, Freundschaft und Ungebundenheit ist es, die dem Genre seinerzeit zu seinem epochemachenden Erfolg verhalf. In Momenten der Erfüllung aller sozialen, körperlichen und seelischen Bedürfnisse, wird der perfekte Moment erschaffen. Untermauert wird das flüchtige Elysium durch sehnsuchtstriefende Countryballaden, welche durch den endlosen Himmel Montanas hallen und die Scene mit einer quasi religiösen Aura aufladen.
Paradiesgleich scheint man in diesem Zustand von allen irdischen Pflichten und Verpflichtungen enthoben und den Fesseln der bürgerlichen Existenz erlöst.
Aber das Paradies liegt bekanntlich nicht auf der Erde, sondern ein paar Meilen darüber. Und so muß man sich auch aus dem Himmel der Gefühle wieder mit den profanen Aspekten der Existenz auseinandersetzen. Jede Form der Selbstverwirklichung muß aber, gottverdammt, irgendwie finanziert werden. Und das geht auf illegalem Wege nur, wenn man die Offenheit des weiten Himmels verläßt und sich in die dunklen Nischen der niederen Subjekte begiebt. Wenn es um den Erwerb des Lebensunterhalt geht, und das ist sicherlich eine sozialkritische Komponente in dem Film, ist dies nur auf Kosten von Freiheit und Lebensentfaltung möglich. Geld bietet zwar Sicherheit, versklavt aber das Individuum und zerstört die nach Freiheit lechzende Seele. Thunderbolt und Lightfoot wissen das. Aber einmal das Gefühl genossen, kompromisslos ganz im Einklang mit sich selbst gewesen zu sein, gibt es für sie kein zurück mehr in ein zivilisiertes Leben...lieber Tod als Gefangen in der Welt der Konventionen und Befehlshierarchien...
Diese m klassischen Roadmoviethema schließt sich im letzten Drittel ein Heistmovie an, in dem Eastwood seine Klischees als harter Draufgänger noch einmal voll ausspielen kann und Bridges in Frauenkleidern für einige Schmunzler sorgt. Die harte Männerwelt, in der sich der einstige Westernheld bewegte wird so aufgebrochen und durch die kleine Camouflage seiner Albernheit und Künstlichkeit überführt.
Inwieweit der Film dadurch eine homoerotische Note besitzt, wie immer noch hitzig in cineastischen Zirkeln diskutiert wird, sei dahingestellt und die Erkenntniss darüber sind müßig. Für Filmkritiker mag das ein strittiges Thema für lange Kaminabende sein, der Genuss des Filmes erhält dadurch aber keinen neuen Spin. Augenscheinlich ist aber, daß Lightfoot Thunderbolt schon von Beginn an so innig umgarnt, wie ein verliebtes Girlie ihren großen Schwarm. Manchesmal beschleicht einen sogar das klamme Gefühl, er soll die Rolle einer Frau an der Seite Eastwoods ersetzen. Meine Theorie dazu ist, daß keine zusätzliche Frauenrolle mehr in den Drehplan paßte und Bridges wohl beide Rollen übernehmen mußte.
Stilistisch ist der Film auf Eastwoods rauhes Gemüt maßgeschneidert und gewöhnungsbedürftig holprig inszeniert. Man merkt durchgehend, daß Cimino das richtiges Timing noch nicht gefunden hatte und das Händchen für einen galanten Erzählfluß erst noch finden mußte. Im darauffolgenden "The deer hunter" perfektionierte er seinen Stil aber bereits. So aber reiht sich "Die letzten beißen die Hunde" nahtlos in die Reihe der 70er Legenden ein, dessen spröder Charme und ungeschliffene Erzählstruktur zum Markenzeichen der Dekade der ausufernden Lebensfreude wurde. Der Inhalt war damals eben noch wichtiger als die Form und dem Gehirn wurde mehr abverlangt als dem Auge.
Wie dem auch sei, es sind schon der Worte zuviel gefallen, für einen Film, der eigentlich bloß genossen und nicht zerredet und zerdenkt sein will...
Eastwood, der selber immer gerne einen Roadmovie drehen wollte aber keine geeignete Rolle für sich fand, sah das Drehbuch Ciminos als Wink des Schicksals an und gab sofort grünes Licht für die Realisierung des Filmes.
Als Eastwoods Buddy wurde der aufkommende Stern der Schauspielergilde, Jeff Bridges, engagiert. Bridges hatte erst jüngst eine Oscarnominierung für "Die letzte Vorstellung" von Peter Bogdanovich erhalten und galt somit als qualifiziert genug, um neben dem sperrigen Star bestehen zu können.
Thunderbolt (Eastwood) und Lightfoot (Bridges) leben außerhalb der Gesellschaft. Sie sind Rumtreiber und halten nicht viel von Gesetz und dem Recht auf Privateigentum. 3...2...meins ist ihr Lebensmotto. So ist es auch folgerichtig, daß die beiden Taugenichtse während der Flucht vor ihren aufgebrachten Verfolgern aufeinander geworfen werden. Lightfoot hat gerade einen Autoverkäufer um seine Ware erleichtert und Thunderbolts Tarnung als Pfarrer ist während der heiligen Messe aufgeflogen. Kurz zuvor hatte er eine Bank überfallen und anscheinend seinen Arbeitskollegen ihre wohlverdiente Beute vorenthalten. Nun ist er auf der Flucht vor ihren nach Vergeltung suchenden Bleisalven, als er Lightfoot vor die Motothaube stolpert. Schutzsuchend hechtet er in dessen Auto und gemeinsam reisen die Outlaws erstmal gen Süden, um durchzuschnaufen.
Als der Jungspund Lightfoot erfährt, daß ihm ein legendären Bankräuber in sein Auto gestolpert ist, kennt seine Bewunderung keine Grenzen mehr und er buhlt um die Freundschaft des deutlich älteren, reiferen und vor allen Dingen auch kernigeren Thunderbolt. Der will jedoch von dem Greenhorn zuerst wenig wissen, rauft sich dann aber, zunächst aus taktischen Gründen, mit Lightfoot zusammen. So erlebt man gemeinsam eine Zeit von Freiheit, Abenteuer und Frauengeschichten, bevor zur Finanzierung des exklusiven Lebenstils neues Geld aquiriert werden muß. Thunderbolt erfüllt nun Lightfoots Wunsch und lobt ihn kurzerhand zu seinem neuen Schüler und Kollegen für den nächsten großen Coup aus: In knappen 7 Minuten soll ein schwer gesicherter Tresor geknackt, zerschoßen und geplündert werden. Passiert nur ein kleiner Fehler, endet die Unternehmung in den schmierigen Krallen der gehaßten Cops....
"Die letzten beißen die Hunde" von 1973 gehört zum Kanon der Roadmovies der frühen 70er Jahre. Die Flower Power Zeit war ausgeträumt, Charles Mansons Morde hatten die letzen Vibes der Hippieära zerfetzt, der Vietnamkrieg war vorbei und die Babys der Kinder des Sommers der Liebe wollten materiell versorgt sein. Die Mehrheit der 68er kämpfte nun mit dem Alltag und versklavte sich wieder an die Konzerne und ihr Kapital, um überleben zu können. Eine neue Zeit mit neuen Idealen war noch nicht geboren. Die Kommunen waren zerfallen oder zerstritten und die Freiheitssuchende mußten sich neue Lebensentwürfe selbst erschaffen. Weil die großen fernen Ziele aber fehlten, ließ man sich sinnentleert über die endlosen Highways des Südwesten der USA treiben und hoffte, die Erfüllung der Sehnsüchte hinter der nächsten Kurve oder im rot-orange schillernden Sonnenuntergang zu finden. So gleiten auch Thunderbolt und Lighfoot schwerelos in ihrer Limousine durch die Weiten der Prärien und genießen ihr bloßes Dasein im heißen Fahrtwind des Freeways. Mehr Freiheit ist nicht möglich.
Genau diese Stimmung von Freiheit, Freundschaft und Ungebundenheit ist es, die dem Genre seinerzeit zu seinem epochemachenden Erfolg verhalf. In Momenten der Erfüllung aller sozialen, körperlichen und seelischen Bedürfnisse, wird der perfekte Moment erschaffen. Untermauert wird das flüchtige Elysium durch sehnsuchtstriefende Countryballaden, welche durch den endlosen Himmel Montanas hallen und die Scene mit einer quasi religiösen Aura aufladen.
Paradiesgleich scheint man in diesem Zustand von allen irdischen Pflichten und Verpflichtungen enthoben und den Fesseln der bürgerlichen Existenz erlöst.
Aber das Paradies liegt bekanntlich nicht auf der Erde, sondern ein paar Meilen darüber. Und so muß man sich auch aus dem Himmel der Gefühle wieder mit den profanen Aspekten der Existenz auseinandersetzen. Jede Form der Selbstverwirklichung muß aber, gottverdammt, irgendwie finanziert werden. Und das geht auf illegalem Wege nur, wenn man die Offenheit des weiten Himmels verläßt und sich in die dunklen Nischen der niederen Subjekte begiebt. Wenn es um den Erwerb des Lebensunterhalt geht, und das ist sicherlich eine sozialkritische Komponente in dem Film, ist dies nur auf Kosten von Freiheit und Lebensentfaltung möglich. Geld bietet zwar Sicherheit, versklavt aber das Individuum und zerstört die nach Freiheit lechzende Seele. Thunderbolt und Lightfoot wissen das. Aber einmal das Gefühl genossen, kompromisslos ganz im Einklang mit sich selbst gewesen zu sein, gibt es für sie kein zurück mehr in ein zivilisiertes Leben...lieber Tod als Gefangen in der Welt der Konventionen und Befehlshierarchien...
Diese m klassischen Roadmoviethema schließt sich im letzten Drittel ein Heistmovie an, in dem Eastwood seine Klischees als harter Draufgänger noch einmal voll ausspielen kann und Bridges in Frauenkleidern für einige Schmunzler sorgt. Die harte Männerwelt, in der sich der einstige Westernheld bewegte wird so aufgebrochen und durch die kleine Camouflage seiner Albernheit und Künstlichkeit überführt.
Inwieweit der Film dadurch eine homoerotische Note besitzt, wie immer noch hitzig in cineastischen Zirkeln diskutiert wird, sei dahingestellt und die Erkenntniss darüber sind müßig. Für Filmkritiker mag das ein strittiges Thema für lange Kaminabende sein, der Genuss des Filmes erhält dadurch aber keinen neuen Spin. Augenscheinlich ist aber, daß Lightfoot Thunderbolt schon von Beginn an so innig umgarnt, wie ein verliebtes Girlie ihren großen Schwarm. Manchesmal beschleicht einen sogar das klamme Gefühl, er soll die Rolle einer Frau an der Seite Eastwoods ersetzen. Meine Theorie dazu ist, daß keine zusätzliche Frauenrolle mehr in den Drehplan paßte und Bridges wohl beide Rollen übernehmen mußte.
Stilistisch ist der Film auf Eastwoods rauhes Gemüt maßgeschneidert und gewöhnungsbedürftig holprig inszeniert. Man merkt durchgehend, daß Cimino das richtiges Timing noch nicht gefunden hatte und das Händchen für einen galanten Erzählfluß erst noch finden mußte. Im darauffolgenden "The deer hunter" perfektionierte er seinen Stil aber bereits. So aber reiht sich "Die letzten beißen die Hunde" nahtlos in die Reihe der 70er Legenden ein, dessen spröder Charme und ungeschliffene Erzählstruktur zum Markenzeichen der Dekade der ausufernden Lebensfreude wurde. Der Inhalt war damals eben noch wichtiger als die Form und dem Gehirn wurde mehr abverlangt als dem Auge.
Wie dem auch sei, es sind schon der Worte zuviel gefallen, für einen Film, der eigentlich bloß genossen und nicht zerredet und zerdenkt sein will...
mit 4
mit 3
mit 3
mit 3
bewertet am 06.06.18 um 20:09
Wind, Abenteuer, Blei, Bratwurst und ein tolles Cover.
Vielmehr Analyse läßt sich auch beim besten Willen nicht aus dem Film rausquetschen. Substanz ist hier weitesgehendst Fehlanzeige.
Kidnapping, Versteck finden, befreien. Die Guten Juchee, die Bösen tot.
Eine handvoll verwegener Teufelskerle jagd mit ihren Drachen durch ein paar zufällig vor sich hindümpelnde Kalkfelsen, um die Gattin eines Industriemagnaten aus den Klauen militanter Ideotologen zu reißen, die sich in einem mittelalterlichen Kloster, hochoben auf einem Felsplateau, gleich einem Adlerhorst, verschanzt haben.
Um diese Idee herum wurde ein Filmlein gebastelt.
Der Film selbst ist in seiner Inszenierung aber sehr hölzern und eher unterkomplex. Ein bißchen wie die Winnetoufestspiele der Pfadfinder Jugendgruppe Bad Puffheim. James Coburn als gehörnter Gatte mit mysteriöser Vergangenheit, die im Dunkeln bleibt und ihn mit einer Aura des verruchten umnebeln soll, wirkt niedlich bis mitleiderregend, beschert den Film aber immerhin ein Eau de Fleur von Hollywood.
Sehenswert ist der Film am ehesten durch die Tatsache, daß der unbekümmerte, freie Geist der 70's durch die Bilder rauscht und in allen Aspekten des Filmes und der Protagonisten durchschimmert. Ein Spirit, auf den wir in heutigen Zeiten nur noch wehmütig zurückblicken können. Der heutigen Perfektion wurde das zwangslose Lebensgefühl einstiger, glorreicher Zeit auf dem Altar der kalten Funktionalität der zertifizierten Prozessoptimierung und systemkonformen Anpassungslangeweile geopfert.
Das Cover ist allerdings Klasse. Aber das hat ich schon. Und wie komm ich eigentlich nochmal auf die Bratwürste.......? Keine Ahnung mehr...War da nicht irgendwas mit Bratwürsten in den 70ern...?
Vielmehr Analyse läßt sich auch beim besten Willen nicht aus dem Film rausquetschen. Substanz ist hier weitesgehendst Fehlanzeige.
Kidnapping, Versteck finden, befreien. Die Guten Juchee, die Bösen tot.
Eine handvoll verwegener Teufelskerle jagd mit ihren Drachen durch ein paar zufällig vor sich hindümpelnde Kalkfelsen, um die Gattin eines Industriemagnaten aus den Klauen militanter Ideotologen zu reißen, die sich in einem mittelalterlichen Kloster, hochoben auf einem Felsplateau, gleich einem Adlerhorst, verschanzt haben.
Um diese Idee herum wurde ein Filmlein gebastelt.
Der Film selbst ist in seiner Inszenierung aber sehr hölzern und eher unterkomplex. Ein bißchen wie die Winnetoufestspiele der Pfadfinder Jugendgruppe Bad Puffheim. James Coburn als gehörnter Gatte mit mysteriöser Vergangenheit, die im Dunkeln bleibt und ihn mit einer Aura des verruchten umnebeln soll, wirkt niedlich bis mitleiderregend, beschert den Film aber immerhin ein Eau de Fleur von Hollywood.
Sehenswert ist der Film am ehesten durch die Tatsache, daß der unbekümmerte, freie Geist der 70's durch die Bilder rauscht und in allen Aspekten des Filmes und der Protagonisten durchschimmert. Ein Spirit, auf den wir in heutigen Zeiten nur noch wehmütig zurückblicken können. Der heutigen Perfektion wurde das zwangslose Lebensgefühl einstiger, glorreicher Zeit auf dem Altar der kalten Funktionalität der zertifizierten Prozessoptimierung und systemkonformen Anpassungslangeweile geopfert.
Das Cover ist allerdings Klasse. Aber das hat ich schon. Und wie komm ich eigentlich nochmal auf die Bratwürste.......? Keine Ahnung mehr...War da nicht irgendwas mit Bratwürsten in den 70ern...?
mit 3
mit 3
mit 3
mit 2
bewertet am 28.05.18 um 19:44
Düsteres Epos des tragischen Nordmannes, dessen Heldentum an der Schönheit eines Dämons zerbricht.
Obwohl mittlerweile 10 Jahre auf dem Buckel, imponiert die Detailgeanauigkeit und Lebendigkeit der Charaktere noch Heute, auch wenn es ihnen gewiß am letzten Quäntchen Filigranität mangelt und marionettenartig hölzerne Bewgungsästhetik zu Abzügen in der B Note führt.
Wie kaum ein zweiter Regisseur setzt Zemeckis voll auf die Vorzüge der dritten Dimension. Wo andere einfach einen normalen Film in 3D drehen und sich mit einem gewißen Plus an Räumlichkeit zufrieden geben, experimentiert Zemeckis spielfreudig mit den Gimmicks, die der Mehrwert der räumlichen Tiefendarstellung bietet.
Ob Drachenritte im Tiefflug durch die Wälder, in die Lüfte springende Meeresungeheuer, tiefe Schluchten, durch die Räume schwirrende Waffen oder bloß einfach spektakuläre Kameraperspektiven und Landschaftsaufnahmen: Mit viel Gespür für unheilvolle Monster, experimentellen Kameraeinstellungen, glaubwürdigen Legendencharakteren und packendes Storytelling ist Zemeckis ein Fantasy Meisterwerk der visuellen Extraklasse gelungen, dessen entsprechende Huldigung bis Heute ausgeblieben ist.
Das mit der gehäuteten Mißgeburt Grendel dabei eines unappetitlichsten Filmmonster überhaupt gelungen ist, ist dabei mehr als bloß lobenswerte Nebensache. Wenn der fleischige Riesenkrüppel jedesmal seine Contenance verliert, sobald aus dem nordischem Gesindehaus, dem legitimen Vorläufer unseres heutigen Musikantenstadls, geringste Anzeichen zünftiger Volksmusik an sein außen liegendes, hochempfindliches Trommelfell dringen, pulsiert jedes Splatterherz im Anschlag. Denn hat Grendel erst einmal Fahrt aufgenommen, zerreißt er Leiber im Sekundentakt und zerschmatzt Köpfe wie Pralinen.
Auch wenn die Schlagermusikallegie plausibel und nachvollziehbar ist, ist es die FSK 12 Freigabe nicht. Sie wird dabei bei gewagten Scenen regelmäßig nach oben hin durchbrochen.
Erwähnenswert ist hier auch die Tatsache, daß Beowolf hier in der ca. 2min. kürzeren Kinofaßung vorliegt.
Der Director's cut wäre für FSK 12 wohl definitiv zu splatterig, wenn Grendel zur Schlachtplatte bittet...
Die 3D Aufbereitung ist jedoch eine riesige Enttäuschung. Ich mußte auf meinem Beamer die Tiefenschärfe fast permanent nachregeln, um den gewünschten Effekt zu haben, bzw. Doppelkonturen zu vermeiden. Ob dies an meinem technischen Equipment liegt, vermag ich nicht zu sagen, da ich keine Vergleichsmöglichkeiten habe. Ständig an der Fernbedienung rumzufummeln wie ein 15 jähriger beim ersten Petting, kann auf jeden Fall nicht Sinn der Sache sein und macht die abnehmende Begeisterung für 3D Blurays verständlich.
Ist der Bildwerfer jedoch ersteinmal passend justiert, macht Beowulf in der dritten Dimension doppelt und dreifach Laune und entfaltet erst hier seine ganze dunkle konzeptionelle und künstlerische Wucht.
Obwohl mittlerweile 10 Jahre auf dem Buckel, imponiert die Detailgeanauigkeit und Lebendigkeit der Charaktere noch Heute, auch wenn es ihnen gewiß am letzten Quäntchen Filigranität mangelt und marionettenartig hölzerne Bewgungsästhetik zu Abzügen in der B Note führt.
Wie kaum ein zweiter Regisseur setzt Zemeckis voll auf die Vorzüge der dritten Dimension. Wo andere einfach einen normalen Film in 3D drehen und sich mit einem gewißen Plus an Räumlichkeit zufrieden geben, experimentiert Zemeckis spielfreudig mit den Gimmicks, die der Mehrwert der räumlichen Tiefendarstellung bietet.
Ob Drachenritte im Tiefflug durch die Wälder, in die Lüfte springende Meeresungeheuer, tiefe Schluchten, durch die Räume schwirrende Waffen oder bloß einfach spektakuläre Kameraperspektiven und Landschaftsaufnahmen: Mit viel Gespür für unheilvolle Monster, experimentellen Kameraeinstellungen, glaubwürdigen Legendencharakteren und packendes Storytelling ist Zemeckis ein Fantasy Meisterwerk der visuellen Extraklasse gelungen, dessen entsprechende Huldigung bis Heute ausgeblieben ist.
Das mit der gehäuteten Mißgeburt Grendel dabei eines unappetitlichsten Filmmonster überhaupt gelungen ist, ist dabei mehr als bloß lobenswerte Nebensache. Wenn der fleischige Riesenkrüppel jedesmal seine Contenance verliert, sobald aus dem nordischem Gesindehaus, dem legitimen Vorläufer unseres heutigen Musikantenstadls, geringste Anzeichen zünftiger Volksmusik an sein außen liegendes, hochempfindliches Trommelfell dringen, pulsiert jedes Splatterherz im Anschlag. Denn hat Grendel erst einmal Fahrt aufgenommen, zerreißt er Leiber im Sekundentakt und zerschmatzt Köpfe wie Pralinen.
Auch wenn die Schlagermusikallegie plausibel und nachvollziehbar ist, ist es die FSK 12 Freigabe nicht. Sie wird dabei bei gewagten Scenen regelmäßig nach oben hin durchbrochen.
Erwähnenswert ist hier auch die Tatsache, daß Beowolf hier in der ca. 2min. kürzeren Kinofaßung vorliegt.
Der Director's cut wäre für FSK 12 wohl definitiv zu splatterig, wenn Grendel zur Schlachtplatte bittet...
Die 3D Aufbereitung ist jedoch eine riesige Enttäuschung. Ich mußte auf meinem Beamer die Tiefenschärfe fast permanent nachregeln, um den gewünschten Effekt zu haben, bzw. Doppelkonturen zu vermeiden. Ob dies an meinem technischen Equipment liegt, vermag ich nicht zu sagen, da ich keine Vergleichsmöglichkeiten habe. Ständig an der Fernbedienung rumzufummeln wie ein 15 jähriger beim ersten Petting, kann auf jeden Fall nicht Sinn der Sache sein und macht die abnehmende Begeisterung für 3D Blurays verständlich.
Ist der Bildwerfer jedoch ersteinmal passend justiert, macht Beowulf in der dritten Dimension doppelt und dreifach Laune und entfaltet erst hier seine ganze dunkle konzeptionelle und künstlerische Wucht.
mit 5
mit 5
mit 4
mit 3
bewertet am 23.05.18 um 18:30
Vorsicht: Wo John le Carree draufsteht, könnte auch John le Carree drin sein!
Für die einen mag Dame, König, As, Spion ein mit Finessen gespicktes Katz- und Mausspiel auf höchstem intellektuellem Niveau sein, eine Hymne auf die leisen Zwischentöne und ein mit pikanten Bonmots gespicktes Füllhorn subtiler Andeutungen. Für mich war es die größte Schlaftablette aller Zeiten.
Schauspielern geschlagene 150min in miefigen Büros und Hinterzimmern beim Nachdenken, Brilleputzen und Uhren stellen zuzuschauen mag für Freunde der gepflegten Pantomime höchste Glückseligkeit bedeuten. Für Leute mit minimalem Unterhaltungsanspruch dagegen, ist es der reinste Holocaust.
Bei derart spannungsarmer Kost wird selbst das Filmbier in nullkommanix noch vor dem Öffnen in der Buddel schal und die Chips schmecken nach verwelkter Friedhofsprimel. Da verkriecht sich selbst das geduldige Ungeziefer rasselnd in die tiefsten Ritzen meines Dachgebälks und hält sich mit seinen sechs Händen seine neun Augen zu um dem Todesgriff der sich im Raum ausbreitenden Langeweile zu entkommen.
OK. Die Schauspieler sind allesamt a la bonne heure und die Athmosphäre hat einen gewißen (spröden) Charme. Das darf aber allerhöchstens unterstützende Funktion haben und nicht alleiniger Selbstzweck sein.
Ob der Thriller (lach) an sich plausibel ist? Keine Ahnung. Irgendwann sind einem die kryptischen Andeutungen und doppelbödigen Halbsätze auch einfach nur egal und man hofft, daß einem am Ende die gute Fee erklärt, worum es überhaupt geht. Aber Fehlanzeige. Anscheinend muß man tatsächlich den alle 20min stattfindenen Dialogfragmenten wohl doch zuhören und sich so sein Netz aus den dürftigen Informationen höchstselbst zusammenspinnen. Mir zumindest ist dies nicht gelungen und ich verspüre auch nicht das allergeringste Interesse, dies im 21Jht ohne Androhung von roher Gewalt gegenüber meiner Person oder unschuldiger Katzenbabys nachzuholen.
Ich befürchte allerdings, daß sich diese Antipode des Popcornkinos auf Grund seiner unaufgeregten Schläfrigkeit zur Arthouse Legende mausern wird. So beginnt Geschichtsverklitterung...
Für die einen mag Dame, König, As, Spion ein mit Finessen gespicktes Katz- und Mausspiel auf höchstem intellektuellem Niveau sein, eine Hymne auf die leisen Zwischentöne und ein mit pikanten Bonmots gespicktes Füllhorn subtiler Andeutungen. Für mich war es die größte Schlaftablette aller Zeiten.
Schauspielern geschlagene 150min in miefigen Büros und Hinterzimmern beim Nachdenken, Brilleputzen und Uhren stellen zuzuschauen mag für Freunde der gepflegten Pantomime höchste Glückseligkeit bedeuten. Für Leute mit minimalem Unterhaltungsanspruch dagegen, ist es der reinste Holocaust.
Bei derart spannungsarmer Kost wird selbst das Filmbier in nullkommanix noch vor dem Öffnen in der Buddel schal und die Chips schmecken nach verwelkter Friedhofsprimel. Da verkriecht sich selbst das geduldige Ungeziefer rasselnd in die tiefsten Ritzen meines Dachgebälks und hält sich mit seinen sechs Händen seine neun Augen zu um dem Todesgriff der sich im Raum ausbreitenden Langeweile zu entkommen.
OK. Die Schauspieler sind allesamt a la bonne heure und die Athmosphäre hat einen gewißen (spröden) Charme. Das darf aber allerhöchstens unterstützende Funktion haben und nicht alleiniger Selbstzweck sein.
Ob der Thriller (lach) an sich plausibel ist? Keine Ahnung. Irgendwann sind einem die kryptischen Andeutungen und doppelbödigen Halbsätze auch einfach nur egal und man hofft, daß einem am Ende die gute Fee erklärt, worum es überhaupt geht. Aber Fehlanzeige. Anscheinend muß man tatsächlich den alle 20min stattfindenen Dialogfragmenten wohl doch zuhören und sich so sein Netz aus den dürftigen Informationen höchstselbst zusammenspinnen. Mir zumindest ist dies nicht gelungen und ich verspüre auch nicht das allergeringste Interesse, dies im 21Jht ohne Androhung von roher Gewalt gegenüber meiner Person oder unschuldiger Katzenbabys nachzuholen.
Ich befürchte allerdings, daß sich diese Antipode des Popcornkinos auf Grund seiner unaufgeregten Schläfrigkeit zur Arthouse Legende mausern wird. So beginnt Geschichtsverklitterung...
mit 1
mit 4
mit 3
mit 2
bewertet am 23.05.18 um 18:27
Geostorm ist eine zeitlose Hymne auf die Blödheit, ein Jahrhundertunsinn, eine Hommage an die klinische Idiotie.
Wer einen spannenden Öko-/Umweltthriller erwartet hat, wird hier eine Enttäuschung erleben, von der er sich zu Lebzeiten nicht mehr erholt. Die Dialoge und die Handlung sind auf einem so unterirdisch niedrigen Niveau angesiedelt, daß man sich unweigerlich die Frage stellt, ob das Drehbuch von einem Menschen oder im dunkeln von einem besoffenen Schimpansen mit Geschmacksverkalkung geschrieben wurde.
Der Ehrenplatz von Star Crash auf dem Trash Tron ist jedenfalls ernster Bedrohung. Eingeweihte wissen, was das heißt. Die Beleidigungen des Verstandes durch das dadaistische Drehbuch sind sogar so gravierend, daß sie schon juristische Relevanz besitzen.
Ob ich allerdings wirklich eine Anzeige erstatte, überleg ich mir noch. Es könnte durchaus sein, daß der ganze Film bloß als Parodie gedacht ist und ichs nur nicht geschnallt hab. Die letzten 5 min sind nämlich derart hohl, daß sich eine seriöse Besprechung des Filmes eigentlich verbietet.
Zur "Handlung"
Die Erde ist von einem Sattelitennetz, welches das Wetter kontrolliert, umspannt. Zwei Wochen, bevor die sich im Orbit befindliche amerikanische Kontrollstation des Netzes der internationalen Gemeinschaft zugänglich gemacht werden soll, spielt die Station verrückt: Auf der Erde werden lokal begrenzte Klimakatastrophen ausgelöst, im Weltall sterben Wissenschaftler. Zufall oder Sabotage?
Der Erbauer der Raumstation, Jake -einst in Ungnade gefallen, da er die Erde mit seiner Sattelitenanlage eigenmächtig vor einem Umweltdisaster bewahrt hatte-, erhält die Chance zur Rehabilitation, in dem er auf der Raumstation nach den Ursachen der Fehlfunktionen forschen soll. Da kommt er einem mörderischen Komplott auf die Spur: Der Zentralcomputer von "Dutch Boy" (so der Name der Raumstation), ist von einem Virus infiziert, der eine Klimakatastrophe von biblischen Ausmaßen heraufbeschwören soll; Den GEOSTORM.
Wird es Jake gelingen, das Unwetter in letzter Sekunde zu verhindern? Steckt sogar der Präsident höchst selber hinter dem Komplott? Und am allerwichtigsten: Hält Jake sein Versprechen, daß er seinen süßen Nichte gegeben hat und kehrt wieder unversehrt auf die Erde zurück, um sie fest in seine Heldenarme zu schließen?
Antworten auf all diese belanglosen Fragen und noch viel mehr, erhält jeder Zuschauer, der den Mut aufbringt, sich in unerforschte und grenzdebile Filmlandschaften vorzuwagen.
Aber abgesehen von der unverschämt dümmlichen Story, die sich in Windeseile einen Ehrenplatz in der B-Movie Fangemeinde erobern wird, da bin ich mir sicher, gibt es doch auch einige Lichtblicke. Es sind allerdings nicht die spärlichen und x-mal gesehenen Unwettereffekte, wie man meinen könnte, sondern die Weltraumscenen der Sattelitenstation. Hier, und nur hier, erwacht der 3D Effekt zur vollen Pracht. Hier ist das Bild knackescharf, und der Törn durch die Weiten des Alls macht so richtig Fetz. Die restlichen, dilletantisch konvertierten 3D Scenen allerdings sind eine Frechheit ohne Ende und werfen einen langen, dunklen Schatten auf das gesamte Silicon Valley und seine Technikjünger. Kopfschmerzen sind bei den schmierig gestaffelten Tiefenebenen garantiert und ein Blister Paracetamol sollte immer griffbereit in Nähe liegen, um die Auswirkungen des Betruges am Auge zu kompensieren. Die lächerliche 2D/3D Konvertierungstaste meiner gammeligen Fernbedienung liefert eindeutig erquicklichere Resultate.
Da sich der Film visuell im Grunde aber auf der Höhe der Zeit befindet, auf diesem Gebiet sogar ansatzweise Blockbusterambitionen besitzt und bloß in erster Linie das Niveaulevel unter dem Grund des Marianegrabens rumkrabst, besitzt er doch genau den gewißen Zweikomponentenmix aus Faszination und Abscheu, der benötigt wird, um sich langsam aber unaufhaltsam den Weg in den Trash Olymp emporzuarbeiten. Denn dort gebührt Geostorm auf ewig ein Ehrenplatz unter seinen vielen rühmeswürdigen Schlefaz Kumpels.
Wer einen spannenden Öko-/Umweltthriller erwartet hat, wird hier eine Enttäuschung erleben, von der er sich zu Lebzeiten nicht mehr erholt. Die Dialoge und die Handlung sind auf einem so unterirdisch niedrigen Niveau angesiedelt, daß man sich unweigerlich die Frage stellt, ob das Drehbuch von einem Menschen oder im dunkeln von einem besoffenen Schimpansen mit Geschmacksverkalkung geschrieben wurde.
Der Ehrenplatz von Star Crash auf dem Trash Tron ist jedenfalls ernster Bedrohung. Eingeweihte wissen, was das heißt. Die Beleidigungen des Verstandes durch das dadaistische Drehbuch sind sogar so gravierend, daß sie schon juristische Relevanz besitzen.
Ob ich allerdings wirklich eine Anzeige erstatte, überleg ich mir noch. Es könnte durchaus sein, daß der ganze Film bloß als Parodie gedacht ist und ichs nur nicht geschnallt hab. Die letzten 5 min sind nämlich derart hohl, daß sich eine seriöse Besprechung des Filmes eigentlich verbietet.
Zur "Handlung"
Die Erde ist von einem Sattelitennetz, welches das Wetter kontrolliert, umspannt. Zwei Wochen, bevor die sich im Orbit befindliche amerikanische Kontrollstation des Netzes der internationalen Gemeinschaft zugänglich gemacht werden soll, spielt die Station verrückt: Auf der Erde werden lokal begrenzte Klimakatastrophen ausgelöst, im Weltall sterben Wissenschaftler. Zufall oder Sabotage?
Der Erbauer der Raumstation, Jake -einst in Ungnade gefallen, da er die Erde mit seiner Sattelitenanlage eigenmächtig vor einem Umweltdisaster bewahrt hatte-, erhält die Chance zur Rehabilitation, in dem er auf der Raumstation nach den Ursachen der Fehlfunktionen forschen soll. Da kommt er einem mörderischen Komplott auf die Spur: Der Zentralcomputer von "Dutch Boy" (so der Name der Raumstation), ist von einem Virus infiziert, der eine Klimakatastrophe von biblischen Ausmaßen heraufbeschwören soll; Den GEOSTORM.
Wird es Jake gelingen, das Unwetter in letzter Sekunde zu verhindern? Steckt sogar der Präsident höchst selber hinter dem Komplott? Und am allerwichtigsten: Hält Jake sein Versprechen, daß er seinen süßen Nichte gegeben hat und kehrt wieder unversehrt auf die Erde zurück, um sie fest in seine Heldenarme zu schließen?
Antworten auf all diese belanglosen Fragen und noch viel mehr, erhält jeder Zuschauer, der den Mut aufbringt, sich in unerforschte und grenzdebile Filmlandschaften vorzuwagen.
Aber abgesehen von der unverschämt dümmlichen Story, die sich in Windeseile einen Ehrenplatz in der B-Movie Fangemeinde erobern wird, da bin ich mir sicher, gibt es doch auch einige Lichtblicke. Es sind allerdings nicht die spärlichen und x-mal gesehenen Unwettereffekte, wie man meinen könnte, sondern die Weltraumscenen der Sattelitenstation. Hier, und nur hier, erwacht der 3D Effekt zur vollen Pracht. Hier ist das Bild knackescharf, und der Törn durch die Weiten des Alls macht so richtig Fetz. Die restlichen, dilletantisch konvertierten 3D Scenen allerdings sind eine Frechheit ohne Ende und werfen einen langen, dunklen Schatten auf das gesamte Silicon Valley und seine Technikjünger. Kopfschmerzen sind bei den schmierig gestaffelten Tiefenebenen garantiert und ein Blister Paracetamol sollte immer griffbereit in Nähe liegen, um die Auswirkungen des Betruges am Auge zu kompensieren. Die lächerliche 2D/3D Konvertierungstaste meiner gammeligen Fernbedienung liefert eindeutig erquicklichere Resultate.
Da sich der Film visuell im Grunde aber auf der Höhe der Zeit befindet, auf diesem Gebiet sogar ansatzweise Blockbusterambitionen besitzt und bloß in erster Linie das Niveaulevel unter dem Grund des Marianegrabens rumkrabst, besitzt er doch genau den gewißen Zweikomponentenmix aus Faszination und Abscheu, der benötigt wird, um sich langsam aber unaufhaltsam den Weg in den Trash Olymp emporzuarbeiten. Denn dort gebührt Geostorm auf ewig ein Ehrenplatz unter seinen vielen rühmeswürdigen Schlefaz Kumpels.
mit 2
mit 4
mit 4
mit 2
bewertet am 07.05.18 um 16:53
Scharlize Theron hat in 5 harten entbehrungsreichen Jahren einen hochkomplexen Charakter entwickelt, der vor allen Dingen eine Funktion erfüllt: die totale Selbstdarstellung !
Hinter der Selbstbeweihräucherung der Hauptdarstellerin und Mitproduzentin Scharlize Theron tritt die britische Agentin Lorraine Brogthon und ihre Mission, einen Mikrofilm mit Klarnamen von Spionen, einem russischen Widersacher im Berlin der Wendezeit abzufuchsen, in den Hintergrund. Statt sich auf eine spannende Hetzjagd im Herzen der wummernden Sattelitenstadt zu fokussieren, spielt sich Scharlize penetrant in den Vordergrund, wobei sie anscheinend der Meinung ist, ständig mit ihren körperlichen Vorzügen kokettieren zu müßen.
So wird auch der natürliche Erzählfluß immer wieder empfindlich gestört, da hauptsächlich gepost statt geschauspielert wird. Im Bad der darstellerischen Selbstherrlichkeit droht die erzählerische Finesse jämmerlich am klebrigen Sud ihres Egomanentums zu ersticken.
Zur Handlung:
Im Hauptquartier des MI:6 steht Scharlize im geschundenen Alabasterleib den Chefs des Geheimdienstes Rede und Antwort. Was ist in Berlin passiert und wo ist der Mikrofilm? Alternierend in Interviewfetzen und Rückblenden erinnert sich Scharlize an ihren Einsatz im brodelnden Berlin. Dubiose Mittelsmänner, schmierige Informanten, geheimnisvolle Frauenzimmer und eine brutale Russenmafia kreuzen die Ermittlungsarbeiten der Ausnahmeagentin. Die Berlinsequenzen folgen dabei trauriger Weise immer derselben stupiden Erzählstruktur: Scharlize ermittelt, gerät dabei Schritt für Schritt tiefer in den Strudel aus Doppelmoral und Intrigen und elimiert am Ende der Rückblenden irgendwelche zufällig ins Bild polternden Fieslinge auf die gute alte handwerkliche Weise: Mit Faust und Waffe.
Das versäumt wurde, die ermüdenden Wiederholungen durch die dramatischen politischen Ereignisse energetisch aufzupeppen, um den Zuschauer in die turbulente Zeitenwende hineinzusaugen und ihn an die Geschichte zu fesseln, ist sträflich zu nennen. Ein bißchen Doktor Schiwago Flair hätte Atomic Blonde gut zu Gesicht gestanden. Stattdessen bleibt es bei sebstreferentiellen Demonstrationskulissen, die nur peripher ins Geschehen eingeflochten und visueller Beifang sind. Hier wurden Chancen vertan.
Auch wenn die Substanzlosigkeit den anspruchsvollen Zuschauer am ausgestrecktem Arm verhungern läßt, war die deutsche Filmindustrie natürlich hin und weg vor Begeisterung. Halt wie immer, wenn es ums dritte Reich oder Wiedervereingung geht.
An der Qualität des Filmes hat es sicherlich nicht gelegen, daß er das Prädikat "besonders wertvoll" verliehen bekommen hat.
Scharlize Therons heuchlerische Emazipationsleistung, ein weibliches Pendant zu Jason Bourne, John Wick, James Bond, etc...zu etablieren, ist aus den genannten Gründen somit kläglich gescheitert. Hätte Theron ihr Ego und ihren Selbsdarstellungsdrang zugunsten einer spannenden Agentenstory gedrosselt, der Geschichte mehr Raum zur Entfaltung und Akzentuierung auf die weibliche Komponenten gelegt, statt ihre männlichen Vorbilder zu kopieren, hätte Atomic Blonde vielleicht der Startschuß zu einem neuen Franchise werden können.
So aber wirkt die mit Erotikscenen und digitalen Blutspritzern aufgepimpte Comicadaption verzweifelt um Aufmerksamkeit bemüht und kann weder mit der Musikauswahl (unpassende NDW Songs), bemühter stilistischer coolness noch mit schablonenhaften Charakteren punkten. Mission failed...
Hinter der Selbstbeweihräucherung der Hauptdarstellerin und Mitproduzentin Scharlize Theron tritt die britische Agentin Lorraine Brogthon und ihre Mission, einen Mikrofilm mit Klarnamen von Spionen, einem russischen Widersacher im Berlin der Wendezeit abzufuchsen, in den Hintergrund. Statt sich auf eine spannende Hetzjagd im Herzen der wummernden Sattelitenstadt zu fokussieren, spielt sich Scharlize penetrant in den Vordergrund, wobei sie anscheinend der Meinung ist, ständig mit ihren körperlichen Vorzügen kokettieren zu müßen.
So wird auch der natürliche Erzählfluß immer wieder empfindlich gestört, da hauptsächlich gepost statt geschauspielert wird. Im Bad der darstellerischen Selbstherrlichkeit droht die erzählerische Finesse jämmerlich am klebrigen Sud ihres Egomanentums zu ersticken.
Zur Handlung:
Im Hauptquartier des MI:6 steht Scharlize im geschundenen Alabasterleib den Chefs des Geheimdienstes Rede und Antwort. Was ist in Berlin passiert und wo ist der Mikrofilm? Alternierend in Interviewfetzen und Rückblenden erinnert sich Scharlize an ihren Einsatz im brodelnden Berlin. Dubiose Mittelsmänner, schmierige Informanten, geheimnisvolle Frauenzimmer und eine brutale Russenmafia kreuzen die Ermittlungsarbeiten der Ausnahmeagentin. Die Berlinsequenzen folgen dabei trauriger Weise immer derselben stupiden Erzählstruktur: Scharlize ermittelt, gerät dabei Schritt für Schritt tiefer in den Strudel aus Doppelmoral und Intrigen und elimiert am Ende der Rückblenden irgendwelche zufällig ins Bild polternden Fieslinge auf die gute alte handwerkliche Weise: Mit Faust und Waffe.
Das versäumt wurde, die ermüdenden Wiederholungen durch die dramatischen politischen Ereignisse energetisch aufzupeppen, um den Zuschauer in die turbulente Zeitenwende hineinzusaugen und ihn an die Geschichte zu fesseln, ist sträflich zu nennen. Ein bißchen Doktor Schiwago Flair hätte Atomic Blonde gut zu Gesicht gestanden. Stattdessen bleibt es bei sebstreferentiellen Demonstrationskulissen, die nur peripher ins Geschehen eingeflochten und visueller Beifang sind. Hier wurden Chancen vertan.
Auch wenn die Substanzlosigkeit den anspruchsvollen Zuschauer am ausgestrecktem Arm verhungern läßt, war die deutsche Filmindustrie natürlich hin und weg vor Begeisterung. Halt wie immer, wenn es ums dritte Reich oder Wiedervereingung geht.
An der Qualität des Filmes hat es sicherlich nicht gelegen, daß er das Prädikat "besonders wertvoll" verliehen bekommen hat.
Scharlize Therons heuchlerische Emazipationsleistung, ein weibliches Pendant zu Jason Bourne, John Wick, James Bond, etc...zu etablieren, ist aus den genannten Gründen somit kläglich gescheitert. Hätte Theron ihr Ego und ihren Selbsdarstellungsdrang zugunsten einer spannenden Agentenstory gedrosselt, der Geschichte mehr Raum zur Entfaltung und Akzentuierung auf die weibliche Komponenten gelegt, statt ihre männlichen Vorbilder zu kopieren, hätte Atomic Blonde vielleicht der Startschuß zu einem neuen Franchise werden können.
So aber wirkt die mit Erotikscenen und digitalen Blutspritzern aufgepimpte Comicadaption verzweifelt um Aufmerksamkeit bemüht und kann weder mit der Musikauswahl (unpassende NDW Songs), bemühter stilistischer coolness noch mit schablonenhaften Charakteren punkten. Mission failed...
mit 2
mit 4
mit 4
mit 2
bewertet am 07.05.18 um 16:37
Ein Punkt für die Musik. Ein Punkt für die sympathische Grundidee. Nullkommanull Punkte für die unverschämte Umsetzung.
Obwohl die Optik und die Schauspielerriege auf eine höherpreisige Produktion schließen laßen, ist der Film ein Rohrkrepierer und verfehlt sein Ziel, das Lebensgefühl der 60's zu reanimieren, um Lichtjahre.
1966, als die moderne Rock- und Popmusik, eine ganze Generation aus dem Dornröschenschlaf der biederen Spießigkeit ihrer Eltern und dem Muff der 50er Jahre wachzuküssen bagann, begibt sich eine handvoll Revoluzer und Außenseiter auf ein marodes Schiff vor die Küste des vereinigten Königreiches und beglückt von dort aus Land und Leute mit ihrer subversiven Musik. Die etablierten Sender wie die BBC vermuten in der modernen Musik die Zersetzung der britischen Kultur und verweigern sich der Ausstrahlung der Teufelsdisharmonien. Die Piratensender sind daher so etwas wie die verwegenen Vorkämpfer für die Entfesselung unterdrückter Volkstriebe und Katalysator der kreativen Entfaltung des Individuums.
Alles könnte wunderbar seine geregelten Bahnen nehmen, wäre da nicht ein erzkonserativer Minister, dem jede Form von enthemmten Vergnügen ein Dorn im Auge ist und der mit allen Mitteln seiner Macht die privaten Radio Stationen zum Schweigen bringen will... soweit und soweit auch OK.
Was dem Film aber den Gnadenstoß versetzt, könnte man am besten mit dem Wort "Pseudo" umschreiben, denn an dem Film ist alles Pseudo: Die Crew an Bord des Schifffes ist pseodocool, pseudohip und nur pseudofreakig. Ebenso ist der erzkonserative Minister einfach nur unglaubwürdig bescheuert und so simpel schablonenhaft verstockt, daß es wehtut.
Dreht man aber einen Film über die späten 60er, dann muß alles authentisch wirken und darf nicht die weichgespülte Variation aus der Retorte sein. Selbst die gesamte ach so hippe Crew ist in keinster weise cool. Es sind die Feel Good Movie Clone echter charismatischer Freaks und Revolutionäre. Statt mit trockenem englischen Humor zu punkten, setzt Regisseur Richard Curtis auf Pseudofrivolitäten aus der Eis am Stil Mottenkiste, die zu keiner Zeit lustig sind. Pubertäre Zoten, statt niveauvolle Unterhaltung. Für Teenies mögen die Abziehbilder echter Individualisten noch einen gewißen Reiz haben und der peinlich dümmlich überzeichnete Minister noch als Projektionsfläche für die eigenen ungeliebten Erziehungsberechtigten oder Sonderpädagogen dienen, jeder anständige Mitbürger versinkt dabei in betretenes Fremdschämen.
Ebenso wie die Witzeleien an Bord flach sind, sind die Dialoge platt. Immer wenn es ruhig und gestelzt besinnlich wird, vermeintliche Lebensweisheiten präsentiert werden und der Film anTiefe gewinnen möchte, entlarvt sich der Radio Rock Revolution als einziger Schiß in den Ofen. Banalste Lebensplattitüden ersetzen profunde bewußtseinserweiternde Erkenntnisse, gerne auch aus dem asiatischen Kulturkreis, wie es damals Gang und Gäbe war.
Statt dem Film eine Portion Zeitkollorit zu spendieren, biedert sich RRR dem Zuschauer mit aalglatten schablonenhaften Charakteren an, die mit echten Hippies so viel zu tun haben, wie Ken Keasey mit einem Karnevalsfreak.
Eine Hommage an die Musik der 60er Jahre ist dem zwar Film gelungen. Die schleimige Inszenierung, mit ihrer penetranten Gefallsucht, legt jedoch einen widerwärtigen Schleier über die unsterblichen Rythmen und befleckt die Ikonen der Popmusik mit einer unwürdigen Entseelung ihrer historischen Sprengkraft und Reduzierung auf einen seichten Unterhaltungsfaktor.
Obwohl die Optik und die Schauspielerriege auf eine höherpreisige Produktion schließen laßen, ist der Film ein Rohrkrepierer und verfehlt sein Ziel, das Lebensgefühl der 60's zu reanimieren, um Lichtjahre.
1966, als die moderne Rock- und Popmusik, eine ganze Generation aus dem Dornröschenschlaf der biederen Spießigkeit ihrer Eltern und dem Muff der 50er Jahre wachzuküssen bagann, begibt sich eine handvoll Revoluzer und Außenseiter auf ein marodes Schiff vor die Küste des vereinigten Königreiches und beglückt von dort aus Land und Leute mit ihrer subversiven Musik. Die etablierten Sender wie die BBC vermuten in der modernen Musik die Zersetzung der britischen Kultur und verweigern sich der Ausstrahlung der Teufelsdisharmonien. Die Piratensender sind daher so etwas wie die verwegenen Vorkämpfer für die Entfesselung unterdrückter Volkstriebe und Katalysator der kreativen Entfaltung des Individuums.
Alles könnte wunderbar seine geregelten Bahnen nehmen, wäre da nicht ein erzkonserativer Minister, dem jede Form von enthemmten Vergnügen ein Dorn im Auge ist und der mit allen Mitteln seiner Macht die privaten Radio Stationen zum Schweigen bringen will... soweit und soweit auch OK.
Was dem Film aber den Gnadenstoß versetzt, könnte man am besten mit dem Wort "Pseudo" umschreiben, denn an dem Film ist alles Pseudo: Die Crew an Bord des Schifffes ist pseodocool, pseudohip und nur pseudofreakig. Ebenso ist der erzkonserative Minister einfach nur unglaubwürdig bescheuert und so simpel schablonenhaft verstockt, daß es wehtut.
Dreht man aber einen Film über die späten 60er, dann muß alles authentisch wirken und darf nicht die weichgespülte Variation aus der Retorte sein. Selbst die gesamte ach so hippe Crew ist in keinster weise cool. Es sind die Feel Good Movie Clone echter charismatischer Freaks und Revolutionäre. Statt mit trockenem englischen Humor zu punkten, setzt Regisseur Richard Curtis auf Pseudofrivolitäten aus der Eis am Stil Mottenkiste, die zu keiner Zeit lustig sind. Pubertäre Zoten, statt niveauvolle Unterhaltung. Für Teenies mögen die Abziehbilder echter Individualisten noch einen gewißen Reiz haben und der peinlich dümmlich überzeichnete Minister noch als Projektionsfläche für die eigenen ungeliebten Erziehungsberechtigten oder Sonderpädagogen dienen, jeder anständige Mitbürger versinkt dabei in betretenes Fremdschämen.
Ebenso wie die Witzeleien an Bord flach sind, sind die Dialoge platt. Immer wenn es ruhig und gestelzt besinnlich wird, vermeintliche Lebensweisheiten präsentiert werden und der Film anTiefe gewinnen möchte, entlarvt sich der Radio Rock Revolution als einziger Schiß in den Ofen. Banalste Lebensplattitüden ersetzen profunde bewußtseinserweiternde Erkenntnisse, gerne auch aus dem asiatischen Kulturkreis, wie es damals Gang und Gäbe war.
Statt dem Film eine Portion Zeitkollorit zu spendieren, biedert sich RRR dem Zuschauer mit aalglatten schablonenhaften Charakteren an, die mit echten Hippies so viel zu tun haben, wie Ken Keasey mit einem Karnevalsfreak.
Eine Hommage an die Musik der 60er Jahre ist dem zwar Film gelungen. Die schleimige Inszenierung, mit ihrer penetranten Gefallsucht, legt jedoch einen widerwärtigen Schleier über die unsterblichen Rythmen und befleckt die Ikonen der Popmusik mit einer unwürdigen Entseelung ihrer historischen Sprengkraft und Reduzierung auf einen seichten Unterhaltungsfaktor.
mit 2
mit 4
mit 4
mit 3
bewertet am 19.03.18 um 12:16
Verwöhntes Millionärssöhnchen macht nach dem Tod seines schwerrreichen Vaters auf Superheld und will dem Bösen in seinem Viertel mal so richtig zeigen, wo der Bartel den Most holt.
Leider ist Söhnchen komplett unbegabt. Zum Glück gibt's aber Kato, daß Kung Fu zuckende Mechanikergenie seines Erzeugers.
Mit einer James Bondkarrenparodie soll jetzt die City vom Schmutz befreit werden..
In gewohnter Seth Rogen Manier hangelt man sich so von Slapstick zu Slapstick und Infantilität zu Infantilität, ohne auch nur eine Albernheit auszulassen oder eine Peinlichkeit zu umschiffen...
Dennoch: Die Konsequenz der kindischen Naivität mit der die beiden Antihelden auf Ganovenjagd (überzeugend: Christoph Waltz) gehen und den Frauen, besonders der hübschen Sekretärin (Cameron Diaz) nachstellen, hat einen erfrischend unbefangenen Charakter und bringt richtig Laune in die Bude, auch wenn der Film nie so richtig an Fahrt aufnimmt.
Ein etwas besseres Timing und die eine oder andere Juxrakete hättten den Film sicherlich mindestenz eine Liga nach oben gespült...
Auch wenn der spektakuläre 3D Effekt vermißt wird, es gibt keine Pop Outs und keineen Blick in die Unendlichkeit des Weltenraumes, ist dies wegen kaum vorhandener Ghostings und prägnanter Räumlichkeit eine der besten und angenehmst zu konsumierenden 3D Veröffentlichungen bisher...
Leider ist Söhnchen komplett unbegabt. Zum Glück gibt's aber Kato, daß Kung Fu zuckende Mechanikergenie seines Erzeugers.
Mit einer James Bondkarrenparodie soll jetzt die City vom Schmutz befreit werden..
In gewohnter Seth Rogen Manier hangelt man sich so von Slapstick zu Slapstick und Infantilität zu Infantilität, ohne auch nur eine Albernheit auszulassen oder eine Peinlichkeit zu umschiffen...
Dennoch: Die Konsequenz der kindischen Naivität mit der die beiden Antihelden auf Ganovenjagd (überzeugend: Christoph Waltz) gehen und den Frauen, besonders der hübschen Sekretärin (Cameron Diaz) nachstellen, hat einen erfrischend unbefangenen Charakter und bringt richtig Laune in die Bude, auch wenn der Film nie so richtig an Fahrt aufnimmt.
Ein etwas besseres Timing und die eine oder andere Juxrakete hättten den Film sicherlich mindestenz eine Liga nach oben gespült...
Auch wenn der spektakuläre 3D Effekt vermißt wird, es gibt keine Pop Outs und keineen Blick in die Unendlichkeit des Weltenraumes, ist dies wegen kaum vorhandener Ghostings und prägnanter Räumlichkeit eine der besten und angenehmst zu konsumierenden 3D Veröffentlichungen bisher...
mit 3
mit 5
mit 4
mit 3
bewertet am 02.02.18 um 22:09
Ein alternder, aus der Zeit gefallener Illusionist kämpft sich am Rande des Existenzminimums durch die Kleinkunstbühnen Frankreichs, bis ihn das Schicksal in ein schottisches Pub verschlägt. Unter den einfachen Dorfbewohnern erfährt er so etwas wie Anerkennung und Bewunderung. Kurzweilig flackert wieder etwas Lebensmut in seiner vereinsamten Brust auf.
Ein kleines Zimmermädchen begleitet den Trickkünstler schließlich wieder zurück in die harte Welt des Überlebenskampfes und wird von ihm, schlussendlich vom Zauber entwöhnt, ins Leben entlassen.
Die verlaufenden Aquarellkulissen und der der naiven Malerei der Kinderbuchillustrationen entlehnte Zeichenstil verleihen dem Film eine träumerisch schwelgerische Athmosphäre.
Romantisch, poetisch, traurig-melancholisch und wunderschön.
Ein kleines Zimmermädchen begleitet den Trickkünstler schließlich wieder zurück in die harte Welt des Überlebenskampfes und wird von ihm, schlussendlich vom Zauber entwöhnt, ins Leben entlassen.
Die verlaufenden Aquarellkulissen und der der naiven Malerei der Kinderbuchillustrationen entlehnte Zeichenstil verleihen dem Film eine träumerisch schwelgerische Athmosphäre.
Romantisch, poetisch, traurig-melancholisch und wunderschön.
mit 4
mit 4
mit 4
mit 2
bewertet am 02.02.18 um 21:45
Top Angebote
kleinhirn
GEPRÜFTES MITGLIED
FSK 18
Aktivität
Forenbeiträge0
Kommentare41
Blogbeiträge0
Clubposts0
Bewertungen510
Mein Avatar
Weitere Funktionen
(510)
(16)
Beste Bewertungen
kleinhirn hat die folgenden 4 Blu-rays am besten bewertet:
Letzte Bewertungen
Filme suchen nach
Mit dem Blu-ray Filmfinder können Sie Blu-rays nach vielen unterschiedlichen Kriterien suchen.
Die Filmbewertungen von kleinhirn wurde 341x besucht.