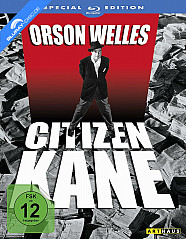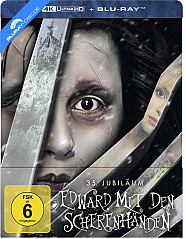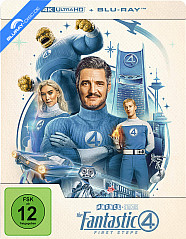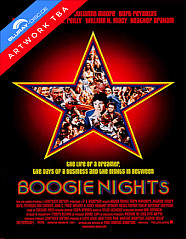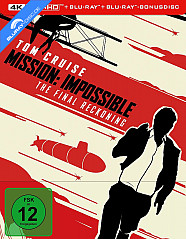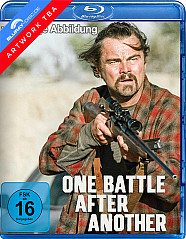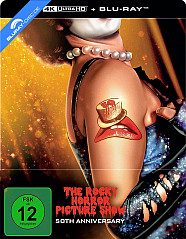Von Quentin Tarantino: "Jackie Brown" und "Kill Bill - Volume 1 & 2" ab 18.12. auf UHD Blu-ray in Steelbooks – UPDATE 3Im Vertrieb von Plaion Pictures: Filme und Serien auf Blu-ray und 4K UHD im Januar 2026 im Überblick – UPDATE"Predator"-Filme auf Blu-ray und 4K UHD: 5-Filme-Sets ab 28.11. auch in Deutschland verfügbar"Devils - Im Körper des Killers": Action-Thriller aus Südkorea erscheint auf Blu-ray Disc"Aktion Mutante" von Álex de la Iglesia ab 19.12. auf Ultra HD Blu-ray im Mediabook mit zwei Cover-MotivenSuperhelden-Abenteuer aus Südkorea: "Hi-Five" ab 11. Dezember 2025 auf Blu-ray Disc
NEWSTICKER
Filmbewertungen von kleinhirn
Na also, es geht doch noch. Mit niedrigster Erwartung, den nächsten Actionoverkilltsunami über mich hinwegbranden zu lassen, zog ich mir opferbereit die 3D Brille über mein gesalbtes Haupt und überlies mich der vermeintlich nächsten Demontage des einst ausgiebig gefeierten Franchises.
Von der ersten Minute an jedoch war ich hellwach. Die Spezialeffekte der Anfangsschlacht waren hervorragend choreographiert und eher spartanisch gestaltet, als einer Eskalationslogik einer immer ausufernden Materialschlacht zu folgen. Auch der 3D Effekt war von beeindruckender Tiefenwirkung geprägt und muß ausdrücklich empfohlen werden! Selten wurde Räumlichkeit und Tiefenstaffelung so gewinnbringend eingesetzt, wie im vorliegenden Fall!
Aber außer der Vielzahl optischer Leckerbissen, überzeugt vor allem die Geschichte, voraussgesetzt man pfeifft auf die ganzen Zeitreiseparadoxien, denn, ehrlich zugegeben, ist man dafür doch eh zu blöd.
Vereinfacht gesagt, dreht sich wieder alles um denselben Brei: Kyle Reese, der Vater von John Connor wird von eben demselben im Jahre 2029 ins Jahr 1984 geschickt, um dessen Mutter zu befruchten, um eben John erst zu zeugen. Bevor das geschehen kann, schafft es das Computerprogramm Skynet, den ersten (Arnie) Terminator T-800, ebenfalls ins Jahr 1984 zu teletransportieren, um Sarah Connor ihrer Mutterfreuden zu berauben, sprich, ihr die Grütze aus dem Schädel zu blasen.
Da man aber dort mitlerweile schon weiß, was da alles Übles aus der Zukunft über sie hereinbricht, ist der gute Arnie (ebenfalls ein T-800er Modell) aber auch schon dort, um seinen Vorgänger die Schaltkreise mal gehörig so richtig zu polieren und Connors Mutter zu beschützen. Nach getaner Arbeit taucht, verdammt nochmal, einer von diesen widerlichen T-1000 Flüßigmetall Terminatoren auf, der sich auf Grund seiner Schlüpfrigkeit aus allen Problemen herauswinden kann wie ein Politiker. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich jetzt sage, daß auch dieser Tunichtgut seiner gerechten Bestimmung zugeführt wird.
Danach will man mit einer selbstgebauten (vom guten Arnie T-800) Zeitmaschine ins Jahr 1997 reisen, um den Tag der Abrechnung, den "Judgement Day" zu verhindern.
Kyle Reese ist jedoch auf seiner Reise aus dem Jahe 2029 mit einer alternativen Zeitschiene in Berührung getreten, die den Judgement Day auf das 2017 verlegt hat. Reese überzeugt Connor mehr oder weniger von der Richtigkeit seiner Vision und so reist man mehr oder weniger freiwillig gemeinsam ins gelobte Jahr 2017.
Und tatsächlich: Stunden bevor die App Genisys, welche später zu Skynet mutiert, von einer Milliardenbevölkerung heruntergeladen werden kann, erreicht man San Francisco.
Mit Arnie im Schlepptau, der die 33 Jahre in Echtzeit verbracht hat, da er kein gültiges Ticket für die Zeitreisemaschine vorweisen konnte, dürfte die Eliminierung des Computerprogrammes und Einäscherung Skynets nur noch reine Formsache sein. Doch dann taucht plötzlich John Connor, Sarah und Kyle's Sohn auf...
Was jetzt kommt, kann man sich vielleicht denken, sagen tu ichs aber nicht. Fakt ist aber daß sich die Kämpfe, nicht nur im Finale, durch ein hohes Maß an Kreativität auszeichnen und sich das bekannte Phänomen von Fortsetzungen, nämlich ein Abklatsch des Vorherigen zu sein, in diesem Fall nicht nachweisen läßt. Im Gegenteil wirkt das Terminator Franchise frisch wie am jüngsten Tag und es ist eine Wonne, dem gealterten Terminator (Arnie in Echtzeit) bei der tüchtigen Ausübung seines ehrenwerten Handwerkes beiwohnen zu dürfen.
Dabei wird ganz im Geist der alten Filme sehr viel Wert auf kernige "Mann gegen Mann" Action gelegt, die jedoch mit dem Möglichkeiten moderner CGI Mitteln bis an den Rand des erlaubten ausgereizt wird. Arnies markige Sprüche sind hier ebenfalls ein fester Bestandteil der gelungenen Reanimation der Reihe, wie sparsam dosierte Gesellschaftkritik, die die Smartphonegeneration dezent aber deutlich, mit der sklavischen Abhängigkeit ihrer Lebensersatzmaschine, auf die Schippe nimmt.
Diese Kombination aus altbewährten Old School Action Zutaten, gepaart mit zeitgemäßen Elementen aus der SciFi Trickkiste, aber immer im Geist der Originale, gewürzt mit Humor und berauschenden (3D) Bildern ist es, was dem Zuschauer ständig ein "Smile in your Face" fräst, wie es der Amerikaner in Ermangelung eines differenzierteren Gebrauches seiner Muttersprache kurz aber prägnant auf den Punkt bringen würde. Einer der wenigen Filme, die man direkt nochmal sehen möchte!
Anschnallen und genießen! Aber bitte in 3D!!!
Von der ersten Minute an jedoch war ich hellwach. Die Spezialeffekte der Anfangsschlacht waren hervorragend choreographiert und eher spartanisch gestaltet, als einer Eskalationslogik einer immer ausufernden Materialschlacht zu folgen. Auch der 3D Effekt war von beeindruckender Tiefenwirkung geprägt und muß ausdrücklich empfohlen werden! Selten wurde Räumlichkeit und Tiefenstaffelung so gewinnbringend eingesetzt, wie im vorliegenden Fall!
Aber außer der Vielzahl optischer Leckerbissen, überzeugt vor allem die Geschichte, voraussgesetzt man pfeifft auf die ganzen Zeitreiseparadoxien, denn, ehrlich zugegeben, ist man dafür doch eh zu blöd.
Vereinfacht gesagt, dreht sich wieder alles um denselben Brei: Kyle Reese, der Vater von John Connor wird von eben demselben im Jahre 2029 ins Jahr 1984 geschickt, um dessen Mutter zu befruchten, um eben John erst zu zeugen. Bevor das geschehen kann, schafft es das Computerprogramm Skynet, den ersten (Arnie) Terminator T-800, ebenfalls ins Jahr 1984 zu teletransportieren, um Sarah Connor ihrer Mutterfreuden zu berauben, sprich, ihr die Grütze aus dem Schädel zu blasen.
Da man aber dort mitlerweile schon weiß, was da alles Übles aus der Zukunft über sie hereinbricht, ist der gute Arnie (ebenfalls ein T-800er Modell) aber auch schon dort, um seinen Vorgänger die Schaltkreise mal gehörig so richtig zu polieren und Connors Mutter zu beschützen. Nach getaner Arbeit taucht, verdammt nochmal, einer von diesen widerlichen T-1000 Flüßigmetall Terminatoren auf, der sich auf Grund seiner Schlüpfrigkeit aus allen Problemen herauswinden kann wie ein Politiker. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich jetzt sage, daß auch dieser Tunichtgut seiner gerechten Bestimmung zugeführt wird.
Danach will man mit einer selbstgebauten (vom guten Arnie T-800) Zeitmaschine ins Jahr 1997 reisen, um den Tag der Abrechnung, den "Judgement Day" zu verhindern.
Kyle Reese ist jedoch auf seiner Reise aus dem Jahe 2029 mit einer alternativen Zeitschiene in Berührung getreten, die den Judgement Day auf das 2017 verlegt hat. Reese überzeugt Connor mehr oder weniger von der Richtigkeit seiner Vision und so reist man mehr oder weniger freiwillig gemeinsam ins gelobte Jahr 2017.
Und tatsächlich: Stunden bevor die App Genisys, welche später zu Skynet mutiert, von einer Milliardenbevölkerung heruntergeladen werden kann, erreicht man San Francisco.
Mit Arnie im Schlepptau, der die 33 Jahre in Echtzeit verbracht hat, da er kein gültiges Ticket für die Zeitreisemaschine vorweisen konnte, dürfte die Eliminierung des Computerprogrammes und Einäscherung Skynets nur noch reine Formsache sein. Doch dann taucht plötzlich John Connor, Sarah und Kyle's Sohn auf...
Was jetzt kommt, kann man sich vielleicht denken, sagen tu ichs aber nicht. Fakt ist aber daß sich die Kämpfe, nicht nur im Finale, durch ein hohes Maß an Kreativität auszeichnen und sich das bekannte Phänomen von Fortsetzungen, nämlich ein Abklatsch des Vorherigen zu sein, in diesem Fall nicht nachweisen läßt. Im Gegenteil wirkt das Terminator Franchise frisch wie am jüngsten Tag und es ist eine Wonne, dem gealterten Terminator (Arnie in Echtzeit) bei der tüchtigen Ausübung seines ehrenwerten Handwerkes beiwohnen zu dürfen.
Dabei wird ganz im Geist der alten Filme sehr viel Wert auf kernige "Mann gegen Mann" Action gelegt, die jedoch mit dem Möglichkeiten moderner CGI Mitteln bis an den Rand des erlaubten ausgereizt wird. Arnies markige Sprüche sind hier ebenfalls ein fester Bestandteil der gelungenen Reanimation der Reihe, wie sparsam dosierte Gesellschaftkritik, die die Smartphonegeneration dezent aber deutlich, mit der sklavischen Abhängigkeit ihrer Lebensersatzmaschine, auf die Schippe nimmt.
Diese Kombination aus altbewährten Old School Action Zutaten, gepaart mit zeitgemäßen Elementen aus der SciFi Trickkiste, aber immer im Geist der Originale, gewürzt mit Humor und berauschenden (3D) Bildern ist es, was dem Zuschauer ständig ein "Smile in your Face" fräst, wie es der Amerikaner in Ermangelung eines differenzierteren Gebrauches seiner Muttersprache kurz aber prägnant auf den Punkt bringen würde. Einer der wenigen Filme, die man direkt nochmal sehen möchte!
Anschnallen und genießen! Aber bitte in 3D!!!
mit 5
mit 5
mit 5
mit 1
bewertet am 06.02.16 um 11:20
Potpouri cineastischer Glanzlichter des schwarz/weiß Kinos der 20er bis 40er Jahre, die in bester Indiana Jones Manier auf einer halsbrecherischen Jagd um den halben Globus, hintereinander aufgeperlt sind.
Die stärksten Themen der Abenteuerfilme wie Lost World oder In den Fesseln des Shangri La, werden hier kunstvoll, wenn auch nur lose, mit Motiven von der schwarzen Serie bis hin zu Jule Verne Themen, fast ansatzlos verknüpft.
Die Bilder sind, ihren Vorbildern huldigend, farblich entsättigt und weisen nur einen leichten serpia Stich auf. Durch diesen Kniff ergibt sich, ebenso wie durch das Retrodesign der Maschinen, welches nicht von ungefähr an Metropolis erinnert und dem Futurismus der 20er Jahre entlehnt ist, ein wunderbar nostalgisches Flair, welches eine Kreuzung aus Art Deko und Steampunk darzustellen scheint.
Auch wenn die Handlung sich nur lose an der Suche nach einem verrückt-genialen Naziwissenschaftler entlanghangelt, verknüpft sie die ständig wechselnden Sets doch sinnvoll miteinander und generiert so, zumindest in Ansätzen, einen wirkingsvollen Stimmungsaufbau.
Das naive Geschichtchen mit süß eingeflochtener Liebesgeschichte sollte aber nicht überbewertet werden. An erster Linie steht hier die Blütenlese innovativster SciFi und Fantasyscenen aus den Gründerjahren dieser Genres, die mit ihrer unglaublichen Kreativität das Feld des Phantastischen schon ziemlich beackert und den nachfolgenden Generationen nur noch ein paar Brosamen zum Jonglieren übriggelassen haben.
Durch dieses Aneinanderreihen von Ikonenhaften Scenen aus der goldenen Ära des Filmes, ist ein Aufflammen von Langeweile schon theoretisch unmöglich. Im Gegenteil überzeugt der naive Charme der Väter des Abenteuer- und SciFi Kinos bis in die heutige Zeit hinein und Regisseur Kerry Conran hat mit seiner kongenialen Hommage den Pionieren des Genres ein würdiges Denkmal gesetzt. Noch heute dienen diese Vorbilder selbst den aktuellen großen CGI Spektakeln als große Quelle der Inspiration, erfahren aber, ebenso wie dieses Kleinod, leider viel zu wenig Würdigung. Schade eigentlich. Schade, schade.
Die stärksten Themen der Abenteuerfilme wie Lost World oder In den Fesseln des Shangri La, werden hier kunstvoll, wenn auch nur lose, mit Motiven von der schwarzen Serie bis hin zu Jule Verne Themen, fast ansatzlos verknüpft.
Die Bilder sind, ihren Vorbildern huldigend, farblich entsättigt und weisen nur einen leichten serpia Stich auf. Durch diesen Kniff ergibt sich, ebenso wie durch das Retrodesign der Maschinen, welches nicht von ungefähr an Metropolis erinnert und dem Futurismus der 20er Jahre entlehnt ist, ein wunderbar nostalgisches Flair, welches eine Kreuzung aus Art Deko und Steampunk darzustellen scheint.
Auch wenn die Handlung sich nur lose an der Suche nach einem verrückt-genialen Naziwissenschaftler entlanghangelt, verknüpft sie die ständig wechselnden Sets doch sinnvoll miteinander und generiert so, zumindest in Ansätzen, einen wirkingsvollen Stimmungsaufbau.
Das naive Geschichtchen mit süß eingeflochtener Liebesgeschichte sollte aber nicht überbewertet werden. An erster Linie steht hier die Blütenlese innovativster SciFi und Fantasyscenen aus den Gründerjahren dieser Genres, die mit ihrer unglaublichen Kreativität das Feld des Phantastischen schon ziemlich beackert und den nachfolgenden Generationen nur noch ein paar Brosamen zum Jonglieren übriggelassen haben.
Durch dieses Aneinanderreihen von Ikonenhaften Scenen aus der goldenen Ära des Filmes, ist ein Aufflammen von Langeweile schon theoretisch unmöglich. Im Gegenteil überzeugt der naive Charme der Väter des Abenteuer- und SciFi Kinos bis in die heutige Zeit hinein und Regisseur Kerry Conran hat mit seiner kongenialen Hommage den Pionieren des Genres ein würdiges Denkmal gesetzt. Noch heute dienen diese Vorbilder selbst den aktuellen großen CGI Spektakeln als große Quelle der Inspiration, erfahren aber, ebenso wie dieses Kleinod, leider viel zu wenig Würdigung. Schade eigentlich. Schade, schade.
mit 4
mit 4
mit 4
mit 2
bewertet am 03.02.16 um 15:49
Die 60 min Extramaterial der Extended Edition werten den Film zwar nochmal deutlich auf, können die handwerklichen und technischen Defizite der Triologie aber leider nicht ausmerzen.
Besonders tragisch fällt auch hier wieder der hyperrealistische Look ins Gewicht, der dem Film den Charme von Bad Segeberg Karl May Festspielen verleiht. Anstatt in Mittelerde befindet man sich in Neuseeland und schaut kostümierten Schauspielern bei ihrer Arbeit zu.
Es schmerzt schon fast zuzusehen, wie die großartigen Ansätze, die der Hobbit zweifellos bietet, durch Stil- und Stimmungsbrüche in der Erzählstruktur die phantastische Fantasyathmosphäre des Tolkienuniversums, die wir aus der Herr der Ringe Saga schätzen gelernt haben, demontiert wird. Wo die Herr der Ringe Welt noch in sich selbst homogen dargeboten wird und mit der richtigen Mischung aus Fantasy und Ernsthaftigkeit überzeugt, driftet der Hobbit temporär zu sehr in kindlich-alberne Gefilde (Jar Jar Bings läßt grüßen) ab, die für den Zuschauer nur schwer mit der gewohnten Tolkienwelt in Verbindung zu bringen sind.
Als Beispiel seien im ersten Teil die Zwerge genannt, die durch ihre Überkostümierung z.T. so aussehen, als seien sie geradewegs aus dem Asterix und Obelix Freizeitpark (vor allem der fette Bombur) entwichen und verbreiten eine launisch aufgedrehte Stimmung wie ein ADHS Zögling am Kindergeburtstag.
Auch die Scene mit den Bergtrollen wirkt insgesamt eher infantil, denn irgendwie witzig und originär. Hier hätte man Peter Jackson mehr Emanzipation von der kindgerechten Buchvorlage und mehr Gespür für das von ihm selbst entworfene Tolkiensche Reich gewünscht!
Desweiteren ist mir die Scene mit Gollum zu lang geraten und seine hyperaktive Art in Kombination mit seiner kreischenden Stimme, nervt mehr, als daß sie ein eintauchen in das Geschehen fördern.
Auch die Kamerafahrten in den Goblinhöhlen erinnern eher an 3D Gimmicks aus dem Warner Brother Movie World und haben mehr Gemeinsamkeiten mit einer Kirmesattraktion, denn einer zweckdienlichen Handlung. Viele sehenswerte Details fallen hier den rasanten Kamerafahrten zum Opfer und die Massen der Orks erschweren eine Fokussierung auf das wesentliche. Eine Konzentration auf einige wenige halsbrecherische Fluchtkapriolen, statt rasante Kameraflüge durch das verzweigte Höhlensystem, wäre auch hier dem Filmgenuß zuträglich gewesen. So wird die Auffassungsgabe des gesetzteren Publikums nicht nur ausgereizt, sondern über die Erträglichkeitsgrenze hinaus strapaziert.
Das der Orkkönig dabei eher eine Witzfigur darstellt, denn einen überzeugenden Bösewicht gleicht, trägt auch nicht unbedingt aktiv dazu bei, sich vorbehaltslos mit dem Film anzufreunden. Wie wir nicht erst seit Jackson wissen, lassen sich ernstafte Kämpfe auf Leben und Tod zwar hervorragend mit Humor und sogar mit Slapstick kombinieren, nicht aber jedoch mit plumpen Blödeleien und deplatzierten Singspielchen. Wobei hier gesagt werden muß, daß sich die deutschen Sprecher auch alle Mühe geben, die besagten Scenen ordentlich ins Lächerliche zu ziehen und es muß eingestanden werden, daß das Design der Goblins (Orks) richtig Spaß macht und Jackson noch ein paar "Extras" auf Lager hatte, die jedoch dem FSK 12 Gebot zum Opfer gefallen sind.
Der größte Vopa ist für mich aber die Auswahl des Hauptdarstellers, bzw. dessen Bilbo Beutlin Interpretation. Ich werde mit seiner unbeholfen affektierten Art zu spielen und seiner übertriebenen Schnutenzieherei einfach nicht warm. Wenn der Hauptdarsteller schon ein auf keck machenden Möchtegernlustig mimt, hat man es als Zuschauer nicht leicht, sich mit der Geschichte anzufreunden.
Positiv ist zu verzeichnen, daß sich Jackson in anderen Momenten dann doch von der Buchvorlage entfernt und und mit der Erschaffung neuer Charaktere, bzw. Einbindung solcher aus dem Simarillion Universum, noch tiefer in das Tolkienuniversum eindringt und somit dem Hobbit zu epischer Größe verhilft. Auch wenn die Verflechtung der paralellen Handlungsstränge oft etwas holprig und erzwungen wirkt, beglückt die genauere Beleuchtung der Wiederauferstehung Saurons jedes Fantasyherz. Auch der schusselige Radagast und die Elbenfrau Tauriel verhelfen mit ihrer Präsenz dem Hobbit zu mehr erzählerischer Tiefe und charakterlicher Vielfalt.
Insgesamt bezieht sich die Kritik aber vor allem auf die ersten beiden Teile. Wenn man von der Digitalisierung der Orks (allen voran Azog) und Wargs, die mir zu technisch-mechanisch kalt geraten sind einmal absieht und den digital-realen Soapdokubilliglook, der jeder Fantasyathmosphäre (auch in 24fpm) zuwiderläuft, ausblenden kann, trumpft der dritte Teil mit allen auf, was die Herr der Ringe Triologie schon so Außergewöhnlich gemacht hat: endlich stimmt hier der Grundtenor, bilden Figuren, Scenen und Handlung ein homogenes Ganzes. Es wird nicht mehr rumgealbert, die Zwerge sind zu charakterlicher Seriösität gereift, und epische Schlachten laden zum Heldentod ein. Vor abermals bombastischen Kulissen wird die finale Schlacht geschlagen. Zwerge gegen Orks gegen Menschen gegen Elben. Alle auf der Jagd nach dem Zwergengold und auch der eine oder andere private Rachefeldzug findet hier sein spektakulären Finale.
Was in der Kinoversion noch zum Teil enttäuscht hat, wird hier en Detail bis zum Exzess zelebriert: In der Extended Edition blitzt endlich wieder Jacksons schelmischer Humor durch und die Trolle werden viel detailverliebter in das Kampfgeschehen eingeflochten, bzw. aus diesem auch wieder in Einzelteilen eliminiert, als noch im Kino. Auf gewohnt kreativer Weise werden Orks und Trolle um Köpfe oder wahlweise Beine kürzer gemacht und im Schlachtgetümmel blitzt endlich das volle Potenzial durch, daß der WETA Schmiede so eigen ist.
Da kommt Freude auf und ist plötzlich die alte Euphorie wieder da. Die letzte Schlacht ist so unterhaltsam, daß man sie vorbehaltslos an einem verkaterten Wochenende in Endlosschleife durchlaufen lassen kann ohne ihrer überdrüssig zu werden.
So wird man am Ende doch noch für etliche Längen und überflüßigen Klamauk entschädigt und verläßt Mittelerde mit dem wohligen Gefühl, daß es immer noch in den richtigen Händen ist. Denn auch wenn sich Kritik und Lob die Wage halten, der Augenschmaus, den uns die atemberaubenden Kulissen und Landschaften bescheren, ist immer noch unerreicht und lädt nachhaltig zum erneuten Besuch ein...
Besonders tragisch fällt auch hier wieder der hyperrealistische Look ins Gewicht, der dem Film den Charme von Bad Segeberg Karl May Festspielen verleiht. Anstatt in Mittelerde befindet man sich in Neuseeland und schaut kostümierten Schauspielern bei ihrer Arbeit zu.
Es schmerzt schon fast zuzusehen, wie die großartigen Ansätze, die der Hobbit zweifellos bietet, durch Stil- und Stimmungsbrüche in der Erzählstruktur die phantastische Fantasyathmosphäre des Tolkienuniversums, die wir aus der Herr der Ringe Saga schätzen gelernt haben, demontiert wird. Wo die Herr der Ringe Welt noch in sich selbst homogen dargeboten wird und mit der richtigen Mischung aus Fantasy und Ernsthaftigkeit überzeugt, driftet der Hobbit temporär zu sehr in kindlich-alberne Gefilde (Jar Jar Bings läßt grüßen) ab, die für den Zuschauer nur schwer mit der gewohnten Tolkienwelt in Verbindung zu bringen sind.
Als Beispiel seien im ersten Teil die Zwerge genannt, die durch ihre Überkostümierung z.T. so aussehen, als seien sie geradewegs aus dem Asterix und Obelix Freizeitpark (vor allem der fette Bombur) entwichen und verbreiten eine launisch aufgedrehte Stimmung wie ein ADHS Zögling am Kindergeburtstag.
Auch die Scene mit den Bergtrollen wirkt insgesamt eher infantil, denn irgendwie witzig und originär. Hier hätte man Peter Jackson mehr Emanzipation von der kindgerechten Buchvorlage und mehr Gespür für das von ihm selbst entworfene Tolkiensche Reich gewünscht!
Desweiteren ist mir die Scene mit Gollum zu lang geraten und seine hyperaktive Art in Kombination mit seiner kreischenden Stimme, nervt mehr, als daß sie ein eintauchen in das Geschehen fördern.
Auch die Kamerafahrten in den Goblinhöhlen erinnern eher an 3D Gimmicks aus dem Warner Brother Movie World und haben mehr Gemeinsamkeiten mit einer Kirmesattraktion, denn einer zweckdienlichen Handlung. Viele sehenswerte Details fallen hier den rasanten Kamerafahrten zum Opfer und die Massen der Orks erschweren eine Fokussierung auf das wesentliche. Eine Konzentration auf einige wenige halsbrecherische Fluchtkapriolen, statt rasante Kameraflüge durch das verzweigte Höhlensystem, wäre auch hier dem Filmgenuß zuträglich gewesen. So wird die Auffassungsgabe des gesetzteren Publikums nicht nur ausgereizt, sondern über die Erträglichkeitsgrenze hinaus strapaziert.
Das der Orkkönig dabei eher eine Witzfigur darstellt, denn einen überzeugenden Bösewicht gleicht, trägt auch nicht unbedingt aktiv dazu bei, sich vorbehaltslos mit dem Film anzufreunden. Wie wir nicht erst seit Jackson wissen, lassen sich ernstafte Kämpfe auf Leben und Tod zwar hervorragend mit Humor und sogar mit Slapstick kombinieren, nicht aber jedoch mit plumpen Blödeleien und deplatzierten Singspielchen. Wobei hier gesagt werden muß, daß sich die deutschen Sprecher auch alle Mühe geben, die besagten Scenen ordentlich ins Lächerliche zu ziehen und es muß eingestanden werden, daß das Design der Goblins (Orks) richtig Spaß macht und Jackson noch ein paar "Extras" auf Lager hatte, die jedoch dem FSK 12 Gebot zum Opfer gefallen sind.
Der größte Vopa ist für mich aber die Auswahl des Hauptdarstellers, bzw. dessen Bilbo Beutlin Interpretation. Ich werde mit seiner unbeholfen affektierten Art zu spielen und seiner übertriebenen Schnutenzieherei einfach nicht warm. Wenn der Hauptdarsteller schon ein auf keck machenden Möchtegernlustig mimt, hat man es als Zuschauer nicht leicht, sich mit der Geschichte anzufreunden.
Positiv ist zu verzeichnen, daß sich Jackson in anderen Momenten dann doch von der Buchvorlage entfernt und und mit der Erschaffung neuer Charaktere, bzw. Einbindung solcher aus dem Simarillion Universum, noch tiefer in das Tolkienuniversum eindringt und somit dem Hobbit zu epischer Größe verhilft. Auch wenn die Verflechtung der paralellen Handlungsstränge oft etwas holprig und erzwungen wirkt, beglückt die genauere Beleuchtung der Wiederauferstehung Saurons jedes Fantasyherz. Auch der schusselige Radagast und die Elbenfrau Tauriel verhelfen mit ihrer Präsenz dem Hobbit zu mehr erzählerischer Tiefe und charakterlicher Vielfalt.
Insgesamt bezieht sich die Kritik aber vor allem auf die ersten beiden Teile. Wenn man von der Digitalisierung der Orks (allen voran Azog) und Wargs, die mir zu technisch-mechanisch kalt geraten sind einmal absieht und den digital-realen Soapdokubilliglook, der jeder Fantasyathmosphäre (auch in 24fpm) zuwiderläuft, ausblenden kann, trumpft der dritte Teil mit allen auf, was die Herr der Ringe Triologie schon so Außergewöhnlich gemacht hat: endlich stimmt hier der Grundtenor, bilden Figuren, Scenen und Handlung ein homogenes Ganzes. Es wird nicht mehr rumgealbert, die Zwerge sind zu charakterlicher Seriösität gereift, und epische Schlachten laden zum Heldentod ein. Vor abermals bombastischen Kulissen wird die finale Schlacht geschlagen. Zwerge gegen Orks gegen Menschen gegen Elben. Alle auf der Jagd nach dem Zwergengold und auch der eine oder andere private Rachefeldzug findet hier sein spektakulären Finale.
Was in der Kinoversion noch zum Teil enttäuscht hat, wird hier en Detail bis zum Exzess zelebriert: In der Extended Edition blitzt endlich wieder Jacksons schelmischer Humor durch und die Trolle werden viel detailverliebter in das Kampfgeschehen eingeflochten, bzw. aus diesem auch wieder in Einzelteilen eliminiert, als noch im Kino. Auf gewohnt kreativer Weise werden Orks und Trolle um Köpfe oder wahlweise Beine kürzer gemacht und im Schlachtgetümmel blitzt endlich das volle Potenzial durch, daß der WETA Schmiede so eigen ist.
Da kommt Freude auf und ist plötzlich die alte Euphorie wieder da. Die letzte Schlacht ist so unterhaltsam, daß man sie vorbehaltslos an einem verkaterten Wochenende in Endlosschleife durchlaufen lassen kann ohne ihrer überdrüssig zu werden.
So wird man am Ende doch noch für etliche Längen und überflüßigen Klamauk entschädigt und verläßt Mittelerde mit dem wohligen Gefühl, daß es immer noch in den richtigen Händen ist. Denn auch wenn sich Kritik und Lob die Wage halten, der Augenschmaus, den uns die atemberaubenden Kulissen und Landschaften bescheren, ist immer noch unerreicht und lädt nachhaltig zum erneuten Besuch ein...
mit 4
mit 5
mit 5
mit 5
bewertet am 03.01.16 um 14:20
Durchwachsenes Remake, welches an umambitionierten Innovativen Elan kränkelt.
Verzichtet das Remake im Vergleich zum Original auf das Vorgeplänkel, baut sich hier schnell die bekannte Gruselathmosphäre des Vorgängers auf. Wie im Original wird auch hier eher auf die Macht des Unheimlichen gesetzt, denn auf blanken Horror. Bis zum verschwinden der Tochter kann denn der Film auch mit den wohlbekannten Schockmomenten punkten, wenn auch die Familiendynamik (auch auf grund der mäßigen schauspielerischen Leistung des Familienvaters) etwas zu kurz kommt.
Wo der Film in der ersten Hälfte noch gut funktioniert, fällt er in der zweiten jedoch ab. Zu Beginn wird noch routiniert das Vorbild kopiert, in der zweiten versucht man jedoch neue (CGI) Wege einzuschlagen. Leider entsteht so ein Bruch in der Erzählung, dem der Makel mangelnden Erneuerungswillen anhaftet. Die Einsatz moderne Computertechnik hätte das Thema noch vertiefen, bzw. auf ein neues Level hieven können. Stattdessen baut die Spannung zum Ende hin ab und schafft es selbst mit der visuellen Exploration der "Anderswelt" nicht, den Schrecken in neue Gefilde eskalieren zu lassen.
Wo der Film das Original kopiert, funktioniert er noch, wo er eigene Wege einschlägt, bricht er mit der Grundstimmung des Filmes. Diese Unendschiedenheit zwischen Tradition und beherzter Innovation ist es, an der das Remake scheitert. Mehr Mut und Bekenntniss zu einer zeitgemäßen Schockkultur hätte Tobe Hoopers kleinem Klassiker sicherlich einen würdigeren Popularitätsschub beschert.
Der 3D Effekt ist sicherlich eine Bereicheung, enttäuscht aber durch mangelnde Tiefenwirkung in den entscheidenden Scenen.
Verzichtet das Remake im Vergleich zum Original auf das Vorgeplänkel, baut sich hier schnell die bekannte Gruselathmosphäre des Vorgängers auf. Wie im Original wird auch hier eher auf die Macht des Unheimlichen gesetzt, denn auf blanken Horror. Bis zum verschwinden der Tochter kann denn der Film auch mit den wohlbekannten Schockmomenten punkten, wenn auch die Familiendynamik (auch auf grund der mäßigen schauspielerischen Leistung des Familienvaters) etwas zu kurz kommt.
Wo der Film in der ersten Hälfte noch gut funktioniert, fällt er in der zweiten jedoch ab. Zu Beginn wird noch routiniert das Vorbild kopiert, in der zweiten versucht man jedoch neue (CGI) Wege einzuschlagen. Leider entsteht so ein Bruch in der Erzählung, dem der Makel mangelnden Erneuerungswillen anhaftet. Die Einsatz moderne Computertechnik hätte das Thema noch vertiefen, bzw. auf ein neues Level hieven können. Stattdessen baut die Spannung zum Ende hin ab und schafft es selbst mit der visuellen Exploration der "Anderswelt" nicht, den Schrecken in neue Gefilde eskalieren zu lassen.
Wo der Film das Original kopiert, funktioniert er noch, wo er eigene Wege einschlägt, bricht er mit der Grundstimmung des Filmes. Diese Unendschiedenheit zwischen Tradition und beherzter Innovation ist es, an der das Remake scheitert. Mehr Mut und Bekenntniss zu einer zeitgemäßen Schockkultur hätte Tobe Hoopers kleinem Klassiker sicherlich einen würdigeren Popularitätsschub beschert.
Der 3D Effekt ist sicherlich eine Bereicheung, enttäuscht aber durch mangelnde Tiefenwirkung in den entscheidenden Scenen.
mit 3
mit 4
mit 4
mit 2
bewertet am 29.12.15 um 16:19
Übliches selbstgefälliges Marvel Bombastgetöse mit hohem Beliebigkeitsfaktor. Erzählerische Vollbremsung in Phase II der Marvelchronologie. Routinearbeit ohne Seele.
Ein Geheimexperiment des Iron Man geht schief und 2 unterschiedliche Computerprogramme verbinden sich auf digital-virtueller Ebene zu einer Superbösewichtsoftware, die sich aus Iron Mans Altmetallkammer ein physisches zu Hause bastelt, um in dieser aus irgendeinem spinnernden Grund oder Logikfehler, die Welt zu zerstören. Der Mensch ist sich selbst der größte Feind und muß ausgelöscht werden. Oder so ähnlich.
An dieser hochkomplexen Story, der nur Physiknobelpreisträger oder Marveljünger mit partiell paralysierter Großhirnrinde folgen können, arbeitet sich die Geschichte im ewigen Kampf zwischen Gut und Böse ab, nur um mal wieder in einer effektüberladenen Materialschlacht zu enden.
Alles schon mal gesehen. Alles wie erwartet. So weit so gut und Pflicht erfüllt.
Der Krawumms wird für die Leinwand mal wieder zur Zerreißprobe, die Garnierung desselben läßt jedoch zu wünschen übrig. Humor, Spannung und Gefühl sind Mangelware und deshalb wird die Kür nur mit minimaler Punktausbeute honoriert. Aus diesem Grund ist der Film im Grunde genommen total langweilig und hält den Organismus des Zuschauers nur durch kontinuierliche Stimulanz der Retina vom Einleiten der Tiefschlafphase ab. Abgearbeitet und gut ist!
Nach dem schauen: Fernseher ausmachen nicht vergessen, Chipskrümel vom Sofa wischen, Zähne putzen und gemächlich in den wohlverdienten, erholsamen Schlaf des Vergessens entgleiten...
Ein Geheimexperiment des Iron Man geht schief und 2 unterschiedliche Computerprogramme verbinden sich auf digital-virtueller Ebene zu einer Superbösewichtsoftware, die sich aus Iron Mans Altmetallkammer ein physisches zu Hause bastelt, um in dieser aus irgendeinem spinnernden Grund oder Logikfehler, die Welt zu zerstören. Der Mensch ist sich selbst der größte Feind und muß ausgelöscht werden. Oder so ähnlich.
An dieser hochkomplexen Story, der nur Physiknobelpreisträger oder Marveljünger mit partiell paralysierter Großhirnrinde folgen können, arbeitet sich die Geschichte im ewigen Kampf zwischen Gut und Böse ab, nur um mal wieder in einer effektüberladenen Materialschlacht zu enden.
Alles schon mal gesehen. Alles wie erwartet. So weit so gut und Pflicht erfüllt.
Der Krawumms wird für die Leinwand mal wieder zur Zerreißprobe, die Garnierung desselben läßt jedoch zu wünschen übrig. Humor, Spannung und Gefühl sind Mangelware und deshalb wird die Kür nur mit minimaler Punktausbeute honoriert. Aus diesem Grund ist der Film im Grunde genommen total langweilig und hält den Organismus des Zuschauers nur durch kontinuierliche Stimulanz der Retina vom Einleiten der Tiefschlafphase ab. Abgearbeitet und gut ist!
Nach dem schauen: Fernseher ausmachen nicht vergessen, Chipskrümel vom Sofa wischen, Zähne putzen und gemächlich in den wohlverdienten, erholsamen Schlaf des Vergessens entgleiten...
mit 3
mit 5
mit 5
mit 3
bewertet am 29.12.15 um 15:45
Philip Kaufmanns Hommage an die heilige Zeit der Jugend, beschreibt die fragile Phase einer Jugendclique, die auf dem Sprung in die Erwachsenenwelt steht.
Obwohl hochgelobt, werden dabei bloß der Reihe nach sämtliche Schubladen des "coming of age" Themas gezogen, die bei Spätpubertierenden so an der Tagesordnung sind.
Als da vor allen Dingen wären: Die große Liebe, Bandenkriege, mächtige Besäufnisse, der finale Krach mit den Erziehungsberechtigten und der Einzug von Tod und Gewalt in der von Unsterblichkeitsphantasien geprägte Lebensphase. Innovation sieht anders aus!
Punkten hingegen können die ungeschliffenen, eindringlich-ästhetisch durchkomponierten Bilder, die das Lebensgefühl amerikanischer Teenager in den beginnenden 60er Jahren stimmugsvoll eingefangen. Getragen wird die Novelle außerdem von einer hervorragenden Schauspielertruppe, von deren weiteren Werdegang bedauerlicher Weise nie wieder etwas vernommen wurde.
Das mir der Film nur 3 magere Pünktchen entlocken kann, ist hauptsächlich der Tatsache geschuldet, daß ich aus der Thematik des Balzverhaltens adoleszenter Halbstarker komplett ausgestiegen bin und mich die verzweifelten Versuche der Jugendlichen, Frauen aufs peinlichste anzurempeln, nur um irgendwie an Ihren Busen grapschen zu konnen, nicht mehr im geringsten interessieren. Für unsere Kleinen, die sich im selbigen Reifestadium befinden, können wohl in The Wanderers ihre Nöte, Hoffnungen und Probleme wiedergespiegelt sehen, alle anderen können hier maximal Verhaltensforschung betreiben!
Für mich ist The Wanderers nicht viel mehr als Eis am Stiel ohne Homor und nackte Weiber.
Wer ebenfalls in der Bronx aufgewachsen ist, mag hier wehmütig an die finalen Zuckungen seiner Jugendzeit zurückblicken. Mir persönlich ist der Film zu sehr "von der Stange" und bläßt nicht genug frischen Wind auf die Leinwand, um sich für die Ehrenloge meiner Filmsammlung zu empfehlen.
Obwohl hochgelobt, werden dabei bloß der Reihe nach sämtliche Schubladen des "coming of age" Themas gezogen, die bei Spätpubertierenden so an der Tagesordnung sind.
Als da vor allen Dingen wären: Die große Liebe, Bandenkriege, mächtige Besäufnisse, der finale Krach mit den Erziehungsberechtigten und der Einzug von Tod und Gewalt in der von Unsterblichkeitsphantasien geprägte Lebensphase. Innovation sieht anders aus!
Punkten hingegen können die ungeschliffenen, eindringlich-ästhetisch durchkomponierten Bilder, die das Lebensgefühl amerikanischer Teenager in den beginnenden 60er Jahren stimmugsvoll eingefangen. Getragen wird die Novelle außerdem von einer hervorragenden Schauspielertruppe, von deren weiteren Werdegang bedauerlicher Weise nie wieder etwas vernommen wurde.
Das mir der Film nur 3 magere Pünktchen entlocken kann, ist hauptsächlich der Tatsache geschuldet, daß ich aus der Thematik des Balzverhaltens adoleszenter Halbstarker komplett ausgestiegen bin und mich die verzweifelten Versuche der Jugendlichen, Frauen aufs peinlichste anzurempeln, nur um irgendwie an Ihren Busen grapschen zu konnen, nicht mehr im geringsten interessieren. Für unsere Kleinen, die sich im selbigen Reifestadium befinden, können wohl in The Wanderers ihre Nöte, Hoffnungen und Probleme wiedergespiegelt sehen, alle anderen können hier maximal Verhaltensforschung betreiben!
Für mich ist The Wanderers nicht viel mehr als Eis am Stiel ohne Homor und nackte Weiber.
Wer ebenfalls in der Bronx aufgewachsen ist, mag hier wehmütig an die finalen Zuckungen seiner Jugendzeit zurückblicken. Mir persönlich ist der Film zu sehr "von der Stange" und bläßt nicht genug frischen Wind auf die Leinwand, um sich für die Ehrenloge meiner Filmsammlung zu empfehlen.
mit 3
mit 3
mit 3
mit 2
bewertet am 23.12.15 um 21:44
Waters hat für seine The Wall Tournee den Bombast seines Konzeptalbums bis an die Grenzen des technisch möglichen ausgelotet.
Während Roger Waters und seine Kompaignons die Klänge eines Jahrhundertalbums zum Besten geben, entfaltet sich auch einer 80m (?) breiten Bühne ein Effekt- und Projektionszauber vom Allerfeinsten. Nicht nur die bekannten Animationen von Alan Parkers genialer Filmversion erwachen hier zum neuen Leben im XXL Format, auch gänzlich unbekannte Videosequenzen von effekthascherischen Großkaliber, lassen dem Zuschauer immer wieder schlagartig die Spucke im Mund verdampfen. Das Spiel mit Farben, Formen und Perspektiven in Kombination mit der tragenden Musik gestaltet sich so übermächtig, daß man vielmehr das Gefühl hat, einem Gottesdienst als einer Rockoper beizuwohnen. Der Hohepriester der Monumentalinszenierung singt seinen willfährigen Jüngern die Messe des musikalischen Größenwahns. Die Fesseln des gewöhnlichen und vorstellbaren werden gesprengt und man verfällt unweigerlich in einen entrückten Zustand der Beseeltheit.
Im Zuge der visuellen Erhöhung, geraten die Musiker, wie nicht anders zu erwarten, eher in den Hintergrund und liefern in erster Linie den Soundtrack für die überwältigende Materialschlacht. Kleine Spielereien, wie Waters Kammerscene, der obligatorische Kinderchor oder Maschinengewehrsalven auf der Bühne, geraten so in den Hintergrund und werden von der Alles verschlingenden Projektionsfläche der Mauer verschluckt.
Initialzündun g für Waters Befreiungsschlag, war die semitherapeutische Aufarbeitung des frühen Todes von seinem Vater im zweiten Weltkrieg, sowie die prägenden Erlebnisse in den Folterkammern der Erziehungsanstalten. Die Loslösung von seinen emotionalen Fesseln unter denen er als junger Mann litt, führte zur Erschaffung des Konzeptalbums von epochaler Relevanz. Soll noch mal einer sagen, Musiktherapie bringt nichts...
Höchstens noch auf Waters Amused to Death LP erreichen Lyrik und Symphonie gleichzeitig eine solch erhabene Perfektion.
Aber genau hier schleicht sich auch der einzige Wehrmuthstropfen ein. Noch immer hat sich Waters von seinem Kindheitstrauma anscheinend nicht berappelt und überschüttet das Konzert mit pazifistischen Botschaften. Riesige Schriftzüge mit Antikriegsparolen geben sich mit Photos von gefallenen Kriegsopfern und brutalen -videoschnipseln die Hand. Die Politisierung der Show mit ihren simplen Slogans nimmt sich dabei im Kontrast zum überbordenen Effektkino eher platt aus. Das Krieg schlecht und brutal ist, hat selbst schon Daniel Kübelbock besungen. Und das nicht viel schlechter.
Die emotionale Aufladung der Show soll dabei Waters Faible für Botschaft und Anspruch gerecht werden, verbittert aber mit den moralinsauren Einspielungen den ungetrübten audio-visuellen Genuss. Das das Konzert dabei immer wieder von realen Spielscenen unterbrochen wird, in denen Waters eine Reise vom Grab des Vaters in England nach Italien, zur letzten Schlachtstätte seines Vaters antritt, ist zwar thematisch eng mit dem Album verbunden, irritiert jedoch auf Grund seines dokumentarischen Charakters und dürfte spätestens beim zweiten mal schauen langweilen, wenn der Reiz des Neuen bereits verblaßt ist. In kurzen Dialogen mit Wegbegleitern wird dabei im Auto allerlei profanes geplaudert. Der Einblick in Waters Gedankenwelt ist zwar interessant, ein großer Philosoph und Charismatiker ist er allerdings nicht. Der Ausritt in die Alltagswelt reißt den Zuschauer zwar immer wieder aus seinen Konzertträumen heraus, hat aber andererseits den Vorteil, daß man nicht vom Konzertbombast erschlagen wird und sich ein Abnutzungseffekt einschleicht. Bleibt zu hoffen, daß Waters jetzt das Kriegsthema erschöpfend abgearbeitet hat und in Zukunft nicht der Humanismusbesoffenheit eines Bono anheimfällt, und die Welt zu missionieren gedenkt.
Benommen von der Größe des Erlebnisses fragt man sich hinterher immer wieder, warum man sich seinerzeit die Gelegenheit hat entgehen lassen, an diesem musikalischen Jahrhundertereigniss Ereigniss teilzuhaben. 500,- Euro Eintrittsgeld können keine Ausrede sein...
Unbedingt auf Beamer gucken!!!
Sound: Dolby Athmos kannte ich bisher noch nicht, gehört aber zum erhabensten, was jemals aus meinen Boxen zu mir ans Ohr gedrungen ist. Der Musik würdig!
Bild: In einigen Konzertscenen sind die roten Farbverläufe etwas scheckig und gemahnen an alte VHS Zeiten. Daher ein Punkt Abzug. Der Rest ist Tip Top!
Extras: Ein paar belanglose Fotos im Booklet und 5 nichtssagende unscharfe Photokarten, die man nach Besichtigung wieder ratlos und peinlich berührt für immer im Schuber verschwinden läßt. Firlefanz!!!
Etwas Besonderes stellt hingegen die Bonus Bluray dar. Nicht, daß die hunderten sekundenlangen Miniclips von Roger Waters inhaltlich überzeugen würden. Nein. Wer schon mal mehr gelacht hat, als wenn Waters spontan mit seiner Trompete in die Kamera pustet (Hi Hi), kann sicherlich auch auf Waters seichte Peace Message verzichten.
Von musikhistorischer Relevanz ist hingegen David Gilmors Gitarrensolo zur Kifferhymne Comfortably Numb, in der Londoner O2 Arena.
Im Outro gesellt sich neben Waters und Gilmour auch noch Nick Mason in die launige Runde und darf, Ehre wem Ehre gebührt, bei Outside the Wall rüstig mit der Rassel klappern. So nah werden sich die verbleibenden Mitglieder der legendären Pink Floyd wohl nie wieder kommen. Schade eigentlich...
Während Roger Waters und seine Kompaignons die Klänge eines Jahrhundertalbums zum Besten geben, entfaltet sich auch einer 80m (?) breiten Bühne ein Effekt- und Projektionszauber vom Allerfeinsten. Nicht nur die bekannten Animationen von Alan Parkers genialer Filmversion erwachen hier zum neuen Leben im XXL Format, auch gänzlich unbekannte Videosequenzen von effekthascherischen Großkaliber, lassen dem Zuschauer immer wieder schlagartig die Spucke im Mund verdampfen. Das Spiel mit Farben, Formen und Perspektiven in Kombination mit der tragenden Musik gestaltet sich so übermächtig, daß man vielmehr das Gefühl hat, einem Gottesdienst als einer Rockoper beizuwohnen. Der Hohepriester der Monumentalinszenierung singt seinen willfährigen Jüngern die Messe des musikalischen Größenwahns. Die Fesseln des gewöhnlichen und vorstellbaren werden gesprengt und man verfällt unweigerlich in einen entrückten Zustand der Beseeltheit.
Im Zuge der visuellen Erhöhung, geraten die Musiker, wie nicht anders zu erwarten, eher in den Hintergrund und liefern in erster Linie den Soundtrack für die überwältigende Materialschlacht. Kleine Spielereien, wie Waters Kammerscene, der obligatorische Kinderchor oder Maschinengewehrsalven auf der Bühne, geraten so in den Hintergrund und werden von der Alles verschlingenden Projektionsfläche der Mauer verschluckt.
Initialzündun g für Waters Befreiungsschlag, war die semitherapeutische Aufarbeitung des frühen Todes von seinem Vater im zweiten Weltkrieg, sowie die prägenden Erlebnisse in den Folterkammern der Erziehungsanstalten. Die Loslösung von seinen emotionalen Fesseln unter denen er als junger Mann litt, führte zur Erschaffung des Konzeptalbums von epochaler Relevanz. Soll noch mal einer sagen, Musiktherapie bringt nichts...
Höchstens noch auf Waters Amused to Death LP erreichen Lyrik und Symphonie gleichzeitig eine solch erhabene Perfektion.
Aber genau hier schleicht sich auch der einzige Wehrmuthstropfen ein. Noch immer hat sich Waters von seinem Kindheitstrauma anscheinend nicht berappelt und überschüttet das Konzert mit pazifistischen Botschaften. Riesige Schriftzüge mit Antikriegsparolen geben sich mit Photos von gefallenen Kriegsopfern und brutalen -videoschnipseln die Hand. Die Politisierung der Show mit ihren simplen Slogans nimmt sich dabei im Kontrast zum überbordenen Effektkino eher platt aus. Das Krieg schlecht und brutal ist, hat selbst schon Daniel Kübelbock besungen. Und das nicht viel schlechter.
Die emotionale Aufladung der Show soll dabei Waters Faible für Botschaft und Anspruch gerecht werden, verbittert aber mit den moralinsauren Einspielungen den ungetrübten audio-visuellen Genuss. Das das Konzert dabei immer wieder von realen Spielscenen unterbrochen wird, in denen Waters eine Reise vom Grab des Vaters in England nach Italien, zur letzten Schlachtstätte seines Vaters antritt, ist zwar thematisch eng mit dem Album verbunden, irritiert jedoch auf Grund seines dokumentarischen Charakters und dürfte spätestens beim zweiten mal schauen langweilen, wenn der Reiz des Neuen bereits verblaßt ist. In kurzen Dialogen mit Wegbegleitern wird dabei im Auto allerlei profanes geplaudert. Der Einblick in Waters Gedankenwelt ist zwar interessant, ein großer Philosoph und Charismatiker ist er allerdings nicht. Der Ausritt in die Alltagswelt reißt den Zuschauer zwar immer wieder aus seinen Konzertträumen heraus, hat aber andererseits den Vorteil, daß man nicht vom Konzertbombast erschlagen wird und sich ein Abnutzungseffekt einschleicht. Bleibt zu hoffen, daß Waters jetzt das Kriegsthema erschöpfend abgearbeitet hat und in Zukunft nicht der Humanismusbesoffenheit eines Bono anheimfällt, und die Welt zu missionieren gedenkt.
Benommen von der Größe des Erlebnisses fragt man sich hinterher immer wieder, warum man sich seinerzeit die Gelegenheit hat entgehen lassen, an diesem musikalischen Jahrhundertereigniss Ereigniss teilzuhaben. 500,- Euro Eintrittsgeld können keine Ausrede sein...
Unbedingt auf Beamer gucken!!!
Sound: Dolby Athmos kannte ich bisher noch nicht, gehört aber zum erhabensten, was jemals aus meinen Boxen zu mir ans Ohr gedrungen ist. Der Musik würdig!
Bild: In einigen Konzertscenen sind die roten Farbverläufe etwas scheckig und gemahnen an alte VHS Zeiten. Daher ein Punkt Abzug. Der Rest ist Tip Top!
Extras: Ein paar belanglose Fotos im Booklet und 5 nichtssagende unscharfe Photokarten, die man nach Besichtigung wieder ratlos und peinlich berührt für immer im Schuber verschwinden läßt. Firlefanz!!!
Etwas Besonderes stellt hingegen die Bonus Bluray dar. Nicht, daß die hunderten sekundenlangen Miniclips von Roger Waters inhaltlich überzeugen würden. Nein. Wer schon mal mehr gelacht hat, als wenn Waters spontan mit seiner Trompete in die Kamera pustet (Hi Hi), kann sicherlich auch auf Waters seichte Peace Message verzichten.
Von musikhistorischer Relevanz ist hingegen David Gilmors Gitarrensolo zur Kifferhymne Comfortably Numb, in der Londoner O2 Arena.
Im Outro gesellt sich neben Waters und Gilmour auch noch Nick Mason in die launige Runde und darf, Ehre wem Ehre gebührt, bei Outside the Wall rüstig mit der Rassel klappern. So nah werden sich die verbleibenden Mitglieder der legendären Pink Floyd wohl nie wieder kommen. Schade eigentlich...
mit 5
mit 4
mit 5
mit 3
bewertet am 22.12.15 um 22:36
Erdbeben zählt trotz seiner 33 Lenze immer noch zu DEN Klassikern seiner Genres.
In unserer überdigitalisierten Zeit, die sich im cineastischen Bereich durch einen ungeheuren Erwartungsdruck an die Zaubereien aus den Trickkisten der CGI Industrie auszeichnet, sind solche Werke wie Erdbeben heute nicht mehr denkbar.
Wo heute ein Overkill der Spezialeffekte über Wohl und Weh an den Kassen entscheidet, war man in der "guten, alten Zeit" genötigt, die Zeit zwischen den Actionsequenzen mit erzählerischer Substanz zu füllen.
Mit Substanz ist hier aber ebenso eine Charakterstudie gemeint, die die gesellschaftlichen und familiären Konflikte der Protagonisten tiefergehend ausleuchtet, als dies in aktuellen Katastrophenfilmen Standard wäre. Dabei entfaltet sich zwar keine erzählerische Komplexität altgriechischer Tragödiengesänge, da die schauspielerischen Talente der Darsteller aber über alle Kritik erhaben ist, wird so ein Unterhaltungswert generiert, der auch ohne Effekthascherei seine Existenzberechtigung besitzt und dem Film so etwas wie Seele einhaucht.
Dadurch, daß der Fokus des Geschehens zunächst primär auf die Handlung und nicht auf den reinen Schauwert gerichtet ist, wird der Zuschauer zudem viel unmittelbarer in die Überlebenskämpfe der Bewohner L.A.'s eingebunden, als dies bei einer oberflächlichen Charakterzeichnung der Fall gewesen wäre. Durch die emotionale Einbindung des Betrachters in die existenziellen Dramen der Protagonisten, wird auch der behutsame, actionarme Aufbau gerne verziehen, da für das emphatische Mitfiebern mit den Schauspielern eine Bindung an dieselben vonnöten ist, die im Schnelldurchlauf eben nicht erreicht werden kann.
Auch wenn die überzeugenden Leistungen der Schauspieler und die semi dokumentarische Begleitung der Darsteller die Hauptattraktionen des Filmes sind, brauchen sich die Spezialeffekte auch vor den heutigen Pendants nicht verstecken. Trotz dem Bombast heutiger Produktionen, in dem ganze Städte und halbe Kontinente in Zeitlupe zerlegt werden, was vor 30 Jahren natürlich noch nicht möglich war, hatte man sich jedoch schon deutlich von den Styroporschlachten der italienischen Sandalenfilme entfernt und dem zahlendem Publikum ein Kulissenscenario vor die staunenden Glupschaugen gesetzt, dem man den Attrappencharakter selbst auf den zweiten Blick nur schwer nachweisen kann.
Dadurch, daß nicht wie bei Godzilla, einfach Opi's Modelleisenbahn dem Erdboden gleichgemacht, sondern in der Vernichtung L.A.'s ein beklemmender Realismus zu Tage tritt, sammelt Erdbeben durch seine Athentizität noch zusätzliche Pluspunkte. Diese überträgt sich auch unmittelbar auf den Zuschauer, der so noch unmittelbarer am Geschehen teilnimmt und den Schutt förmlich auf der eigenen Zunge zu schmecken glaubt.
Oder waren das doch bloß wieder die pampigen Chips aus der Tüte von vorgestern?
Wie dem auch sei, die großen Katastrophenfilme der 70'er, Erdbeben, Flammendes Inferno und Poseidon Inferno sind die einzigen Genrevertreter bisher, die das in dieser Intensität geschafft haben. Dafür werden sie in der Walhalla der Filmwelt auch noch in 100 Jahren von qualitätsbegeisterten Filmjüngern bewundert werden, während sich Emmerichs aufgeblähtes 2012 Desaster dort für alle Ewigkeit den Arsch vor der Tür abfrieren wird....
Das Bild ist leider sehr grieselig und hätte eine bessere Überarbeitung verdient.
Das null komma null Extras auf der Scheibe enthalten sind, ist bei dem Aufwand der Produktion kaum verzeihlich.
In unserer überdigitalisierten Zeit, die sich im cineastischen Bereich durch einen ungeheuren Erwartungsdruck an die Zaubereien aus den Trickkisten der CGI Industrie auszeichnet, sind solche Werke wie Erdbeben heute nicht mehr denkbar.
Wo heute ein Overkill der Spezialeffekte über Wohl und Weh an den Kassen entscheidet, war man in der "guten, alten Zeit" genötigt, die Zeit zwischen den Actionsequenzen mit erzählerischer Substanz zu füllen.
Mit Substanz ist hier aber ebenso eine Charakterstudie gemeint, die die gesellschaftlichen und familiären Konflikte der Protagonisten tiefergehend ausleuchtet, als dies in aktuellen Katastrophenfilmen Standard wäre. Dabei entfaltet sich zwar keine erzählerische Komplexität altgriechischer Tragödiengesänge, da die schauspielerischen Talente der Darsteller aber über alle Kritik erhaben ist, wird so ein Unterhaltungswert generiert, der auch ohne Effekthascherei seine Existenzberechtigung besitzt und dem Film so etwas wie Seele einhaucht.
Dadurch, daß der Fokus des Geschehens zunächst primär auf die Handlung und nicht auf den reinen Schauwert gerichtet ist, wird der Zuschauer zudem viel unmittelbarer in die Überlebenskämpfe der Bewohner L.A.'s eingebunden, als dies bei einer oberflächlichen Charakterzeichnung der Fall gewesen wäre. Durch die emotionale Einbindung des Betrachters in die existenziellen Dramen der Protagonisten, wird auch der behutsame, actionarme Aufbau gerne verziehen, da für das emphatische Mitfiebern mit den Schauspielern eine Bindung an dieselben vonnöten ist, die im Schnelldurchlauf eben nicht erreicht werden kann.
Auch wenn die überzeugenden Leistungen der Schauspieler und die semi dokumentarische Begleitung der Darsteller die Hauptattraktionen des Filmes sind, brauchen sich die Spezialeffekte auch vor den heutigen Pendants nicht verstecken. Trotz dem Bombast heutiger Produktionen, in dem ganze Städte und halbe Kontinente in Zeitlupe zerlegt werden, was vor 30 Jahren natürlich noch nicht möglich war, hatte man sich jedoch schon deutlich von den Styroporschlachten der italienischen Sandalenfilme entfernt und dem zahlendem Publikum ein Kulissenscenario vor die staunenden Glupschaugen gesetzt, dem man den Attrappencharakter selbst auf den zweiten Blick nur schwer nachweisen kann.
Dadurch, daß nicht wie bei Godzilla, einfach Opi's Modelleisenbahn dem Erdboden gleichgemacht, sondern in der Vernichtung L.A.'s ein beklemmender Realismus zu Tage tritt, sammelt Erdbeben durch seine Athentizität noch zusätzliche Pluspunkte. Diese überträgt sich auch unmittelbar auf den Zuschauer, der so noch unmittelbarer am Geschehen teilnimmt und den Schutt förmlich auf der eigenen Zunge zu schmecken glaubt.
Oder waren das doch bloß wieder die pampigen Chips aus der Tüte von vorgestern?
Wie dem auch sei, die großen Katastrophenfilme der 70'er, Erdbeben, Flammendes Inferno und Poseidon Inferno sind die einzigen Genrevertreter bisher, die das in dieser Intensität geschafft haben. Dafür werden sie in der Walhalla der Filmwelt auch noch in 100 Jahren von qualitätsbegeisterten Filmjüngern bewundert werden, während sich Emmerichs aufgeblähtes 2012 Desaster dort für alle Ewigkeit den Arsch vor der Tür abfrieren wird....
Das Bild ist leider sehr grieselig und hätte eine bessere Überarbeitung verdient.
Das null komma null Extras auf der Scheibe enthalten sind, ist bei dem Aufwand der Produktion kaum verzeihlich.
mit 4
mit 3
mit 3
mit 1
bewertet am 17.11.15 um 22:52
Mit einer Überdosis Adrenalin, Blut und Benzin getränkter Männerfilm.
Trotz des Umstandes, daß ich kein bekennender Apostel des Endzeitfilmes bin, da mich die Tristesse postapokalyptischer Trostlosigkeit entvölkerter Landstriche und zerbombter Städte überwiegend anödet, kann Mad Max Fury Road mit einer Vielzahl bis in die allerletzte Minuskel durchchchoreographierter martialischen Actionsequenzen überzeugen.
Die archaischen Stammesrituale und die Überkostümierung des sich im Ausstattungsrausch befindlichen Regisseures überschreiten dabei zwar manchesmal in ihrer comichaften Erhöhung die Grenzen zur Lächerlichkeit, da die Oppulenz des Designs in seiner Übertreibung jedoch in sich homogen ist, wird hier eine stimmige und abgerundete Welt entworfen, in der Schmutz und Dreck mit Blech und Blut eine heilige Allianz eingehen.
Mit Fury Road hat sich Regisseur George Miller noch weiter von der "Realität" entfernt, als in seinen Vorgängern, um sich auf dem "Wüstenplanten" ein ganz eigenes, von Freaks und Mutanten bevölkertes Subuniversum zu erschaffen.
Die Logik des Designs folgt dabei stringent den "survival of the fittest" Mechanismen und gebärt so eine von Petrolpunk-Musclecars bevölkerten Kosmos, die mit den phantastischsten Angriffsmechanismen und Verteidigungspanzerungen ausgestattet sind, die man wohl je gesehen hat und stark an das insektoide Reich archaischer Schalen- und Krustentiere erinnern. Dem Schauwert ist das verdammt zuträglich!!!
Der Plot ist erwartungsgemäß überschaubar. Es geht irgendwie mal wieder um Benzin, Wasser und Freiheit. Was woanders aber eher zu Adrenalinmangelerscheinungen mit Atemlähmung führt, wird hier als keineswegs störend empfunden, da er dadurch seiner primären Funktion, einer bombastisch aufgeblähten Verfolgungsjagd Raum zur Entfaltung zu verschaffen, vollends gerecht wird. Ablenkung durch Romantik o.ä. Weibergesäusel sind hier Fehlanzeige. Selbst die Frauen sind in Millers Desertopia testesterongeschwängerte Kampfmaschinen, die jedem gestandenem Dschihadisten Respekt abnötigen.!
Der Ästhetik der temporeichen Gefechte überdimensionierter Wüstenschiffe vor grandiosen Kulissen, erzeugen eine Sogwirkung, der man sich kaum entziehen kann. Trotz der Weite der Wüste zerfleddert die Handlung nicht in alle Himmelsrichtung, sondern bleibt immer dicht auf den Punkt konzentriert und erschafft so eine intensive Stimmung, die bis zum Ende durchgehalten wird.
Das Miller hier Lichtjahre von mahnenden Ökobotschaften entfernt ist und offensichtlich einfach nur Spaß verbreiten will, läßt sich am besten am Musiktruck (Love Parade läßt grüßen!) festmachen, auf dem sich neben vier martialischen Trommlern, sozusagen als Kühlerfigur, ein starkstromgitarrenspielender Anheizer befindet, der mit seinem feuerspeiendem Instrument die zentrale Botschaft von Fury Road symbolisch zu demonstrieren scheint: Let's Rock!
P.S.: Die 3d Effekte kommen sehr gut zur Geltung und bringen den Kontrast der landschaftlichen Weite mit der stickigen Enge in den Gefechtsständen der rollenden Kampfmaschienen noch besser zum tragen!!!
Trotz des Umstandes, daß ich kein bekennender Apostel des Endzeitfilmes bin, da mich die Tristesse postapokalyptischer Trostlosigkeit entvölkerter Landstriche und zerbombter Städte überwiegend anödet, kann Mad Max Fury Road mit einer Vielzahl bis in die allerletzte Minuskel durchchchoreographierter martialischen Actionsequenzen überzeugen.
Die archaischen Stammesrituale und die Überkostümierung des sich im Ausstattungsrausch befindlichen Regisseures überschreiten dabei zwar manchesmal in ihrer comichaften Erhöhung die Grenzen zur Lächerlichkeit, da die Oppulenz des Designs in seiner Übertreibung jedoch in sich homogen ist, wird hier eine stimmige und abgerundete Welt entworfen, in der Schmutz und Dreck mit Blech und Blut eine heilige Allianz eingehen.
Mit Fury Road hat sich Regisseur George Miller noch weiter von der "Realität" entfernt, als in seinen Vorgängern, um sich auf dem "Wüstenplanten" ein ganz eigenes, von Freaks und Mutanten bevölkertes Subuniversum zu erschaffen.
Die Logik des Designs folgt dabei stringent den "survival of the fittest" Mechanismen und gebärt so eine von Petrolpunk-Musclecars bevölkerten Kosmos, die mit den phantastischsten Angriffsmechanismen und Verteidigungspanzerungen ausgestattet sind, die man wohl je gesehen hat und stark an das insektoide Reich archaischer Schalen- und Krustentiere erinnern. Dem Schauwert ist das verdammt zuträglich!!!
Der Plot ist erwartungsgemäß überschaubar. Es geht irgendwie mal wieder um Benzin, Wasser und Freiheit. Was woanders aber eher zu Adrenalinmangelerscheinungen mit Atemlähmung führt, wird hier als keineswegs störend empfunden, da er dadurch seiner primären Funktion, einer bombastisch aufgeblähten Verfolgungsjagd Raum zur Entfaltung zu verschaffen, vollends gerecht wird. Ablenkung durch Romantik o.ä. Weibergesäusel sind hier Fehlanzeige. Selbst die Frauen sind in Millers Desertopia testesterongeschwängerte Kampfmaschinen, die jedem gestandenem Dschihadisten Respekt abnötigen.!
Der Ästhetik der temporeichen Gefechte überdimensionierter Wüstenschiffe vor grandiosen Kulissen, erzeugen eine Sogwirkung, der man sich kaum entziehen kann. Trotz der Weite der Wüste zerfleddert die Handlung nicht in alle Himmelsrichtung, sondern bleibt immer dicht auf den Punkt konzentriert und erschafft so eine intensive Stimmung, die bis zum Ende durchgehalten wird.
Das Miller hier Lichtjahre von mahnenden Ökobotschaften entfernt ist und offensichtlich einfach nur Spaß verbreiten will, läßt sich am besten am Musiktruck (Love Parade läßt grüßen!) festmachen, auf dem sich neben vier martialischen Trommlern, sozusagen als Kühlerfigur, ein starkstromgitarrenspielender Anheizer befindet, der mit seinem feuerspeiendem Instrument die zentrale Botschaft von Fury Road symbolisch zu demonstrieren scheint: Let's Rock!
P.S.: Die 3d Effekte kommen sehr gut zur Geltung und bringen den Kontrast der landschaftlichen Weite mit der stickigen Enge in den Gefechtsständen der rollenden Kampfmaschienen noch besser zum tragen!!!
mit 4
mit 5
mit 4
mit 3
bewertet am 13.10.15 um 13:21
Trotz liebevoll und detailversessener Ausstattung, die mittlerweile jedoch auch ein absolutes Muß in der Stop-Motion Scene sind, um gegen die Animationskünste von Pixar & Co bestehen zu können, fehlt den Boxtrolls einfach das Salz in der Suppe.
Zu sehr ist man auf Austattungswahnsinn und handgemachte optische Spielereien fixiert, als daß die Handlung mit Witz und Charme gleichgezogen wäre. Mit der Perfektion der Animationen hat man gleichwohl ein neues Leven erreicht (speziell mit der dampfbetriebenen Zerstörungsmaschiene am Ende des Filmes), so daß zwar für allerlei visuellen Kurzweil gesorgt ist, durch das Verzichten auf Humor und Spannung zugunsten einer harmlos netten Geschichte, die von Seichtheit und Vorhersehbarkeit nur so trotzt, ist der Film über 90 min. nur für die allerkleinsten unter uns zu empfehlen.
Ältere hingegen werden den anarchischen Humor und die intelligenten Referenzen an literarische oder cineastische Monumente schmerzlich vermissen und auf die anbiedernde Gefälligkeit der Boxtrolls mit gepflegten Gähnen reagieren.
Ist dem Studio mit Caroline noch ein phantastisches Glanzstück mit leicht morbidem Unterton ala Tim Burdon gelungen, so driftet man mittlerweile immer mehr in die Gefilde seichter Belanglosigkeit ab.
Bei all der Mühe, die man sich mit der Requisite und der Animation gegeben hat, wäre es schade, wenn das Genre, wie im vorliegenden Falle, durch erzählerische Einfältigkeit zu Grabe getragen werden müßte.
Der 3D Effekt ist wie immer bei Stop-Motion Filmen grandios, auch wenn hier zu meinem Bedauern etwas zu sehr auf Effekthascherei verzichtet wurde.
Zu sehr ist man auf Austattungswahnsinn und handgemachte optische Spielereien fixiert, als daß die Handlung mit Witz und Charme gleichgezogen wäre. Mit der Perfektion der Animationen hat man gleichwohl ein neues Leven erreicht (speziell mit der dampfbetriebenen Zerstörungsmaschiene am Ende des Filmes), so daß zwar für allerlei visuellen Kurzweil gesorgt ist, durch das Verzichten auf Humor und Spannung zugunsten einer harmlos netten Geschichte, die von Seichtheit und Vorhersehbarkeit nur so trotzt, ist der Film über 90 min. nur für die allerkleinsten unter uns zu empfehlen.
Ältere hingegen werden den anarchischen Humor und die intelligenten Referenzen an literarische oder cineastische Monumente schmerzlich vermissen und auf die anbiedernde Gefälligkeit der Boxtrolls mit gepflegten Gähnen reagieren.
Ist dem Studio mit Caroline noch ein phantastisches Glanzstück mit leicht morbidem Unterton ala Tim Burdon gelungen, so driftet man mittlerweile immer mehr in die Gefilde seichter Belanglosigkeit ab.
Bei all der Mühe, die man sich mit der Requisite und der Animation gegeben hat, wäre es schade, wenn das Genre, wie im vorliegenden Falle, durch erzählerische Einfältigkeit zu Grabe getragen werden müßte.
Der 3D Effekt ist wie immer bei Stop-Motion Filmen grandios, auch wenn hier zu meinem Bedauern etwas zu sehr auf Effekthascherei verzichtet wurde.
mit 3
mit 5
mit 4
mit 3
bewertet am 28.07.15 um 14:09
Bei Jupiter Ascending haben wir es mit einem überwältigendem Bilderrausch zu tun, an dem man sich kaum sattsehen mag, der jedoch leider nur lose durch eine comichaft dürftige Story zusammengehalten wird, was den Gesamteindruck unterm Strich stark schmälert.
So atemberaubend die spektakulären Weltraumscenen auch in Scene gesetzt sind und den Zuschauer zum Schwelgen in intergalaktischen Dimensionen einladen, so wenig kreative Unterstützung erhält das oppulente Schauspiel von Seiten der schreibenden Gilde.
Durch das fokussieren auf das extravagente, bisweilen schwulstig schwule Set- und Fashiondesign im Stile eines Versages, welches in seiner Oppulenz zuweilen erdrückend wirkt, geraten die für Spannung und intellektuellen Nervenkitzel zuständigen Abteilungen ins Hintertreffen. Anstatt die opernhaft aufgeblähten Schauwerte mit schweißtreibender Dramaturgie und philosophischer Relevanz zu unterfüttern, wie es den Wachowski Brüdern ja auch schon mit Matrix und Cloud Atlas gelungen ist, wird eine lauwarme Liebesgeschichte auf der Aschenbrödelthematik basierendem Niveau erzählt, die um eine Handvoll Schurken und ein intergalaktisches Ringelrangelroseerbfolgeintrig enspielchen erweitert wurde.
Durchweg erscheint die Geschichte um ein Erdenmädchen, welches die Inkarnation (oder Seelenverwandte ???) eines außerirdischen menschlichen Königsgeschlechtes sein soll zu sehr konstruiert und man wird den ganzen Film über den Eindruck nicht los, daß die Geschichte zu sehr als Lückenfüller für einen gigantischen Videoclip dient. Auch kann man nicht wirklich von Innovation sprechen, wenn sich im Laufe der Geschichte herauskristallisiert, daß die Erde nur als künstlich angelegte Biokultur entpuppt, die ab einer bestimmten Populationszahl abgeerntet werden muß, um ein lebenverlängerndes Elixier zu gewinnen, welches den extraterristischen Humanoiden als Jungbrunnen dient.
Das Jupiters Hauptmotivation die Erde zu retten hauptsächlich darin besteht, ihre bewußt prollig inszenierte russische Auswanderfamilie zu retten, soll wohl als flammendes Plädoier für das gewöhnliche allzu menschliche herhalten, wirkt doch in letzter Konsequenz einfach nur platt.
Anstatt also wie in Cloud Atlas und Matrix eine außergewöhnliche Story mit ausgefeilten optischen Finessen zu ummanteln, wird hier genau der umgekehrte Weg eingeschlagen. Man paßt sich dem Zeitgeist der Actiontrotzenden Marvelverfilmungen an und unterfüttert ein bombastisches Actiongewitter mit seichter, leichtverdaulicher Soapkost.
Selbst die Schauspieler mit ihren zweidimensionalen Charakterzeichnungen kommen nicht über eine schematische Gut-Böse Komplexität hinaus und schaffen es zu keinem Zeitpunkt, sich von ihren Stereotypen zu lösen, sich von der visuellen Oppulenz zu emanzipieren und ihren Figuren so etwas wie Persönlichkeit einzuhauchen. Das man bis zum Ende das Gefühl hat, die Geschichte nur halb erzählt zu bekommen, verstärkt den Eindruck, daß die Wachowskis das Interesse an sinniger und tiefgründiger Materie vorerst verloren zu haben scheinen, diesem zur Zeit sogar mit Desinteresse begegnen.
Es macht ganz den Eindruck, als wollten sie sich von ihren bedeutungsschwangeren Werken wie Cloud Atlas etwas erholen, die neun mal gerade sein lassen und auf Distanz zu ihren kopflastigen Werken gehen, um ganz einfach mal simpel Spaß zu haben und ihrem Hang zur Manga- und Sci-Fi Subkultur nach Lust und Laune ungehindert zu fröhnen.
Bei all der überbordenden Phantasie und Kreativität, der den Wachowski Geschwistern zu eigen ist, fällt es sicherlich schwer, das richtige Augenmaß zu halten. Was ihnen in ihren bisherigen Filmen grßteils geglückt ist, scheint hier etwas aus dem Ruder gelaufen zu sein. Denn neben feschen Schwebemotorrad Reiterin, die direkt aus der Mangakultur entsprungen zu sein scheinen und geflügelten Weltraumkrokodilen, bevölkern noch andere skurille Wesen und Androiden die Weiten des Universums, wirken jedoch, wie in einigen anderen Sci-Fi Filmen auch, nicht aus einem Guß und unhomogen. Dadurch wirkt die Jupiter Ascending Welt nicht in sich stimmig, sondern brüchig und fraktionär, welches einem ungetrübten, abgerundetem Filmgenuß im Wege steht.
So ist dem Fim zwar eine Leichtigkeit zu eigen, die keinerlei geistige Auseinandersetzung mit der Materie fordert und auf Grund der Substanzlosigkeit der Handlung trotz zugegeben kurzweiliger Inszenierung sogar verärgert, dessen kongeniale Schauwerte aber jedem selbst halbseriösem Sci-Fi Fan unbedingt ans Herz zu legen sind. Denn bei all der berechtigten Kritik, läßt sich nicht verhehlen, daß der Film mitunter zuweilen richtig Spaß gemacht hat...
So atemberaubend die spektakulären Weltraumscenen auch in Scene gesetzt sind und den Zuschauer zum Schwelgen in intergalaktischen Dimensionen einladen, so wenig kreative Unterstützung erhält das oppulente Schauspiel von Seiten der schreibenden Gilde.
Durch das fokussieren auf das extravagente, bisweilen schwulstig schwule Set- und Fashiondesign im Stile eines Versages, welches in seiner Oppulenz zuweilen erdrückend wirkt, geraten die für Spannung und intellektuellen Nervenkitzel zuständigen Abteilungen ins Hintertreffen. Anstatt die opernhaft aufgeblähten Schauwerte mit schweißtreibender Dramaturgie und philosophischer Relevanz zu unterfüttern, wie es den Wachowski Brüdern ja auch schon mit Matrix und Cloud Atlas gelungen ist, wird eine lauwarme Liebesgeschichte auf der Aschenbrödelthematik basierendem Niveau erzählt, die um eine Handvoll Schurken und ein intergalaktisches Ringelrangelroseerbfolgeintrig enspielchen erweitert wurde.
Durchweg erscheint die Geschichte um ein Erdenmädchen, welches die Inkarnation (oder Seelenverwandte ???) eines außerirdischen menschlichen Königsgeschlechtes sein soll zu sehr konstruiert und man wird den ganzen Film über den Eindruck nicht los, daß die Geschichte zu sehr als Lückenfüller für einen gigantischen Videoclip dient. Auch kann man nicht wirklich von Innovation sprechen, wenn sich im Laufe der Geschichte herauskristallisiert, daß die Erde nur als künstlich angelegte Biokultur entpuppt, die ab einer bestimmten Populationszahl abgeerntet werden muß, um ein lebenverlängerndes Elixier zu gewinnen, welches den extraterristischen Humanoiden als Jungbrunnen dient.
Das Jupiters Hauptmotivation die Erde zu retten hauptsächlich darin besteht, ihre bewußt prollig inszenierte russische Auswanderfamilie zu retten, soll wohl als flammendes Plädoier für das gewöhnliche allzu menschliche herhalten, wirkt doch in letzter Konsequenz einfach nur platt.
Anstatt also wie in Cloud Atlas und Matrix eine außergewöhnliche Story mit ausgefeilten optischen Finessen zu ummanteln, wird hier genau der umgekehrte Weg eingeschlagen. Man paßt sich dem Zeitgeist der Actiontrotzenden Marvelverfilmungen an und unterfüttert ein bombastisches Actiongewitter mit seichter, leichtverdaulicher Soapkost.
Selbst die Schauspieler mit ihren zweidimensionalen Charakterzeichnungen kommen nicht über eine schematische Gut-Böse Komplexität hinaus und schaffen es zu keinem Zeitpunkt, sich von ihren Stereotypen zu lösen, sich von der visuellen Oppulenz zu emanzipieren und ihren Figuren so etwas wie Persönlichkeit einzuhauchen. Das man bis zum Ende das Gefühl hat, die Geschichte nur halb erzählt zu bekommen, verstärkt den Eindruck, daß die Wachowskis das Interesse an sinniger und tiefgründiger Materie vorerst verloren zu haben scheinen, diesem zur Zeit sogar mit Desinteresse begegnen.
Es macht ganz den Eindruck, als wollten sie sich von ihren bedeutungsschwangeren Werken wie Cloud Atlas etwas erholen, die neun mal gerade sein lassen und auf Distanz zu ihren kopflastigen Werken gehen, um ganz einfach mal simpel Spaß zu haben und ihrem Hang zur Manga- und Sci-Fi Subkultur nach Lust und Laune ungehindert zu fröhnen.
Bei all der überbordenden Phantasie und Kreativität, der den Wachowski Geschwistern zu eigen ist, fällt es sicherlich schwer, das richtige Augenmaß zu halten. Was ihnen in ihren bisherigen Filmen grßteils geglückt ist, scheint hier etwas aus dem Ruder gelaufen zu sein. Denn neben feschen Schwebemotorrad Reiterin, die direkt aus der Mangakultur entsprungen zu sein scheinen und geflügelten Weltraumkrokodilen, bevölkern noch andere skurille Wesen und Androiden die Weiten des Universums, wirken jedoch, wie in einigen anderen Sci-Fi Filmen auch, nicht aus einem Guß und unhomogen. Dadurch wirkt die Jupiter Ascending Welt nicht in sich stimmig, sondern brüchig und fraktionär, welches einem ungetrübten, abgerundetem Filmgenuß im Wege steht.
So ist dem Fim zwar eine Leichtigkeit zu eigen, die keinerlei geistige Auseinandersetzung mit der Materie fordert und auf Grund der Substanzlosigkeit der Handlung trotz zugegeben kurzweiliger Inszenierung sogar verärgert, dessen kongeniale Schauwerte aber jedem selbst halbseriösem Sci-Fi Fan unbedingt ans Herz zu legen sind. Denn bei all der berechtigten Kritik, läßt sich nicht verhehlen, daß der Film mitunter zuweilen richtig Spaß gemacht hat...
mit 3
mit 5
mit 5
mit 2
bewertet am 15.07.15 um 11:26
Ästhetisch unterkühlte Sci-Fi Novelle, die auf linear-spartanische Handlung setzt, auf Grund eines überzeugend performenden Tom Cruise, faszinierenden Kulissen und stimmigen Details jedoch (fast) vollends überzeugt.
Jack Harper und seine Frau Victoria leben in einem Appartment in den Wolken einer postapokalyptischen Erde des Jahres 2077. 60 Jahre zuvor wurde die Erde im Kampf mit Außerirdischen nuklar vernichtet. Die Erdlinge haben sich auf einen Tetraeder (TET) und auf den Sturnmond Titan zurückgezogen. Die benötigte Energie für ihre extraterristrische Existenz beziehen sie aus riesigen Deuteriumspeichern, die dem Meer Wasserstoff entziehen. Jacks und Victorias Aufgabe besteht darin, die Drohnen zu überwachen, die Jagd auf die nüberlebenden Ausserirdischen zu machen, die sich unter die Erde zurückgezogen haben und die Deuteriumspeicher sabotieren wollen.
Als Jack eines Tages abstürzt, kommt es zum Kontakt mit den vermeintlichen Ausserirdischen. Dieser Kontakt stellt alles auf den Kopf, was er über sich und die Welt gewußt und gedacht hatte und er macht sich auf, nach der Wahrheit zu suchen...
Auch wenn Oblivion im Grunde nicht viel Neues erzählt und auf viele altbewährte Sci-Fi Evergreens zurückgreift, fällt er durch seine angenehm ernsthaft erwachsene Inszenierung im Umfeld modernem Weltraum Klamauk wie Guardians of the Galaxy angenehm auf. Auch wenn der Film nicht wie 2001 an den Grundfragen der Existenz herumdoktort, beschäftigt er sich immerhin im Subkontext mit der Frage der eigenen Identität. Das Vexierspiel von Sein und Schein wurde zwar schon in Total Recall erschöpfend behandelt, hat aber, wenn es in eine stimmige Rahmenhandlung eingebettet ist, nichts von seiner Berechtigung verloren.
Auch fällt die karge Kommunikation, die sich fast ausschließlich auf Arbeitsanweisungen beschränkt, angenehm auf und hebt sich von moderner Dampfplauderei, bei der jeder Satz auf Teufel komm raus mindestens Zitatqualität besitzen oder zumindest irgendwie cool wirken muß, angenehm ab.
Der Wehmutstropfen bezieht sich in erster Linie auf den Novellenhaften Charakter der Erzählung, der vieles im Umfeld der Invasion im Unjklaren läßt und so eine Einbettung in das große Ganze verhindert.
Von diesem kleinen Makel mal abgesehen, verspricht Oblivion aber jedem Feund gehobener traditioneller Sci-Fi Kost, ein kleines aber feines vier Sterne Menü...
Jack Harper und seine Frau Victoria leben in einem Appartment in den Wolken einer postapokalyptischen Erde des Jahres 2077. 60 Jahre zuvor wurde die Erde im Kampf mit Außerirdischen nuklar vernichtet. Die Erdlinge haben sich auf einen Tetraeder (TET) und auf den Sturnmond Titan zurückgezogen. Die benötigte Energie für ihre extraterristrische Existenz beziehen sie aus riesigen Deuteriumspeichern, die dem Meer Wasserstoff entziehen. Jacks und Victorias Aufgabe besteht darin, die Drohnen zu überwachen, die Jagd auf die nüberlebenden Ausserirdischen zu machen, die sich unter die Erde zurückgezogen haben und die Deuteriumspeicher sabotieren wollen.
Als Jack eines Tages abstürzt, kommt es zum Kontakt mit den vermeintlichen Ausserirdischen. Dieser Kontakt stellt alles auf den Kopf, was er über sich und die Welt gewußt und gedacht hatte und er macht sich auf, nach der Wahrheit zu suchen...
Auch wenn Oblivion im Grunde nicht viel Neues erzählt und auf viele altbewährte Sci-Fi Evergreens zurückgreift, fällt er durch seine angenehm ernsthaft erwachsene Inszenierung im Umfeld modernem Weltraum Klamauk wie Guardians of the Galaxy angenehm auf. Auch wenn der Film nicht wie 2001 an den Grundfragen der Existenz herumdoktort, beschäftigt er sich immerhin im Subkontext mit der Frage der eigenen Identität. Das Vexierspiel von Sein und Schein wurde zwar schon in Total Recall erschöpfend behandelt, hat aber, wenn es in eine stimmige Rahmenhandlung eingebettet ist, nichts von seiner Berechtigung verloren.
Auch fällt die karge Kommunikation, die sich fast ausschließlich auf Arbeitsanweisungen beschränkt, angenehm auf und hebt sich von moderner Dampfplauderei, bei der jeder Satz auf Teufel komm raus mindestens Zitatqualität besitzen oder zumindest irgendwie cool wirken muß, angenehm ab.
Der Wehmutstropfen bezieht sich in erster Linie auf den Novellenhaften Charakter der Erzählung, der vieles im Umfeld der Invasion im Unjklaren läßt und so eine Einbettung in das große Ganze verhindert.
Von diesem kleinen Makel mal abgesehen, verspricht Oblivion aber jedem Feund gehobener traditioneller Sci-Fi Kost, ein kleines aber feines vier Sterne Menü...
mit 4
mit 5
mit 5
mit 2
bewertet am 12.06.15 um 12:04
Durchschnittlliches Katastrophen Kasperletheater mit akzeptablen Effekten, überflüßiger Rahmenhandlung und mieser Dramaturgie.
Einem verschworenen Haufen Storm Hunters wird der Geldhahn zugedreht, da er seit einem Jahr keinen Tornado mehr vor die Flinte bekommen hat. Ihre letzte Hoffnung liegt nun in Silverton, wo gerade die Highschoolabschlußfeier statt findet.
Nach anfänglich enttäuschenden Wetternachrichten, besinnt sich das Tiefdruckgebiet eines besseren und beschließt ein Feuerwerk der Windhosen über Silverton abzufackeln und das behutsame Landleben empfindlich zu stören.
Dabei werden, oh Wunder, die Vitas der Stormhunters und des Schuldirektors bunt durcheinander gewirbelt und sorgen so für allerlei Tohubawu in der Schicksalsgemeinschaft.
Wird der Todestornado am Ende des Filmes alle Protagonisten auslöschen oder werden sie nach dieser existenziellen Reise als geläuterte Wesen, die sich auf die wahren menschlichen, amerikanischen, Werte zurückbesinnen, über unseren Planeten wandeln?
Die Antwort ist natürlich vorhersehbar. Aber leider ist die persönlichee Reise der Figuren zu ihrem besseren Selbst, im Angesicht eines Katastrophenfilmes nicht nur überflüßig, sondern zudem von beschämend dürftiger Qualität. Ob es nun der Schuldirektor ist, der seine zwei Blagen vernachläßigt und einem davon das Gefühl gibt nur minder geliebt zu werden, die alleinerziehende Sturmjägerin die mit ihrer 4 jährigen süßen Tochter nur über Skype kommuniziert und sich deshalb mit Selbstvorwürfen zerfleischt oder die beiden Clowns in der Geschichte, die Dorffreaks, die mit ihren dümmlich-pubertierenden Akrobatikvideos versuchen auf youtube Eindruck zu schinden um so an die Mädels ranzukommen. Welchen Aspekt man sich auch herausfiltert, ärgerlich bis richtig nervig sind sie alle.
Die kompletten Dialoge spielen sich auf konsequent einfältigen Niveau, welches auf unterem Soap Niveau anzusiedeln ist, ab. Da man beschloßen hatte, ca. 2/3 des Filmes den Problemen pupertierenden Kids und Gewißensbißen alleinerziehenden Damen zu widmen, hätten einigermaßen interessante Charaktere und spannendere zwischenmenschliche Konstellationen sicherlich mehr Unterhaltungswert gehabt.
Suggeriert der Trailer doch einen handkantenfesten Actionfilm, entpuppt sich Storm Hunters unter Realbedingungen als dramaturgisches Dilemma, bei dem nicht nur die ewigen Handkameraaufnahmen der Protagonisten nerven, sondern der sich gerade in den zwischenmenschlichen Sequenzen als so zäh und langweilig entpuppt, daß auch die wohlfeile Effekthascherei dafür kaum noch zu entschädigen mag. Sobald der Sturm loslegt, übermannt einen schon sofort das bange Gefühl, sobald der Wind wieder den Fuß vom Gaspedal nimmt, von uninteressanten Menschen und ihren dünnen Gesabber gemartert zu werden. Die qualitative Divergenz der Real und Actionscenen ist so groß, daß die passablen Sturmscenen unterm Strich nicht für das emotionale Höllenfeuer entschädigen, durch das der Zuschauer waten muß, um Augenzeuge des finalen Süpertornados zu werden.
Eine Reduktion auf reines Bumm und Krach Kino wäre dem Film definitiv zuträglich gewesen.....!
Einem verschworenen Haufen Storm Hunters wird der Geldhahn zugedreht, da er seit einem Jahr keinen Tornado mehr vor die Flinte bekommen hat. Ihre letzte Hoffnung liegt nun in Silverton, wo gerade die Highschoolabschlußfeier statt findet.
Nach anfänglich enttäuschenden Wetternachrichten, besinnt sich das Tiefdruckgebiet eines besseren und beschließt ein Feuerwerk der Windhosen über Silverton abzufackeln und das behutsame Landleben empfindlich zu stören.
Dabei werden, oh Wunder, die Vitas der Stormhunters und des Schuldirektors bunt durcheinander gewirbelt und sorgen so für allerlei Tohubawu in der Schicksalsgemeinschaft.
Wird der Todestornado am Ende des Filmes alle Protagonisten auslöschen oder werden sie nach dieser existenziellen Reise als geläuterte Wesen, die sich auf die wahren menschlichen, amerikanischen, Werte zurückbesinnen, über unseren Planeten wandeln?
Die Antwort ist natürlich vorhersehbar. Aber leider ist die persönlichee Reise der Figuren zu ihrem besseren Selbst, im Angesicht eines Katastrophenfilmes nicht nur überflüßig, sondern zudem von beschämend dürftiger Qualität. Ob es nun der Schuldirektor ist, der seine zwei Blagen vernachläßigt und einem davon das Gefühl gibt nur minder geliebt zu werden, die alleinerziehende Sturmjägerin die mit ihrer 4 jährigen süßen Tochter nur über Skype kommuniziert und sich deshalb mit Selbstvorwürfen zerfleischt oder die beiden Clowns in der Geschichte, die Dorffreaks, die mit ihren dümmlich-pubertierenden Akrobatikvideos versuchen auf youtube Eindruck zu schinden um so an die Mädels ranzukommen. Welchen Aspekt man sich auch herausfiltert, ärgerlich bis richtig nervig sind sie alle.
Die kompletten Dialoge spielen sich auf konsequent einfältigen Niveau, welches auf unterem Soap Niveau anzusiedeln ist, ab. Da man beschloßen hatte, ca. 2/3 des Filmes den Problemen pupertierenden Kids und Gewißensbißen alleinerziehenden Damen zu widmen, hätten einigermaßen interessante Charaktere und spannendere zwischenmenschliche Konstellationen sicherlich mehr Unterhaltungswert gehabt.
Suggeriert der Trailer doch einen handkantenfesten Actionfilm, entpuppt sich Storm Hunters unter Realbedingungen als dramaturgisches Dilemma, bei dem nicht nur die ewigen Handkameraaufnahmen der Protagonisten nerven, sondern der sich gerade in den zwischenmenschlichen Sequenzen als so zäh und langweilig entpuppt, daß auch die wohlfeile Effekthascherei dafür kaum noch zu entschädigen mag. Sobald der Sturm loslegt, übermannt einen schon sofort das bange Gefühl, sobald der Wind wieder den Fuß vom Gaspedal nimmt, von uninteressanten Menschen und ihren dünnen Gesabber gemartert zu werden. Die qualitative Divergenz der Real und Actionscenen ist so groß, daß die passablen Sturmscenen unterm Strich nicht für das emotionale Höllenfeuer entschädigen, durch das der Zuschauer waten muß, um Augenzeuge des finalen Süpertornados zu werden.
Eine Reduktion auf reines Bumm und Krach Kino wäre dem Film definitiv zuträglich gewesen.....!
mit 2
mit 4
mit 4
mit 2
bewertet am 12.06.15 um 11:19
"Trash in Perfektion", oder "In China hat man wohl nicht nur Opium geraucht..."
...denn selbst Cheech und Chong hätten selbst in ihren kühnsten Haschträumen nicht annährend solch einen Mumpitz verzapfen können, wie ihn die Asiaten anscheinend federleicht aus ihren Hemdsärmeln schütteln.
Davon ab, würde sich auch im Westen aus Angst vor einer ausgedehnten psychiatrischen Karriere mit ungewißem Ausgang niemand trauen, solch handfesten Unsinn unters verdutzte Volk zu jubeln.
Was die Shaw Brüder hier unter Mittäterschaft japanischer Trashfilmveteranen zustande gebracht haben, krempelt selbst dem hartgesottenstem Trivialfilmexperten die Reiki auf links und läßt ihn unter dem Einfluß der nicht enden wollenden Nonsensparade den Glauben an ein gutes Ende der Welt verlieren...
...oder aber eben in Jubelarien ausbrechen läßt.
Wenn der Inframan, eine Art Vorläufer des Iron Mans, den Schergen aus der Unterwelt den Garaus macht, dann ist das so schlecht, daß man nicht weiß, ob man sich der Veranstaltung aus Rücksicht auf die eigene geistige Gesundheit entziehen, oder stattdessen die totale kreative Anarchie bejubeln soll....
Nach einem Erdbeben erwacht Dämona (mal als Mensch, mal als Drache) mit ihren höllischen Dämonenschar zu neuem Leben. Jahrtausende lang waren sie im Teufelsberg gefangen und von giftigen Gasen eingeschläfert gewesen.
Zum Glück orakelt der weise Professor Chan die forsche Forderung der Urzeitungeheuer schon frühzeitig: Sie könnten sich noch immer als die Beherrscher der Erde fühlen und die Menschen als Parasiten betrachten, die es auszurotten gilt.
Selbstverständlich hat der Professor damit den Nagel genau auf den Kopf getroffen und seine schlimmsten Befürchtungen werden wahr: Dämona entfesselt unmittelbar nach ihrem erscheinen auf dem Angesicht der Erde ihre Armee der Finsternis (Latexpopel und Styroporbastelarbeiten, die allesamt aussehen wie von 6 Klässern zusammengeschusterte Karies- und Mundgeruchmonster aus den Zahnarztpraxisheftchen) und schickt ihre Söldner des Verderbens in den Kampf, die humane Spezies auf immer und ewig vom Antlitz der Erde zu tilgen.
Zuerst probiert Dämona dies mit einem Tentakelungetüm, welches sie auf die Forschungseinrichtung loshetzt. Mit seinen mächtigen Ranken attackiert der Wurzelsepp Professor Chan und richtet ein infernalisches Gemetzel unter den Wissenschaftlern an. Doch bevor das Labor vernichtet werden kann, gelingt es Chan, in seiner Geheimkammer den Kämpfer Ray durch elektronische Neurostimmulationen in den SUPER-INFRA MAN zu verwandeln. Eine Art Prototyphybrid aus Iron Man und Captain America.
Mit dieser Wunderwaffe in der Hand klammert sich die Menschheit an das letzte Fünkchen Hoffnung. Wird es dem Infra Man gelingen, sich gegen die Pappmonster zu behaupten? Sind seine roten Infra Strahlen stärker als die gelben Ultra Strahlen seiner Gegner?, ist das Schicksal der Welt in seinen fliegenden Handschuhen gut aufgehoben und kann er das scheinbar sichere Ende unserer Spezien noch aufhalten? und vor allem: ist sein Kung Fu besser als das der mörderischen Kampfroboter, die keine Skrupel kennen, ihre an Spiralen aufgehängten Köpfe als tückische Wurfsterne zu mißbrauchen?
All das soll hier nicht verraten werden, um die Hochspannung nicht zu gefährden.
Fest steht nur, das sich in 90 min. selten soviel schwachsinnige Ideen die Klinke in die Hand gegeben haben, wie hier in dieser Trivialfilmikone, deren intellektueller Amoklauf ein Alleinstellungsmerkmal haben dürfte.
Mit der Befreiung des Drehbuches von Intellektueller Vernunft, verweisen die Shaw Brothers auf eine transzendente Ebene jenseits des Verstandes und vollenden somit Emanuel Kants Kritik an derselben. Damit erfährt die Philosophie der Metaphysik aus dem späten 18 Jahrhundert 1975 im fernen China gleichzeitig ihren Höhepunkt und ihre Vollendung.
Selbst Alejandro Jodorowski's Werke wirken dazu im Vergleich wie sozialrealistisches Aufklärungskino aus dem italien der 50er Jahre und können filmhistorisch nur als stümperhafte Vorbereitung auf dieses Meisterwerk angesehen werden.
Go INFRA-MAN, go....
P.S.: Auch wenn man sich unmöglich mehr Trash als in "Invasion aus dem Innern der Erde" vorstellen kann, wirkt die Inszenierung ein wenig hölzern und hält somit nicht mit dem direkten Vergleich der naiven Spielfreude der Japanischen Gummibärchenfilme stand. Daher ein Pünktchen Abzug!
Bild und Ton sind tadellos und weisen nur bedingte Mängel bezüglich des antiquitierten Ausgangmateriales auf. Echte Liebhaberarbeit eben...
...denn selbst Cheech und Chong hätten selbst in ihren kühnsten Haschträumen nicht annährend solch einen Mumpitz verzapfen können, wie ihn die Asiaten anscheinend federleicht aus ihren Hemdsärmeln schütteln.
Davon ab, würde sich auch im Westen aus Angst vor einer ausgedehnten psychiatrischen Karriere mit ungewißem Ausgang niemand trauen, solch handfesten Unsinn unters verdutzte Volk zu jubeln.
Was die Shaw Brüder hier unter Mittäterschaft japanischer Trashfilmveteranen zustande gebracht haben, krempelt selbst dem hartgesottenstem Trivialfilmexperten die Reiki auf links und läßt ihn unter dem Einfluß der nicht enden wollenden Nonsensparade den Glauben an ein gutes Ende der Welt verlieren...
...oder aber eben in Jubelarien ausbrechen läßt.
Wenn der Inframan, eine Art Vorläufer des Iron Mans, den Schergen aus der Unterwelt den Garaus macht, dann ist das so schlecht, daß man nicht weiß, ob man sich der Veranstaltung aus Rücksicht auf die eigene geistige Gesundheit entziehen, oder stattdessen die totale kreative Anarchie bejubeln soll....
Nach einem Erdbeben erwacht Dämona (mal als Mensch, mal als Drache) mit ihren höllischen Dämonenschar zu neuem Leben. Jahrtausende lang waren sie im Teufelsberg gefangen und von giftigen Gasen eingeschläfert gewesen.
Zum Glück orakelt der weise Professor Chan die forsche Forderung der Urzeitungeheuer schon frühzeitig: Sie könnten sich noch immer als die Beherrscher der Erde fühlen und die Menschen als Parasiten betrachten, die es auszurotten gilt.
Selbstverständlich hat der Professor damit den Nagel genau auf den Kopf getroffen und seine schlimmsten Befürchtungen werden wahr: Dämona entfesselt unmittelbar nach ihrem erscheinen auf dem Angesicht der Erde ihre Armee der Finsternis (Latexpopel und Styroporbastelarbeiten, die allesamt aussehen wie von 6 Klässern zusammengeschusterte Karies- und Mundgeruchmonster aus den Zahnarztpraxisheftchen) und schickt ihre Söldner des Verderbens in den Kampf, die humane Spezies auf immer und ewig vom Antlitz der Erde zu tilgen.
Zuerst probiert Dämona dies mit einem Tentakelungetüm, welches sie auf die Forschungseinrichtung loshetzt. Mit seinen mächtigen Ranken attackiert der Wurzelsepp Professor Chan und richtet ein infernalisches Gemetzel unter den Wissenschaftlern an. Doch bevor das Labor vernichtet werden kann, gelingt es Chan, in seiner Geheimkammer den Kämpfer Ray durch elektronische Neurostimmulationen in den SUPER-INFRA MAN zu verwandeln. Eine Art Prototyphybrid aus Iron Man und Captain America.
Mit dieser Wunderwaffe in der Hand klammert sich die Menschheit an das letzte Fünkchen Hoffnung. Wird es dem Infra Man gelingen, sich gegen die Pappmonster zu behaupten? Sind seine roten Infra Strahlen stärker als die gelben Ultra Strahlen seiner Gegner?, ist das Schicksal der Welt in seinen fliegenden Handschuhen gut aufgehoben und kann er das scheinbar sichere Ende unserer Spezien noch aufhalten? und vor allem: ist sein Kung Fu besser als das der mörderischen Kampfroboter, die keine Skrupel kennen, ihre an Spiralen aufgehängten Köpfe als tückische Wurfsterne zu mißbrauchen?
All das soll hier nicht verraten werden, um die Hochspannung nicht zu gefährden.
Fest steht nur, das sich in 90 min. selten soviel schwachsinnige Ideen die Klinke in die Hand gegeben haben, wie hier in dieser Trivialfilmikone, deren intellektueller Amoklauf ein Alleinstellungsmerkmal haben dürfte.
Mit der Befreiung des Drehbuches von Intellektueller Vernunft, verweisen die Shaw Brothers auf eine transzendente Ebene jenseits des Verstandes und vollenden somit Emanuel Kants Kritik an derselben. Damit erfährt die Philosophie der Metaphysik aus dem späten 18 Jahrhundert 1975 im fernen China gleichzeitig ihren Höhepunkt und ihre Vollendung.
Selbst Alejandro Jodorowski's Werke wirken dazu im Vergleich wie sozialrealistisches Aufklärungskino aus dem italien der 50er Jahre und können filmhistorisch nur als stümperhafte Vorbereitung auf dieses Meisterwerk angesehen werden.
Go INFRA-MAN, go....
P.S.: Auch wenn man sich unmöglich mehr Trash als in "Invasion aus dem Innern der Erde" vorstellen kann, wirkt die Inszenierung ein wenig hölzern und hält somit nicht mit dem direkten Vergleich der naiven Spielfreude der Japanischen Gummibärchenfilme stand. Daher ein Pünktchen Abzug!
Bild und Ton sind tadellos und weisen nur bedingte Mängel bezüglich des antiquitierten Ausgangmateriales auf. Echte Liebhaberarbeit eben...
mit 4
mit 4
mit 4
mit 3
bewertet am 30.04.15 um 11:22
Im Grunde ein solider Horror/Mystery Streifen, der am Ende das gereiftere Publikum jedoch mit allzu altbekannten Willkommen heist.
Zeigt von Beginn an bis zur Mitte des Streifens die Spannungskurve noch steil nach oben und verwöhnt den Zuschauer mit allerlei wirksamen Polterspuk im Halbdunkeln, driftet er im letzten Drittel in sanftere Splattergefilde mit Psychothriller Qualitäten ab. Dabei läßt die Spannung, die bis dato zu Kaltschweißattacken und galoppierender Pulsfrequenz geführt hat, fast schlagartig nach, um im Finale in einer überzogen langen Exorzismus Sequenz, der es an Originaltät mangelt und als Dutzendware bezeichnet werden darf, zu münden.
Wenn auch der gesamte Budenzauber sicherlich kein Innovationsfeuerwek zündet, so ist er dennoch solide inszeniert und belastet das Nervenkostüm des Zuschauers über lange Strecken hinweg mit altbewährten Schockzutaten immer noch höchst effektiv. Nur zum Ende hin weicht leider, wie bereits erwähnt, der sonst überwiegend solide düstere Grundtenor pseudodramatischen Lateingebrabbel und Kruzifixgefuchtel.
So verspielt der Film zu Gunsten seiner Scheinauthentizität viele Gute Ansätze und seine Zugangsberechtigung für höhere Weihen. Durch das Verweilen in Andeutungen und dem Spiel, das Böse als nicht sichtbares, unbegreifliches darzustellen, verweigert sich 'Erlöse uns von dem Bösen' dem ehernen dramarturgischen Gesetz, zum Finale hin das Tempo zu erhöhen und in einem fulminanten Showdown zu münden.
Durch das stoische Beharren darauf, im Unkonkreten zu verweilen und das Grauen komplett in die Vorstellungskraft des Zuschauers zu verlagern, fühlt dieser sich am Ende irgendwie um den Showdown betrogen und verläßt den Vorführsaal nur halbzufrieden.
Man hätte das Tor zur Hölle doch bitte wenigstens mal einen Spalt aufmachen können, um anzudeuten, was in den dämonischen Dimensionen an fiesen Möp auf uns lauert und einen Schauer über den Rücken jagen könnte. Mit diesem einfachen Kniff, hätte der Film sicherlich zu einem befriedigerendem Abschluß gebracht werden können....
Zeigt von Beginn an bis zur Mitte des Streifens die Spannungskurve noch steil nach oben und verwöhnt den Zuschauer mit allerlei wirksamen Polterspuk im Halbdunkeln, driftet er im letzten Drittel in sanftere Splattergefilde mit Psychothriller Qualitäten ab. Dabei läßt die Spannung, die bis dato zu Kaltschweißattacken und galoppierender Pulsfrequenz geführt hat, fast schlagartig nach, um im Finale in einer überzogen langen Exorzismus Sequenz, der es an Originaltät mangelt und als Dutzendware bezeichnet werden darf, zu münden.
Wenn auch der gesamte Budenzauber sicherlich kein Innovationsfeuerwek zündet, so ist er dennoch solide inszeniert und belastet das Nervenkostüm des Zuschauers über lange Strecken hinweg mit altbewährten Schockzutaten immer noch höchst effektiv. Nur zum Ende hin weicht leider, wie bereits erwähnt, der sonst überwiegend solide düstere Grundtenor pseudodramatischen Lateingebrabbel und Kruzifixgefuchtel.
So verspielt der Film zu Gunsten seiner Scheinauthentizität viele Gute Ansätze und seine Zugangsberechtigung für höhere Weihen. Durch das Verweilen in Andeutungen und dem Spiel, das Böse als nicht sichtbares, unbegreifliches darzustellen, verweigert sich 'Erlöse uns von dem Bösen' dem ehernen dramarturgischen Gesetz, zum Finale hin das Tempo zu erhöhen und in einem fulminanten Showdown zu münden.
Durch das stoische Beharren darauf, im Unkonkreten zu verweilen und das Grauen komplett in die Vorstellungskraft des Zuschauers zu verlagern, fühlt dieser sich am Ende irgendwie um den Showdown betrogen und verläßt den Vorführsaal nur halbzufrieden.
Man hätte das Tor zur Hölle doch bitte wenigstens mal einen Spalt aufmachen können, um anzudeuten, was in den dämonischen Dimensionen an fiesen Möp auf uns lauert und einen Schauer über den Rücken jagen könnte. Mit diesem einfachen Kniff, hätte der Film sicherlich zu einem befriedigerendem Abschluß gebracht werden können....
mit 3
mit 4
mit 4
mit 3
bewertet am 19.04.15 um 16:35
Nachdem sich der Film jahrelang an mir vorbeigeschlichen hat, geriet neulich eine der besten Komödien der letzten Jahre Gestern in die Fänge meines Filmarchieves.
Lakonisch beiläufig begleitet der Film die amerikanische Sondereinheit für paranormale Kriegsführung, die New Earth Army, über Jahrzehnte hindurch, mit in die geopolitischen Konfliktherde unseres Planeten. Dabei laviert 'Männer die auf Ziegen' starren, leichtfüßig zwischen den Kriegsschauplätzen und den Ausbildungstätten der paranormalen Elitetruppe hin und her.
Das Pendel schlägt in dem Film eindeutig, auf Kosten der Seriösität, zu Gunsten der Protagonisten aus, die allesamt angenehm verpeilt und auf ihrem ganz speziellen Eso Trip hängen geblieben sind.
Mit viel Ironie gegenüber der New Age Scene und viel Symhatie für die verschrobenen Charaktere, die in einer Welt, in der sie nicht zurechtkommen, ihren Platz Abseits der Gesellschaft gefunden haben, erzählt Regisseur Grant Haslov das Bemühen des Reporters Bob Wilton (Ewan Mc Gregor), der nach einem schicksalshaften Ereignis ( Arbeitskollege frißt sich im Büro zu Tode), einen tieferen Sinn in der Welt finden und seiner Frau imponieren möchte, und daraufhin in den Irakkrieg zieht.
Dort trifft er auf die N.A. Army Legende Jed Cassidy (G. Clooney), der mit seinen, vermeintlichen, paranormalen Fähigkeiten seit Gründung der Spezialeinheit in den 60's als Jedi Ritter (Mitglieder der New Earth Army) gegen die Feinde der USA kämpft.
Da eine Krickelei von Wilton auf einem Notizblock einem Tattoo Cassidys ähnelt, wähnt dieser ihn als Auserwählten des Schicksales und nimmt ihn mit auf seine geheimen Missionen.
Im Laufe der Reise durch die irakische Wüste werden dabei fast alle esoterischen Glaubensmantras bemüht, nur um sie im Angesicht der Wirklichkeit, der Möglichkeit des Scheiterns auszusetzen. Dabei hält Regisseur Haslov geschickt die Balance zwischen totalem Mumpitz und alternativer Logik, bzw. Erklärungsmodellen, so daß es dem Zuschauer nach betrachten des Filmes denn selbst überlassen bleibt, ob er paranormalen Phänomenen einen Platz in seinem Leben einräumt oder als ultimativ, präpsychotisches Ergebnis einer massiven Anpassungs- und Entwicklungsstörung betrachten mag.
Was aber auf jeden Fall bleibt, ist die Freude, einer hoch intelligenten, symphatischen und warmherzigen Parodie auf die Welt der Krafttiere, Bewußtseinserweiterer, Wünschelrutengänger, Feierabendschamanen und Spleenes beigewohnt zu haben, die, ohne Rücksicht auf Vernunft und Ansehen, mit sich und der Welt im reinen sind.
Klasse!!!
Grundkenntnisse esoterischer Mythen und Star Wars Folklore werden zwar nicht explizit Voraussgesetzt, erhöhen das Sehvergnügen aber ungemein...
Lakonisch beiläufig begleitet der Film die amerikanische Sondereinheit für paranormale Kriegsführung, die New Earth Army, über Jahrzehnte hindurch, mit in die geopolitischen Konfliktherde unseres Planeten. Dabei laviert 'Männer die auf Ziegen' starren, leichtfüßig zwischen den Kriegsschauplätzen und den Ausbildungstätten der paranormalen Elitetruppe hin und her.
Das Pendel schlägt in dem Film eindeutig, auf Kosten der Seriösität, zu Gunsten der Protagonisten aus, die allesamt angenehm verpeilt und auf ihrem ganz speziellen Eso Trip hängen geblieben sind.
Mit viel Ironie gegenüber der New Age Scene und viel Symhatie für die verschrobenen Charaktere, die in einer Welt, in der sie nicht zurechtkommen, ihren Platz Abseits der Gesellschaft gefunden haben, erzählt Regisseur Grant Haslov das Bemühen des Reporters Bob Wilton (Ewan Mc Gregor), der nach einem schicksalshaften Ereignis ( Arbeitskollege frißt sich im Büro zu Tode), einen tieferen Sinn in der Welt finden und seiner Frau imponieren möchte, und daraufhin in den Irakkrieg zieht.
Dort trifft er auf die N.A. Army Legende Jed Cassidy (G. Clooney), der mit seinen, vermeintlichen, paranormalen Fähigkeiten seit Gründung der Spezialeinheit in den 60's als Jedi Ritter (Mitglieder der New Earth Army) gegen die Feinde der USA kämpft.
Da eine Krickelei von Wilton auf einem Notizblock einem Tattoo Cassidys ähnelt, wähnt dieser ihn als Auserwählten des Schicksales und nimmt ihn mit auf seine geheimen Missionen.
Im Laufe der Reise durch die irakische Wüste werden dabei fast alle esoterischen Glaubensmantras bemüht, nur um sie im Angesicht der Wirklichkeit, der Möglichkeit des Scheiterns auszusetzen. Dabei hält Regisseur Haslov geschickt die Balance zwischen totalem Mumpitz und alternativer Logik, bzw. Erklärungsmodellen, so daß es dem Zuschauer nach betrachten des Filmes denn selbst überlassen bleibt, ob er paranormalen Phänomenen einen Platz in seinem Leben einräumt oder als ultimativ, präpsychotisches Ergebnis einer massiven Anpassungs- und Entwicklungsstörung betrachten mag.
Was aber auf jeden Fall bleibt, ist die Freude, einer hoch intelligenten, symphatischen und warmherzigen Parodie auf die Welt der Krafttiere, Bewußtseinserweiterer, Wünschelrutengänger, Feierabendschamanen und Spleenes beigewohnt zu haben, die, ohne Rücksicht auf Vernunft und Ansehen, mit sich und der Welt im reinen sind.
Klasse!!!
Grundkenntnisse esoterischer Mythen und Star Wars Folklore werden zwar nicht explizit Voraussgesetzt, erhöhen das Sehvergnügen aber ungemein...
mit 5
mit 4
mit 4
mit 2
bewertet am 19.04.15 um 16:33
Dracula untold erzählt die schicksalshafte Verwandlung des Grafen Vlads in das Monster Dracula. Das Vlad, der Drachenritter auf seinem Weg ins Unheil nur von edlen Motiven geleitet wird und das Schicksal ihm keinen anderen Weg erlaubt, als mit dem Verderben ein Bündniss einzugehen, will er Mann und Maus, Familie und Schloß, Rüstung und Wams, verteidigen, ist wohl historisch nicht korrekt, sichert Captain Vlad aber eine Menge Symphatiepunkte und kann im Hollywood Transsylvanien auch so nicht anders sein.
Ohne mich im einzelnen in den Wirrungen des Dramas zu verlieren, überzeugt Daracula Untold genau mit jener "Wasch mich aber mach mich nicht naß" Mentalität, die auf mich so anziehend wirkt.
Auf der einen Seite gibt es jede Menge sanften Grusel, auf der anderen Seite wird es dafür jedoch nie richtig unangenehm, so daß man den wohligen Schauer ohne Querulantien im solar plexus Bereich genießen darf.
Zu allerlei düsterem CGI Zauber gesellen sich außerdem noch majestätische Landschaftsaufnahmen, düstere Gewölbe, finstere Schurken und eine illustre Schausteller Schar, die ihre Rollen mit der nötigen Würde vortragen und den Verdacht eines billigen Machwerkes weit von sich weisen.
Ales in allem läßt sich also festhalten, daß Dracula eine höchst unterhaltsame Schauermär darstellt, die mehr im Gothic Grusel anzusiedeln ist, denn als im eigentlichen Horror Genre. Die Nähe zur Märchen und Sagenwelt wird auch in den entfallenen Scenen deutlicher, wo Vlad in einem verwunschenem Haus in die Fänge einer bösen Hexe gerät.
Die oppulenten Schauwerte und die dichte Athmosphäre lassen Vergleiche zu Van Helsing und I, Frankenstein aufkommen, die in der selben comichaften, hollywood bubblegum artigen Welt angesiedelt sind wie der vorliegende Steifen, der seine Mission, seicht aber intensiv zu unterhalten, voll erfüllt.
Ohne mich im einzelnen in den Wirrungen des Dramas zu verlieren, überzeugt Daracula Untold genau mit jener "Wasch mich aber mach mich nicht naß" Mentalität, die auf mich so anziehend wirkt.
Auf der einen Seite gibt es jede Menge sanften Grusel, auf der anderen Seite wird es dafür jedoch nie richtig unangenehm, so daß man den wohligen Schauer ohne Querulantien im solar plexus Bereich genießen darf.
Zu allerlei düsterem CGI Zauber gesellen sich außerdem noch majestätische Landschaftsaufnahmen, düstere Gewölbe, finstere Schurken und eine illustre Schausteller Schar, die ihre Rollen mit der nötigen Würde vortragen und den Verdacht eines billigen Machwerkes weit von sich weisen.
Ales in allem läßt sich also festhalten, daß Dracula eine höchst unterhaltsame Schauermär darstellt, die mehr im Gothic Grusel anzusiedeln ist, denn als im eigentlichen Horror Genre. Die Nähe zur Märchen und Sagenwelt wird auch in den entfallenen Scenen deutlicher, wo Vlad in einem verwunschenem Haus in die Fänge einer bösen Hexe gerät.
Die oppulenten Schauwerte und die dichte Athmosphäre lassen Vergleiche zu Van Helsing und I, Frankenstein aufkommen, die in der selben comichaften, hollywood bubblegum artigen Welt angesiedelt sind wie der vorliegende Steifen, der seine Mission, seicht aber intensiv zu unterhalten, voll erfüllt.
mit 4
mit 4
mit 4
mit 3
bewertet am 11.04.15 um 12:31
In dem mit einiger Unschärfe gesegneten aber der prächtigen, bunten Farbpalette des Genies würdigen, in Technicolorfarben inszeniertem Film, gelingt hier Kirk Douglas als tragisches Künstlergenie Vincent van Gogh, eine der überzeugendsten Darstellungen seiner Laufbahn.
Erst spät im Leben entscheidet sich der gescheiterte Laienprediger Vincent van Gogh, sein zeichnerisches Talent zu verfeinern und in den Dienst seiner Maxime, den Menschen etwas zu schenken, was ihnen Freude bereitet, zu stellen.
So folgt er seinem Bruder, einem mäßig erfolgreichen Kunsthändler nach Paris, um sich dort im Kreis der angesagten Impressionisten anzusiedeln und zu wirken.
Van Goghs sperrige, von ungewöhnlicher, strichartiger Pinselführung gekennzeichneten Bilder werden in Künstlerkreisen zwar lobend erwähnt, finden jedoch keine Abnehmer. Einzig der aufbrausende Paul Gaugin erkennt in den ausdruckstarken Motiven eine bis Dato nie gesehene emotionale Kraft und freundet sich mit Vincent an.
Weil der Erfolg ausbleibt und das urbane Stadtleben ihn zunehmend bedrückt, beschließt van Gogh, sich im Süden Frankreichs, in Arles, niederzulassen und sich dort von der ihm so wichtigen Natur inspirieren und führen zu lassen. Hier entstehen trotz tiefster Einsamkeit und daraus resultierenden seelischer Pein, einige seiner schönsten Werke.
Besserung seines Gemützustandes verspricht sich van Gogh von der Ankunft seines Künstlerfreundes Gaugin (Anthony Quinn), mit dem er eine Künstlerkolonie gründen möchte.
Dem aufbrausendem, cholerischem Temperament des grobschlächtigen Freundes aber nicht gewachsen und durch konträre künstlerische Auffassungen desillusioniert, kommt es in einem heftigen Streit der beiden zur Entzweiung.
Von diesem Streit zutiefst verletzt, bitterer Armut zerfressen und zunehmend durch pyschotischen Schübe zerrütet, schneidet sich Vincent sein linkes Ohr ab und läßt sich in eine Heilanstalt einweisen.
Obwohl er körperlich wieder genest, heilen die Wunden seiner Seele nicht aus und die psychischen Attacken gehen mit seiner betrübten Gemütslage eine unheilige Melange ein.
In seinem letzten Bild verdichtet sich ein unheilvolles Gewitter über einem wogenden Kornfeld und Krähen, die Boten des Todes, ziehen am Horizont auf.
Nach Vollendigung dieses letzten expressionistischen Geniestreiches, zieht van Gogh eine Pistole aus dem Revers und erschießt sich.
Schwer verletzt wird er zu seinem Bruder geschleppt, in dessen Armen er, seine geliebte Pfeife rauchend, verstirbt.
Biographisch weitesgehend korrekt, nur prosaisch ein wenig verdichtet, liefert Kirk Douglas eine Leistung ab, die der Intensität und Ausdruckskraft der Bilder van Goghs in nichts nachstehen. Jede Emotion wird mit der größtmöglichen Energie vorgetragen, so daß die Notwendigkeit des Künstlers, seine Gefühle und der Druck, sich ihnen auf kreative Weise zu entledigen, nicht nur nachvollziehbar, sondern auch als unabdingbar empfunden werden. Nur tiefe intensiv erlebte Gefühle sind imstande, als Vorlage für solch große Werke zu dienen, die der Künstler quasi wie am Fließband ablieferte. Das van Gogh dabei auf eine Maltechnik zurückgreift, bzw. eine erfindet, die es ihm ermöglicht, die tiefgründige Lebendigkeit hinter den Dingen durch die Objekte aus dem Bild heraustreten zu laßen und so einen Verweis auf die metaphysische Realitätsebene hinter der optischen oberflächlichen Erscheinungsebene zu erlauben, gehört zu den magischen Momenten der Kunstgeschichte.
Van Goghs entrückter Blick auf die Dinge ist einem normalen, auf Alltagsfunktionalität gepolten Bewußtsein nicht zugänglich. Der Verdienst des Künstlers liegt, trotz seines eigenen psychischen Unvermögens, Welt und Mystik zu vereinen, vor allen Dingen darin, uns Normalsterblichen, einen Blick auf die astrale, ewige Schönheit erhaschen zu lassen, die der Existenz zugrunde liegt und uns im Normalzustand durch unsere Ratio und die unabläßige Beschäftigung des Geistes mit dem Egokonstrukt verwehrt bleibt.
Die Seelenqualen, die van Gogh auf seinem Weg, uns daß nicht Aussprechbare visuell zugänglich zu machen, durchlitten hat, hat in dem Schauspieler Kirk Douglas eine würdige Entsprechung erfahren, die dieses Biopic zu den allerbesten Vertretern des Genres zählen läßt.
Erst spät im Leben entscheidet sich der gescheiterte Laienprediger Vincent van Gogh, sein zeichnerisches Talent zu verfeinern und in den Dienst seiner Maxime, den Menschen etwas zu schenken, was ihnen Freude bereitet, zu stellen.
So folgt er seinem Bruder, einem mäßig erfolgreichen Kunsthändler nach Paris, um sich dort im Kreis der angesagten Impressionisten anzusiedeln und zu wirken.
Van Goghs sperrige, von ungewöhnlicher, strichartiger Pinselführung gekennzeichneten Bilder werden in Künstlerkreisen zwar lobend erwähnt, finden jedoch keine Abnehmer. Einzig der aufbrausende Paul Gaugin erkennt in den ausdruckstarken Motiven eine bis Dato nie gesehene emotionale Kraft und freundet sich mit Vincent an.
Weil der Erfolg ausbleibt und das urbane Stadtleben ihn zunehmend bedrückt, beschließt van Gogh, sich im Süden Frankreichs, in Arles, niederzulassen und sich dort von der ihm so wichtigen Natur inspirieren und führen zu lassen. Hier entstehen trotz tiefster Einsamkeit und daraus resultierenden seelischer Pein, einige seiner schönsten Werke.
Besserung seines Gemützustandes verspricht sich van Gogh von der Ankunft seines Künstlerfreundes Gaugin (Anthony Quinn), mit dem er eine Künstlerkolonie gründen möchte.
Dem aufbrausendem, cholerischem Temperament des grobschlächtigen Freundes aber nicht gewachsen und durch konträre künstlerische Auffassungen desillusioniert, kommt es in einem heftigen Streit der beiden zur Entzweiung.
Von diesem Streit zutiefst verletzt, bitterer Armut zerfressen und zunehmend durch pyschotischen Schübe zerrütet, schneidet sich Vincent sein linkes Ohr ab und läßt sich in eine Heilanstalt einweisen.
Obwohl er körperlich wieder genest, heilen die Wunden seiner Seele nicht aus und die psychischen Attacken gehen mit seiner betrübten Gemütslage eine unheilige Melange ein.
In seinem letzten Bild verdichtet sich ein unheilvolles Gewitter über einem wogenden Kornfeld und Krähen, die Boten des Todes, ziehen am Horizont auf.
Nach Vollendigung dieses letzten expressionistischen Geniestreiches, zieht van Gogh eine Pistole aus dem Revers und erschießt sich.
Schwer verletzt wird er zu seinem Bruder geschleppt, in dessen Armen er, seine geliebte Pfeife rauchend, verstirbt.
Biographisch weitesgehend korrekt, nur prosaisch ein wenig verdichtet, liefert Kirk Douglas eine Leistung ab, die der Intensität und Ausdruckskraft der Bilder van Goghs in nichts nachstehen. Jede Emotion wird mit der größtmöglichen Energie vorgetragen, so daß die Notwendigkeit des Künstlers, seine Gefühle und der Druck, sich ihnen auf kreative Weise zu entledigen, nicht nur nachvollziehbar, sondern auch als unabdingbar empfunden werden. Nur tiefe intensiv erlebte Gefühle sind imstande, als Vorlage für solch große Werke zu dienen, die der Künstler quasi wie am Fließband ablieferte. Das van Gogh dabei auf eine Maltechnik zurückgreift, bzw. eine erfindet, die es ihm ermöglicht, die tiefgründige Lebendigkeit hinter den Dingen durch die Objekte aus dem Bild heraustreten zu laßen und so einen Verweis auf die metaphysische Realitätsebene hinter der optischen oberflächlichen Erscheinungsebene zu erlauben, gehört zu den magischen Momenten der Kunstgeschichte.
Van Goghs entrückter Blick auf die Dinge ist einem normalen, auf Alltagsfunktionalität gepolten Bewußtsein nicht zugänglich. Der Verdienst des Künstlers liegt, trotz seines eigenen psychischen Unvermögens, Welt und Mystik zu vereinen, vor allen Dingen darin, uns Normalsterblichen, einen Blick auf die astrale, ewige Schönheit erhaschen zu lassen, die der Existenz zugrunde liegt und uns im Normalzustand durch unsere Ratio und die unabläßige Beschäftigung des Geistes mit dem Egokonstrukt verwehrt bleibt.
Die Seelenqualen, die van Gogh auf seinem Weg, uns daß nicht Aussprechbare visuell zugänglich zu machen, durchlitten hat, hat in dem Schauspieler Kirk Douglas eine würdige Entsprechung erfahren, die dieses Biopic zu den allerbesten Vertretern des Genres zählen läßt.
mit 5
mit 4
mit 3
mit 2
bewertet am 11.04.15 um 11:44
Weites Land.
Ödes Land.
Was uns Will Wyler als Western Opus darbietet, entpuppt sich trotz durch die Bank weg erstklassiker schauspielerischer Glanzleistungen, doch eher als gepflegte Langeweile vor spartanischer Kulisse der amerikanischen Prärie.
Vor dem Hintergrund zweier verfeindeter Rancherclans heiratet der Ex-Kapitän James McKay (Gregory Peck) die schöne Patricia, ihres Zeichens die Tochter des Rinderbarons Major Terril. Dieser hegt schon seit Ewigkeiten einen erbitterten Groll auf den Farmer Rufus Hanessey (Burl Ives, hierfür gabs 'nen Oscar!), die beide mit ihren Herden um die gleichen Trinkplätze auf der Muddy Waters Farm der Lehrerin Julie Maragon (Jean Simmons) buhlen.
Schnell stellt sich heraus, daß auf dem gesetzlosen Fleckchen Erde das Recht des stärkeren waltet und keiner dem Anderen das Recht auf die existenziell bedeutungsvolle Tränke gönnt. Kaptain McKay will sich in diesen aufgeheizten Konflikt jedoch nicht einmischen und zieht moderatere Töne zur Versöhnung einer potentiell bleihaltigen Konfliktlösung vor. Damit fängt er sich jedoch fix den Unbill seiner Frau ein. Zu sehr ist sie von Land und Leuten geprägt, als daß sie dieses unmaskuline Verhalten gutheißen mag. Dem Mann, dem sie ihre gebährfreudigen Lenden hingibt, muß ein ganzer Cowboy, sprich Rauhbein und Draufgänger sein.
So kühlt die junge Liebe der beiden Turteltauben schnell auf die Temperatur nahe des Gefrierpunktes ab. Eine Weile klammert man sich noch an die schönen Bilder einer harmonischen Ehe, die ihnen ihre Phantasie einst in verliebten Tagen vorgegaukelt hat. Dann aber läßt sich die harte Realität nicht länger verdrängen und die Scheidung folgt auf Grund zu unterschiedlicher Temperamente auf dem Fuß.
Um der ganzen Angelegenheit den Wind aus den Segeln zu nehmen und sich eine eigene Zukunft aufzubauen, beschließ McKay, das Land um die Tränke von der schönen Julie aufzukaufen, um den beiden Streithähnen Zugang zum Lebensspendenden Naß zu gewährleisten. Das sich der Kapitän dabei schon längst in die Lehrerin verliebt hat, ist dem Zuschauer natürlich nicht entgangen.
So könnte man jetzt gemütlich auf ein Happy End mit Doppelhochzeit zusteuern, da des Majors Ziesohn, der gutaussehende und muskulöse Steve Leech (Charlton Heston) es auf dessen Patrica schon lange abgesehen hatte und mit seinen ungehobelten animalischen Sitten die Farmertochter eigentlich längst dazu stimuliert haben sollte, ihm ihr fruchtbares Becken bis auf weiteres unbefristet zur Verfügung zu stellen.
Da der Major und sein Widersacher Rufus aber Hitzköpfe alter Schule sind und etwas an Altersstarrsinn zu leiden haben, muß ihr Konflikt trotzdem auf erwachsene Weise, sprich im Duell gelöst werden. So kommt es zum unvermeidlichen Showdown und der Zuschauer kriegt sein Häppchen Moralethik zum Fraß vorgeworfen, mit dem er dann stundenlang im Klassenzimmer die Frage nach Gerechtigkeit und Vernunft debattieren darf oder vorzugsweise, nachdem er Nächte lang auf dem Häppchen herumgekaut hat, mit dem Nahrungsbrei seitenlange Filmrezessionen vollkleistern, um Weites Land unkontrolliert mit Anspruchspunkten zu übersähen.
So sehr Weites Land in verkürzter Form im Kern auch als Drama funktionieren würde, so banal sind andererseits aber auch die hier aufgeworfenen ethisch-moralischen Konflikte, da sich die Darstellungen zu sehr an simplen schwarz/weiß Polaritäten entlanghangeln und keine wirklich relevanten humanen Dilemmas herausarbeiten. Zu schlicht ist der Konflikt in gut und schlecht Polaritäten klassifiziert, als daß wiklich brisante Konstellationen herausgearbeitet werden, die ins spannende Feld der moralischen Grauzone verweisen und die Grenzen des richtig/falsch Schematas verwischen.
Auch das Peck hier wieder einmal alle positiven Errungenschaften der amerikanischen Seele in Personalunion vereinen muß, wirkt auf die Dauer ziemlich ermüdend und langweilend, so souverän auch sein Auftritt mal wieder ist.
Auch das sich die Geschichte nur sehr zögerlich entwickelt, trägt nicht sonderlich zur Erbauung des Zuschauers bei. Obwohl ich an und für sich ein Befürworter filigran ausgearbeiteter Charaktere bin und in der Erzählung auch gern auf der Stelle verharre, wenn es der der Sache dienlich und optisch überzeugend ist, so überwiegt doch hier eindeutig die Leere und das erzählerische Vakuum, welches auch die Aufnahmen der weiten Prärie nicht zu übertünchen Vermögen. Die laßen wohl ein Gefühl für die Größe des Landes und die Mühe des Broterwerbes dort erahnen, punkten unterm Strich jedoch kaum mit Schauwerten.
Die Dehnung der Handlung gegen Unendlich, ist halt der Tot jeder Spannung.
So mag dem Amerikaner bei dem Werk des Regiegiganten Wyler (Ben Hur) beim betrachten wohl vor Stolz die Hose aufgehen, wenn hier seine edle Nationalseele in Wallung gerät, dem Rest der Welt aber wird wohl nur das Schaulaufen einiger der größten Stars, die Hollywwod je gehabt hat, in angenehmer Erinnerung bleiben.
Daher ist der Genuß des Filmes für Bewohner unserer Längengrade am ehesten für die Mitte 70jährige zu empfehlen, die sich die Zeit auf dem Schaukelstuhl bis zum Eintreffen des Essen auf Rädern Pürees, ein wenig verkürzen wollen.
Ödes Land.
Was uns Will Wyler als Western Opus darbietet, entpuppt sich trotz durch die Bank weg erstklassiker schauspielerischer Glanzleistungen, doch eher als gepflegte Langeweile vor spartanischer Kulisse der amerikanischen Prärie.
Vor dem Hintergrund zweier verfeindeter Rancherclans heiratet der Ex-Kapitän James McKay (Gregory Peck) die schöne Patricia, ihres Zeichens die Tochter des Rinderbarons Major Terril. Dieser hegt schon seit Ewigkeiten einen erbitterten Groll auf den Farmer Rufus Hanessey (Burl Ives, hierfür gabs 'nen Oscar!), die beide mit ihren Herden um die gleichen Trinkplätze auf der Muddy Waters Farm der Lehrerin Julie Maragon (Jean Simmons) buhlen.
Schnell stellt sich heraus, daß auf dem gesetzlosen Fleckchen Erde das Recht des stärkeren waltet und keiner dem Anderen das Recht auf die existenziell bedeutungsvolle Tränke gönnt. Kaptain McKay will sich in diesen aufgeheizten Konflikt jedoch nicht einmischen und zieht moderatere Töne zur Versöhnung einer potentiell bleihaltigen Konfliktlösung vor. Damit fängt er sich jedoch fix den Unbill seiner Frau ein. Zu sehr ist sie von Land und Leuten geprägt, als daß sie dieses unmaskuline Verhalten gutheißen mag. Dem Mann, dem sie ihre gebährfreudigen Lenden hingibt, muß ein ganzer Cowboy, sprich Rauhbein und Draufgänger sein.
So kühlt die junge Liebe der beiden Turteltauben schnell auf die Temperatur nahe des Gefrierpunktes ab. Eine Weile klammert man sich noch an die schönen Bilder einer harmonischen Ehe, die ihnen ihre Phantasie einst in verliebten Tagen vorgegaukelt hat. Dann aber läßt sich die harte Realität nicht länger verdrängen und die Scheidung folgt auf Grund zu unterschiedlicher Temperamente auf dem Fuß.
Um der ganzen Angelegenheit den Wind aus den Segeln zu nehmen und sich eine eigene Zukunft aufzubauen, beschließ McKay, das Land um die Tränke von der schönen Julie aufzukaufen, um den beiden Streithähnen Zugang zum Lebensspendenden Naß zu gewährleisten. Das sich der Kapitän dabei schon längst in die Lehrerin verliebt hat, ist dem Zuschauer natürlich nicht entgangen.
So könnte man jetzt gemütlich auf ein Happy End mit Doppelhochzeit zusteuern, da des Majors Ziesohn, der gutaussehende und muskulöse Steve Leech (Charlton Heston) es auf dessen Patrica schon lange abgesehen hatte und mit seinen ungehobelten animalischen Sitten die Farmertochter eigentlich längst dazu stimuliert haben sollte, ihm ihr fruchtbares Becken bis auf weiteres unbefristet zur Verfügung zu stellen.
Da der Major und sein Widersacher Rufus aber Hitzköpfe alter Schule sind und etwas an Altersstarrsinn zu leiden haben, muß ihr Konflikt trotzdem auf erwachsene Weise, sprich im Duell gelöst werden. So kommt es zum unvermeidlichen Showdown und der Zuschauer kriegt sein Häppchen Moralethik zum Fraß vorgeworfen, mit dem er dann stundenlang im Klassenzimmer die Frage nach Gerechtigkeit und Vernunft debattieren darf oder vorzugsweise, nachdem er Nächte lang auf dem Häppchen herumgekaut hat, mit dem Nahrungsbrei seitenlange Filmrezessionen vollkleistern, um Weites Land unkontrolliert mit Anspruchspunkten zu übersähen.
So sehr Weites Land in verkürzter Form im Kern auch als Drama funktionieren würde, so banal sind andererseits aber auch die hier aufgeworfenen ethisch-moralischen Konflikte, da sich die Darstellungen zu sehr an simplen schwarz/weiß Polaritäten entlanghangeln und keine wirklich relevanten humanen Dilemmas herausarbeiten. Zu schlicht ist der Konflikt in gut und schlecht Polaritäten klassifiziert, als daß wiklich brisante Konstellationen herausgearbeitet werden, die ins spannende Feld der moralischen Grauzone verweisen und die Grenzen des richtig/falsch Schematas verwischen.
Auch das Peck hier wieder einmal alle positiven Errungenschaften der amerikanischen Seele in Personalunion vereinen muß, wirkt auf die Dauer ziemlich ermüdend und langweilend, so souverän auch sein Auftritt mal wieder ist.
Auch das sich die Geschichte nur sehr zögerlich entwickelt, trägt nicht sonderlich zur Erbauung des Zuschauers bei. Obwohl ich an und für sich ein Befürworter filigran ausgearbeiteter Charaktere bin und in der Erzählung auch gern auf der Stelle verharre, wenn es der der Sache dienlich und optisch überzeugend ist, so überwiegt doch hier eindeutig die Leere und das erzählerische Vakuum, welches auch die Aufnahmen der weiten Prärie nicht zu übertünchen Vermögen. Die laßen wohl ein Gefühl für die Größe des Landes und die Mühe des Broterwerbes dort erahnen, punkten unterm Strich jedoch kaum mit Schauwerten.
Die Dehnung der Handlung gegen Unendlich, ist halt der Tot jeder Spannung.
So mag dem Amerikaner bei dem Werk des Regiegiganten Wyler (Ben Hur) beim betrachten wohl vor Stolz die Hose aufgehen, wenn hier seine edle Nationalseele in Wallung gerät, dem Rest der Welt aber wird wohl nur das Schaulaufen einiger der größten Stars, die Hollywwod je gehabt hat, in angenehmer Erinnerung bleiben.
Daher ist der Genuß des Filmes für Bewohner unserer Längengrade am ehesten für die Mitte 70jährige zu empfehlen, die sich die Zeit auf dem Schaukelstuhl bis zum Eintreffen des Essen auf Rädern Pürees, ein wenig verkürzen wollen.
mit 3
mit 4
mit 3
mit 1
bewertet am 22.02.15 um 22:18
Eine der ersten westlichen Produktionen überhaupt, die in der ehemaligen UDSSR ihr Zelt aufschlagen durften.
Die Kulissen und Plätze zeugen von großer Vergangenheit und sich einer im Zerfall befindenden Gesellschaft. Sie sind allesamt sorgsam ausgewählt und haben das westliche Auge bisher noch nicht ermüdet. Daher wirkt der spröde Charme des sich im Wandel befindlichen Ostblockes noch originär und unverfälscht.
Dem Flair der spartanischen Lebensart der Sowjetgesellschaft paßt sich die Handlung athmosphärisch an. Die Dialoge sprühen nicht vor Charme und Esprit, sondern sind ebenso kühl und nüchtern wie das ärmlich morbide Interieur der Plattenbauwohnungen.
So hangelt sich dann die Handlung auch, John le Carre typisch, nicht an Action- und pyrotechnischen Extravagancen entlang, sondern spielt sich hauptsächlich auf doppelbödigen Intellektuellem Niveau ab, bei dem die Protagonisten letztendlich nur Marionetten machtgetriebener Interessensgruppen sind.
In diesem Netz von Lügen, falschen Freunden und Gegenspionage, verliebt sich der englische Verleger Blair (Connery), der ein Manuskript des russischen Militärinsiders Dante (Brandauer) aus Rußland schmuggeln soll, in die hübsche Lektorin Katja (M. Pfeiffer).
Zwischen internationalen und persönlichen Interessen hin und hergeworfen, versucht Blair im Rahmen seiner Möglichkeiten sich aus den Schlingen der Geheimdienste zu winden, um mit Katja ein neues Leben in Portugal zu beginnen...
So wenig Das Russland Haus mit James Bond und Liebesgrüßen aus Moskau zu tun hat, und daher gänzlich auf pyrotechnischen Schnick Schnack und halsbrecherische Verfolgungsjagden verzichtet, so sehr fokussiert sich der Film auf das langsame Erwachen einer Liebe, inmitten der beklemmende Athmosphäre eines totalitären Überwachungsstaates der sich im fortgeschrittenem degenerativen Prozess befindet.
So ist das Russland Haus auch ein dem Umständen entsprechenden stiller Film geworden, bei dem die schauspielerischen Schwergewichte Connery, Michelle Pfeiffer, K. M. Brandauer und Roy Scheider sich nahtlos in die großen historischen Kulissen und landschaftliche Weite des Landes zu integrieren vermögen, in gewöhnlicher, häuslicher Umgebung jedoch wie Monolithen weit über sie hinausragen.
Dieser in entsättigten Farben gedrehte und damit die Tristesse der Lebenbedingungen im real exiatierenden Sozialismus nachleidbar geschilderte Niederspannungsthriller ist daher eher etwas für den geneigten Beobachter gehobener Schauspielkost, als für Adrenalinjunkies.
Am besten mit einer guten Tasse Baldriantee zu genießen. Und vielleicht einem Schuß Vodka Breschnew...
Die Kulissen und Plätze zeugen von großer Vergangenheit und sich einer im Zerfall befindenden Gesellschaft. Sie sind allesamt sorgsam ausgewählt und haben das westliche Auge bisher noch nicht ermüdet. Daher wirkt der spröde Charme des sich im Wandel befindlichen Ostblockes noch originär und unverfälscht.
Dem Flair der spartanischen Lebensart der Sowjetgesellschaft paßt sich die Handlung athmosphärisch an. Die Dialoge sprühen nicht vor Charme und Esprit, sondern sind ebenso kühl und nüchtern wie das ärmlich morbide Interieur der Plattenbauwohnungen.
So hangelt sich dann die Handlung auch, John le Carre typisch, nicht an Action- und pyrotechnischen Extravagancen entlang, sondern spielt sich hauptsächlich auf doppelbödigen Intellektuellem Niveau ab, bei dem die Protagonisten letztendlich nur Marionetten machtgetriebener Interessensgruppen sind.
In diesem Netz von Lügen, falschen Freunden und Gegenspionage, verliebt sich der englische Verleger Blair (Connery), der ein Manuskript des russischen Militärinsiders Dante (Brandauer) aus Rußland schmuggeln soll, in die hübsche Lektorin Katja (M. Pfeiffer).
Zwischen internationalen und persönlichen Interessen hin und hergeworfen, versucht Blair im Rahmen seiner Möglichkeiten sich aus den Schlingen der Geheimdienste zu winden, um mit Katja ein neues Leben in Portugal zu beginnen...
So wenig Das Russland Haus mit James Bond und Liebesgrüßen aus Moskau zu tun hat, und daher gänzlich auf pyrotechnischen Schnick Schnack und halsbrecherische Verfolgungsjagden verzichtet, so sehr fokussiert sich der Film auf das langsame Erwachen einer Liebe, inmitten der beklemmende Athmosphäre eines totalitären Überwachungsstaates der sich im fortgeschrittenem degenerativen Prozess befindet.
So ist das Russland Haus auch ein dem Umständen entsprechenden stiller Film geworden, bei dem die schauspielerischen Schwergewichte Connery, Michelle Pfeiffer, K. M. Brandauer und Roy Scheider sich nahtlos in die großen historischen Kulissen und landschaftliche Weite des Landes zu integrieren vermögen, in gewöhnlicher, häuslicher Umgebung jedoch wie Monolithen weit über sie hinausragen.
Dieser in entsättigten Farben gedrehte und damit die Tristesse der Lebenbedingungen im real exiatierenden Sozialismus nachleidbar geschilderte Niederspannungsthriller ist daher eher etwas für den geneigten Beobachter gehobener Schauspielkost, als für Adrenalinjunkies.
Am besten mit einer guten Tasse Baldriantee zu genießen. Und vielleicht einem Schuß Vodka Breschnew...
mit 4
mit 3
mit 3
mit 1
bewertet am 22.02.15 um 21:41
Orson Welles spektakuläres Meisterwerk im Detail zu beschreiben übersteigt meine bescheidenen Möglichkeiten. Zu gering ist meine humanistische Universalbildung, um die vielschichtig miteinander verwobenen künstlerischen, historischen und sozialkritischen Aspekte alle einzeln aufzudröseln und sie den passenden filmgeschichtlichen Koordinaten zuzuweisen.
In Aussagestarken Bildern und genialen Schnittfolgen erzählt Welles den Aufstieg und Fall des Medienzaren Kane, den nach dem Verlust seiner Frau zunehmend der Lebensmut verläßt. In Symbolträchtigen Sequenzen und aufs wesentliche reduzierten Dialogen erzeugt Welles eine viellschichtige Analyse des amerikanischen Pioniergeistes und seines Seelenlebens, in dem in jedem Augenblick und jedem Wortgefecht das Genie seines Erschaffers durchblitzt. Noch nahe am Theater, wohnt jeder Kulisse und jeder Sequenz eine Metebene inne, die die Bedeutung des Einzelnen auf allgemeinere Rückschlüße in verdichteter Form zuläßt, somit über das rein Dargestellte hinausweist und vielschichtigen Parabelcharakter unter Beweis stellt.
Dieses Konzentrat von ungewöhnlicher Kameraführung, oppulenter Requisite und Dialogen von entlarvendem Realismus, erzeugt eine auch heute noch unvermindert strahlende Aura, deren Faszination sich kein künstlerisch ambitioniertes Wesen entziehen kann.
Schade, daß bei einem solchem Geniestreich Bild und Tonqualität gerade mal Mittelmaß sind.
In Aussagestarken Bildern und genialen Schnittfolgen erzählt Welles den Aufstieg und Fall des Medienzaren Kane, den nach dem Verlust seiner Frau zunehmend der Lebensmut verläßt. In Symbolträchtigen Sequenzen und aufs wesentliche reduzierten Dialogen erzeugt Welles eine viellschichtige Analyse des amerikanischen Pioniergeistes und seines Seelenlebens, in dem in jedem Augenblick und jedem Wortgefecht das Genie seines Erschaffers durchblitzt. Noch nahe am Theater, wohnt jeder Kulisse und jeder Sequenz eine Metebene inne, die die Bedeutung des Einzelnen auf allgemeinere Rückschlüße in verdichteter Form zuläßt, somit über das rein Dargestellte hinausweist und vielschichtigen Parabelcharakter unter Beweis stellt.
Dieses Konzentrat von ungewöhnlicher Kameraführung, oppulenter Requisite und Dialogen von entlarvendem Realismus, erzeugt eine auch heute noch unvermindert strahlende Aura, deren Faszination sich kein künstlerisch ambitioniertes Wesen entziehen kann.
Schade, daß bei einem solchem Geniestreich Bild und Tonqualität gerade mal Mittelmaß sind.
mit 4
mit 3
mit 3
mit 4
bewertet am 04.02.15 um 17:43
Ein Film ohne Daseinsberechtigung. Nicolas Winding Refn auf dem Tiefpunkt seines Schaffens.
Erst passiert überhaupt nichts, dann wirds richtig Langweilig.
Ein Security Beamter einer Shopping Mall ist seelisch am Ende. In der Tiefgarage des Einkaufszentrums wurde seine Frau erschoßen. Tagsüber verrichtet er mürbe seinen Dienst. Zu Hause halluziniert er sich seine Frau herbei oder guckt sich in endlosen Stunden alte Videoaufzeichnungen aus dem Einkaufszentrum an, immer in der Hoffnung, eine Spur zu finden, die ihn zum Mörder seiner Frau führt.
Als er in das leerstehende Haus seines Nachbarn einbricht, findet er am Boden einen Streifen mit Photonegativen. Diese läßt er entwickeln und folgt einer Spur zu einem Schnellimbiss an einem Highway irgendwo in Montana.
Und tatsächlich kommt da so etwas wie ein Stein ins Rollen und man beginnt sich um ihn zu "kümmern". Am Ende jedoch sieht er sich mit Kräften konfrontiert, denen er nicht gewachsen ist und wird in der Einöde ausgesetzt. Still und emotionslos tritt er die Rückreise an...
Kaum zu glauben, daß dieses minimalistische Werk aus so beachteter Feder entstammt, die auch Last Exit Brooklyn und Requiem for a Dream in die Welt entließ.
Obwohl es inhaltliche Übereinstimmungen gibt. Wie in den anderen beiden Werken auch, geht es um gebrochene Charaktere, denen das Schicksal übel mitgespielt hat.
Wo es in den anderen Filmen aber noch fortschreitende Handlung und optische Opulenz gibt, dominiert bei Fear X durchgehend eine existenzialistisch ausgeprägte Grundstimmung. So gesehen funktioniert der Film, wenn überhaupt, nur als Seelenporträt oder Stimmungsgemälde einer in sich eingeschloßenen, von jeder Lebensfreude abgeschnittenen Seele.
Als Kurzfilm hätte der Film als deillusionierende Betrachtung des Lebens, daß trotz permanenter Glückssuche ein letztendlich frustierendes und sinnloses Ereigniss darstellt, vielleicht noch getaugt. Als Langfilm scheitert er allerdings an der Übertreibung seines Minimalismusses.
Den langatmigen Videoanalysen und langen Aufnahmen des leeren Gesichtes des Hauptdarstellers zuzusehen, langweilen dabei aber ebenso extrem, wie die mageren, belanglos und mühsam ausgesprochenen Dialoge aller Beteiligte.
Wenn damit die innere Leere des Witwers ausgedrückt werden soll, ist dies gelungen. Unterhaltsam oder ansatzweise interessant ist dies aber in keinster Weise.
Von einer mystisch, transzendenten Stimmung wie im ebenfalls wortkargen und entrückten Walhalla Rising, ist Fear X meilenweit entfernt.
Erst passiert überhaupt nichts, dann wirds richtig Langweilig.
Ein Security Beamter einer Shopping Mall ist seelisch am Ende. In der Tiefgarage des Einkaufszentrums wurde seine Frau erschoßen. Tagsüber verrichtet er mürbe seinen Dienst. Zu Hause halluziniert er sich seine Frau herbei oder guckt sich in endlosen Stunden alte Videoaufzeichnungen aus dem Einkaufszentrum an, immer in der Hoffnung, eine Spur zu finden, die ihn zum Mörder seiner Frau führt.
Als er in das leerstehende Haus seines Nachbarn einbricht, findet er am Boden einen Streifen mit Photonegativen. Diese läßt er entwickeln und folgt einer Spur zu einem Schnellimbiss an einem Highway irgendwo in Montana.
Und tatsächlich kommt da so etwas wie ein Stein ins Rollen und man beginnt sich um ihn zu "kümmern". Am Ende jedoch sieht er sich mit Kräften konfrontiert, denen er nicht gewachsen ist und wird in der Einöde ausgesetzt. Still und emotionslos tritt er die Rückreise an...
Kaum zu glauben, daß dieses minimalistische Werk aus so beachteter Feder entstammt, die auch Last Exit Brooklyn und Requiem for a Dream in die Welt entließ.
Obwohl es inhaltliche Übereinstimmungen gibt. Wie in den anderen beiden Werken auch, geht es um gebrochene Charaktere, denen das Schicksal übel mitgespielt hat.
Wo es in den anderen Filmen aber noch fortschreitende Handlung und optische Opulenz gibt, dominiert bei Fear X durchgehend eine existenzialistisch ausgeprägte Grundstimmung. So gesehen funktioniert der Film, wenn überhaupt, nur als Seelenporträt oder Stimmungsgemälde einer in sich eingeschloßenen, von jeder Lebensfreude abgeschnittenen Seele.
Als Kurzfilm hätte der Film als deillusionierende Betrachtung des Lebens, daß trotz permanenter Glückssuche ein letztendlich frustierendes und sinnloses Ereigniss darstellt, vielleicht noch getaugt. Als Langfilm scheitert er allerdings an der Übertreibung seines Minimalismusses.
Den langatmigen Videoanalysen und langen Aufnahmen des leeren Gesichtes des Hauptdarstellers zuzusehen, langweilen dabei aber ebenso extrem, wie die mageren, belanglos und mühsam ausgesprochenen Dialoge aller Beteiligte.
Wenn damit die innere Leere des Witwers ausgedrückt werden soll, ist dies gelungen. Unterhaltsam oder ansatzweise interessant ist dies aber in keinster Weise.
Von einer mystisch, transzendenten Stimmung wie im ebenfalls wortkargen und entrückten Walhalla Rising, ist Fear X meilenweit entfernt.
mit 2
mit 2
mit 3
mit 1
bewertet am 30.01.15 um 11:15
Gleich vorweg: Freunde des neorealistischen Sozialdramas aus dem Italien der 40er Jahre, sollten um diesen Film einen weiten Bogen machen. Leute, die ihrem Gehirn mal etwas Urlaub gönnen möchten, finden hier eine halbwegs willkommene Abwechslung.
Irgendwann in naher Zukunft dringen Kaijus, dinosaurierähnliche Riesenmonster, durch eine Dimensionsschleuse in den Pacific, um aus der Menschheit Gehacktes zu machen.
Die Erdenbürger bündeln ihre Ressourcen und erschaffen gigantische Roboter, um dem Ansturm Einhalt zu gebieten.
Als die Angriffswellen der Kaiju's zunehmen und die Monster immer gewaltiger werden, reift in den Hirnen der Generäle ein tollkühner Plan: Sie wollen den "Drift" wagen. Eine Reise in die Dimensionsschleuse, um diese für immer atomar zu versiegeln...
Was sich hier wie eine Steilvorlage für eine legänderes Schlachtengewitter anhört und potenziell auch alle benötigten Zutaten dafür mitbringt, hakt leider durch massive handwerkliche Mängel an allen Ecken und Kanten.
An erster Linie wären hier die Schauspieler zu nennen. Bis auf Ron Perlman in einer Nebenrolle (Abspann bis zum Ende gucken!) und dem schwarzen General, wurden die Darsteller vor allem nach ihrem Aussehen und dem körperlichen Fitnessgrad gecastet.
Langweilige "good looking Joes" mit dem unerträglich glattem und langweiligem Sonnyboyflair des "kalifornia surfers" ausgestattet, verhindern so schon im Ansatz, Pacific Rim als irgendwie ernstzuehmendes Werk zu betrachten. Zu sehr hat man hier versucht, auf der seichten Transformers Welle mitzureiten.
Den endgültigen dramaturgischen Todesstoß setzen dabei jedoch die permanent rumblödelnden Wissenschaftler, die in bester Marx Brothers Manier, weit jenseits unter der Humorgrenze, den trotteligen Nerd meinen geben zu müßen.
Hätte man auf die beiden Sülzköpfe ebenso verzichtet wie auf den völlig belanglosen Mittelteil, in dem krampfhaft versucht wird, eine Romanze aus dem Hut zu zaubern, in völlig deplatzierten Kindheitstraumata rumzustochern und ein überflüßiges Ringelrangelrose Mätzchen zu installieren, wer mit wem im Roboter sitzen darf (Die beiden Piloten müßen synchron arbeitende Gehirne haben, also "Soulmates" sein), wäre zumindest für 90 min Kurzweil gesorgt.
Durch die extrem langweilge 50 minütige Pseudohandlung nach der Auftaktaction und der leider zu keinem Zeitpunkt erzeugten Spannung, reduziert sich Pacific Rim selbst auf den reinen Schauwert. Der aber hat es zumeist in sich und schafft es hin und wieder, dem Zuschauer einiges Interesse abzuringen, zumahl die 3D Perspektiven ebenso überzeugen, wie der rauhbeinige Vinatage Look des Steam Punk Maschinenparks. Auch wenn manchesmal zugunsten der Übersichtlichkeit weniger mehr gewesen wäre und mir weniger Bio-Schnick Schnack (zwei Gehirne, Säure spucken und Tentakel aus dem Mund...) zugunsten roher Gewalt in guter ehrlicher Godzille Manier mehr zugesagt hätte.
Alles im Allem waren die Zutaten für ein außergewöhnliches Sci-Fi/Creatures Festmahl wohl vorhanden, leider hat der Regisseur aber das richtige Rezept für die Zubereitung nicht gefunden...
Irgendwann in naher Zukunft dringen Kaijus, dinosaurierähnliche Riesenmonster, durch eine Dimensionsschleuse in den Pacific, um aus der Menschheit Gehacktes zu machen.
Die Erdenbürger bündeln ihre Ressourcen und erschaffen gigantische Roboter, um dem Ansturm Einhalt zu gebieten.
Als die Angriffswellen der Kaiju's zunehmen und die Monster immer gewaltiger werden, reift in den Hirnen der Generäle ein tollkühner Plan: Sie wollen den "Drift" wagen. Eine Reise in die Dimensionsschleuse, um diese für immer atomar zu versiegeln...
Was sich hier wie eine Steilvorlage für eine legänderes Schlachtengewitter anhört und potenziell auch alle benötigten Zutaten dafür mitbringt, hakt leider durch massive handwerkliche Mängel an allen Ecken und Kanten.
An erster Linie wären hier die Schauspieler zu nennen. Bis auf Ron Perlman in einer Nebenrolle (Abspann bis zum Ende gucken!) und dem schwarzen General, wurden die Darsteller vor allem nach ihrem Aussehen und dem körperlichen Fitnessgrad gecastet.
Langweilige "good looking Joes" mit dem unerträglich glattem und langweiligem Sonnyboyflair des "kalifornia surfers" ausgestattet, verhindern so schon im Ansatz, Pacific Rim als irgendwie ernstzuehmendes Werk zu betrachten. Zu sehr hat man hier versucht, auf der seichten Transformers Welle mitzureiten.
Den endgültigen dramaturgischen Todesstoß setzen dabei jedoch die permanent rumblödelnden Wissenschaftler, die in bester Marx Brothers Manier, weit jenseits unter der Humorgrenze, den trotteligen Nerd meinen geben zu müßen.
Hätte man auf die beiden Sülzköpfe ebenso verzichtet wie auf den völlig belanglosen Mittelteil, in dem krampfhaft versucht wird, eine Romanze aus dem Hut zu zaubern, in völlig deplatzierten Kindheitstraumata rumzustochern und ein überflüßiges Ringelrangelrose Mätzchen zu installieren, wer mit wem im Roboter sitzen darf (Die beiden Piloten müßen synchron arbeitende Gehirne haben, also "Soulmates" sein), wäre zumindest für 90 min Kurzweil gesorgt.
Durch die extrem langweilge 50 minütige Pseudohandlung nach der Auftaktaction und der leider zu keinem Zeitpunkt erzeugten Spannung, reduziert sich Pacific Rim selbst auf den reinen Schauwert. Der aber hat es zumeist in sich und schafft es hin und wieder, dem Zuschauer einiges Interesse abzuringen, zumahl die 3D Perspektiven ebenso überzeugen, wie der rauhbeinige Vinatage Look des Steam Punk Maschinenparks. Auch wenn manchesmal zugunsten der Übersichtlichkeit weniger mehr gewesen wäre und mir weniger Bio-Schnick Schnack (zwei Gehirne, Säure spucken und Tentakel aus dem Mund...) zugunsten roher Gewalt in guter ehrlicher Godzille Manier mehr zugesagt hätte.
Alles im Allem waren die Zutaten für ein außergewöhnliches Sci-Fi/Creatures Festmahl wohl vorhanden, leider hat der Regisseur aber das richtige Rezept für die Zubereitung nicht gefunden...
mit 3
mit 5
mit 4
mit 3
bewertet am 25.01.15 um 14:54
Als angenehmen Old School Bond abgespeichert hat mich die Deja Vu Auswertung eines anderen belehrt.
Old School sind vor allem die exotischen Locations rund um den Erdball, die bisher cinematographisch verschont geblieben sind.
Ansonsten fällt Ein Q... durch eine brutal schnelle Schnittfolge ins Auge, die dieses James Bond Kapitel zum hektischsten Vertreter seiner Zunft macht. Im 1/3 Sekunden Takt, mitunter sogar so schnell, daß ich mit dem Nachzählen garnicht mehr hinterherkam, sind die Scenen aneinander getakkert. Die wackelige Handkamera tut ihr übriges dazu, die Nerven des Zuschauers zu ruinieren.
Ansonsten ist der Bond sehr gradlinieg erzählt und konzentriert sich auf Bonds eigensinnigen Feldzug gegen Mr. Greene, der ihn zeitweise das Vertrauen von M kostet.
Unüblich ist, daß Greene nicht der Erzbösewicht ist, der die Welt mit den Abgrund reißen will, sondern ein Allerweltsgauner, der sich in Bananenrepubliken an korrupten Politikern und Militärs bereichert.
Auf Q's Waffenkammer wird leider verzichtet und der Martini muß irgendsoeinem In-Getränk weichen.
Der Bruch mit den Traditionen soll Bond wohl aus der Klischeeecke befreien und dem Charakter mehr psychologische Handlungsoptionen verschaffen.
Leider wird er dadurch austauschbar und verliert durch seine Entwicklung zu einem Protagonisten des Film Noir viel von seinem positiven Charme.
Zwar gibt es auch hier wieder technische Mätzchen, diese reduzieren sich aber hauptsächlich auf auf ein Highend Computerprogramm in Designer Graphik und wirkt in seiner Gesamtbeurteilung zwar Schick, aber unnötig effekthascherisch.
So bleibt der Eindruck zurück, daß James ganz im Sinne des Zeitgeistes immer brüchiger und ruppiger wird und die Zeiten, indenen man wohlgelaunt und abenteuertrunken aus dem Kino wackelte um höchstselbst m nächsten Spielkasino eine Million zu gewinnen und mit einem Supermodell im Arm im Helikopter den Raketenwerfern des russischen KGBs zu entkommen, wohl für immer vorbei.
Geblieben ist hingegen Bond Attitüde, in jedem Moment stets mit voller Überzeugung zu wißen was zu tun ist und immer die Kontrolle über das Geschehen zu behalten. Auch die Fähigkeit, immer den richtigen Spruch auf der Lippe zu haben, hat er nicht verlernt.
Das selbst ist wohl neben den exotischen Schauplätzen das einzige Relikt aus der großen Bond Tradition. Und komischer Weise hat mich genau das, grenzenlos gelangweilt........?
Old School sind vor allem die exotischen Locations rund um den Erdball, die bisher cinematographisch verschont geblieben sind.
Ansonsten fällt Ein Q... durch eine brutal schnelle Schnittfolge ins Auge, die dieses James Bond Kapitel zum hektischsten Vertreter seiner Zunft macht. Im 1/3 Sekunden Takt, mitunter sogar so schnell, daß ich mit dem Nachzählen garnicht mehr hinterherkam, sind die Scenen aneinander getakkert. Die wackelige Handkamera tut ihr übriges dazu, die Nerven des Zuschauers zu ruinieren.
Ansonsten ist der Bond sehr gradlinieg erzählt und konzentriert sich auf Bonds eigensinnigen Feldzug gegen Mr. Greene, der ihn zeitweise das Vertrauen von M kostet.
Unüblich ist, daß Greene nicht der Erzbösewicht ist, der die Welt mit den Abgrund reißen will, sondern ein Allerweltsgauner, der sich in Bananenrepubliken an korrupten Politikern und Militärs bereichert.
Auf Q's Waffenkammer wird leider verzichtet und der Martini muß irgendsoeinem In-Getränk weichen.
Der Bruch mit den Traditionen soll Bond wohl aus der Klischeeecke befreien und dem Charakter mehr psychologische Handlungsoptionen verschaffen.
Leider wird er dadurch austauschbar und verliert durch seine Entwicklung zu einem Protagonisten des Film Noir viel von seinem positiven Charme.
Zwar gibt es auch hier wieder technische Mätzchen, diese reduzieren sich aber hauptsächlich auf auf ein Highend Computerprogramm in Designer Graphik und wirkt in seiner Gesamtbeurteilung zwar Schick, aber unnötig effekthascherisch.
So bleibt der Eindruck zurück, daß James ganz im Sinne des Zeitgeistes immer brüchiger und ruppiger wird und die Zeiten, indenen man wohlgelaunt und abenteuertrunken aus dem Kino wackelte um höchstselbst m nächsten Spielkasino eine Million zu gewinnen und mit einem Supermodell im Arm im Helikopter den Raketenwerfern des russischen KGBs zu entkommen, wohl für immer vorbei.
Geblieben ist hingegen Bond Attitüde, in jedem Moment stets mit voller Überzeugung zu wißen was zu tun ist und immer die Kontrolle über das Geschehen zu behalten. Auch die Fähigkeit, immer den richtigen Spruch auf der Lippe zu haben, hat er nicht verlernt.
Das selbst ist wohl neben den exotischen Schauplätzen das einzige Relikt aus der großen Bond Tradition. Und komischer Weise hat mich genau das, grenzenlos gelangweilt........?
mit 3
mit 3
mit 4
mit 2
bewertet am 20.01.15 um 12:58
Menschenrechte, Rassenunruhen, Staatsschulden. Es liegt vieles im argen im Land of the Free. Aber Filme machen, das könnse.
Der Polarexpress ist nahe am perfekten Weihnachtsfilm. Ohne im Kitsch zu ertrinken, transportiert er den Zauber der Weihnacht aus Kinderaugen in die Welt der Erwachsenen, ohne dabei auf die nötige Portion Ironie, Action und Phantasy zu verzichten, die das Herz der desillusionierten Adoleszens in Verzückung geraten läßt.
Ein kleiner junge kann am Heiligabend kein Auge zudrücken. Heute Nacht will er sehen, wie der Weihnachtsmann die Geschenke bringt.
Kurz vor dem Einnicken durchflutet helles Licht sein Zimmer. Draußen im Schneegestöber kreischen die Räder und von rauchendem Dampf umhüllt, kommt eine Eisenbahn vor dem Haus des Jungen zu stehen. Der Polarexpress. Der Junge rennt zum Zug und trifft auf den etwas merkwürdigen Schaffner, der den Kleinen zu einer Fahrt zum Nordpol, wo der Wieihnachtsmann haust, einlädt.
Erst zögerlich, dann aber von der Neugier überrumpelt, betritt der Junge den Waggon.
Dort hat sich schon eine Schar Kinder eingefunden, die sich ebenfalls auf die abenteuerliche Reise eingelassen haben. Der Junge (es werden im Film keine Namen genannt) freundet sich schnell mit einem dunkelhäutigen Mädchen an, mit der er ab jetzt in waghalsige Verwicklungen verstrickt wird.
Die Eisenbahnfahrt, die etwa die Hälfte des Filmes ausmacht, ist mit allerlei Schwierigkeiten gespickt die gemeistert werden müßen und bei der alle Register des modernen 3D Kinos gezogen werden. Temporeiche Achterbahnfahrten, beinahe Entgleisungen, Bremsdefekte, Kamerafahrten entlang von Steilklippen und Wasserfällen, und Kamikazespiränzchen auf dem Dach des Zuges im dichtesten Schneegestöber schöpfen beinah schon alle Variationen des Nervenkitzels aus, die sich aus dem Spiel mit der dritten Dimension ergeben.
Die zweite Hälfte des Filmes spielt am Nordpol. Dort steht die Stadt der Wichtel, die für den Weihnachtsmann die Geschenke produzieren. Dabei gleicht der pittoreske Ort eher einer Megacity, die mit ihren riesigen Produktionsanlagen so etwas wie die Motorcity Detroit, in seiner charmanten Version darstellt.
Auch hier kommen die kleinen Helden vom Weg ab und müßen sich einen Weg durch die Katakomben und Produktionsanlagen der Stadt schlagen, bis sie dem Walk In des Weihnachtsmannes, der jedem Schwergewichtsweltmeister alle Ehre machen würde, beiwohnen dürfen. Nach allerlei Achterbahnfahrten und Rutschpartien durch die Eingeweide der Stadt, verschlägt es sie in den Geschenksack des Weihnachtsmannes, der zunöchst durch die Luft transportiert wird, um auf dem Schlitten des Santa Claus endgelagert zu werden. So können die 3D Pioniere ihre Kreativität auch im luftigen Terrain austoben und somit für allerlei spektakuläre Momente sorgen.
Nachdem die Kinder allerlei Wirrwar durchlebt und dem Weihnachtsmann die Hand geschüttelt haben, begeben sie sich wieder auf die gemächliche Reise in das heimische Bett, das sie vor unbestimmter Zeit verlassen haben.
Jahre später, die meisten Kinder haben die Magie der Weihnachtsnacht längst durch ihre Alltagssorgen verdrängt, erinnert nur den Protagonisten ein Kleinod noch immer an diese phantastische Reise und hält den Zauber lebendig.......
Das angenehme am Polarexpress ist, daß er es schafft, ohne Rührseligkeiten eine überzeugende Weihnachtsatmosphäre zu verbreiten, dabei trotzdem, ganz unaufdringlich, eine Botschaft zu vermitteln und auch in den zahlreichen Actionsequenzen, die besondere Athmosphäre zu behalten, die um die Zeit des Tannenbaumkultes herrscht. Von ein paar albernen Tanz- und Gesangseinlagen abgesehen, unterhält der Film von der ersten bis zur letzten Minute durch symphatische Charaktere und stimmungsvoller Kulisse.
Nochmal zu erwähnen sind die außergewöhnlich effektvoll eingesetzten 3D Effekte, die mit raumgreifender Tiefenstaffelung überzeugen und einen hohen Spaßfaktor besitzen.
Nur manchesmal scheint die Perspektive ein wenig verzerrt zu sein.
Aus heutiger Sicht aber allemal, wie hoch die Pioniere aus den Anfängen des modernen 3D Kinos schon damals die Meßlattte gelegt und allen anderen Nachfolgern das Leben erschwert haben....
Der Polarexpress ist nahe am perfekten Weihnachtsfilm. Ohne im Kitsch zu ertrinken, transportiert er den Zauber der Weihnacht aus Kinderaugen in die Welt der Erwachsenen, ohne dabei auf die nötige Portion Ironie, Action und Phantasy zu verzichten, die das Herz der desillusionierten Adoleszens in Verzückung geraten läßt.
Ein kleiner junge kann am Heiligabend kein Auge zudrücken. Heute Nacht will er sehen, wie der Weihnachtsmann die Geschenke bringt.
Kurz vor dem Einnicken durchflutet helles Licht sein Zimmer. Draußen im Schneegestöber kreischen die Räder und von rauchendem Dampf umhüllt, kommt eine Eisenbahn vor dem Haus des Jungen zu stehen. Der Polarexpress. Der Junge rennt zum Zug und trifft auf den etwas merkwürdigen Schaffner, der den Kleinen zu einer Fahrt zum Nordpol, wo der Wieihnachtsmann haust, einlädt.
Erst zögerlich, dann aber von der Neugier überrumpelt, betritt der Junge den Waggon.
Dort hat sich schon eine Schar Kinder eingefunden, die sich ebenfalls auf die abenteuerliche Reise eingelassen haben. Der Junge (es werden im Film keine Namen genannt) freundet sich schnell mit einem dunkelhäutigen Mädchen an, mit der er ab jetzt in waghalsige Verwicklungen verstrickt wird.
Die Eisenbahnfahrt, die etwa die Hälfte des Filmes ausmacht, ist mit allerlei Schwierigkeiten gespickt die gemeistert werden müßen und bei der alle Register des modernen 3D Kinos gezogen werden. Temporeiche Achterbahnfahrten, beinahe Entgleisungen, Bremsdefekte, Kamerafahrten entlang von Steilklippen und Wasserfällen, und Kamikazespiränzchen auf dem Dach des Zuges im dichtesten Schneegestöber schöpfen beinah schon alle Variationen des Nervenkitzels aus, die sich aus dem Spiel mit der dritten Dimension ergeben.
Die zweite Hälfte des Filmes spielt am Nordpol. Dort steht die Stadt der Wichtel, die für den Weihnachtsmann die Geschenke produzieren. Dabei gleicht der pittoreske Ort eher einer Megacity, die mit ihren riesigen Produktionsanlagen so etwas wie die Motorcity Detroit, in seiner charmanten Version darstellt.
Auch hier kommen die kleinen Helden vom Weg ab und müßen sich einen Weg durch die Katakomben und Produktionsanlagen der Stadt schlagen, bis sie dem Walk In des Weihnachtsmannes, der jedem Schwergewichtsweltmeister alle Ehre machen würde, beiwohnen dürfen. Nach allerlei Achterbahnfahrten und Rutschpartien durch die Eingeweide der Stadt, verschlägt es sie in den Geschenksack des Weihnachtsmannes, der zunöchst durch die Luft transportiert wird, um auf dem Schlitten des Santa Claus endgelagert zu werden. So können die 3D Pioniere ihre Kreativität auch im luftigen Terrain austoben und somit für allerlei spektakuläre Momente sorgen.
Nachdem die Kinder allerlei Wirrwar durchlebt und dem Weihnachtsmann die Hand geschüttelt haben, begeben sie sich wieder auf die gemächliche Reise in das heimische Bett, das sie vor unbestimmter Zeit verlassen haben.
Jahre später, die meisten Kinder haben die Magie der Weihnachtsnacht längst durch ihre Alltagssorgen verdrängt, erinnert nur den Protagonisten ein Kleinod noch immer an diese phantastische Reise und hält den Zauber lebendig.......
Das angenehme am Polarexpress ist, daß er es schafft, ohne Rührseligkeiten eine überzeugende Weihnachtsatmosphäre zu verbreiten, dabei trotzdem, ganz unaufdringlich, eine Botschaft zu vermitteln und auch in den zahlreichen Actionsequenzen, die besondere Athmosphäre zu behalten, die um die Zeit des Tannenbaumkultes herrscht. Von ein paar albernen Tanz- und Gesangseinlagen abgesehen, unterhält der Film von der ersten bis zur letzten Minute durch symphatische Charaktere und stimmungsvoller Kulisse.
Nochmal zu erwähnen sind die außergewöhnlich effektvoll eingesetzten 3D Effekte, die mit raumgreifender Tiefenstaffelung überzeugen und einen hohen Spaßfaktor besitzen.
Nur manchesmal scheint die Perspektive ein wenig verzerrt zu sein.
Aus heutiger Sicht aber allemal, wie hoch die Pioniere aus den Anfängen des modernen 3D Kinos schon damals die Meßlattte gelegt und allen anderen Nachfolgern das Leben erschwert haben....
mit 4
mit 4
mit 4
mit 3
bewertet am 18.01.15 um 11:34
Top Angebote
kleinhirn
GEPRÜFTES MITGLIED
FSK 18
Aktivität
Forenbeiträge0
Kommentare41
Blogbeiträge0
Clubposts0
Bewertungen510
Mein Avatar
Weitere Funktionen
(510)
(16)
Beste Bewertungen
kleinhirn hat die folgenden 4 Blu-rays am besten bewertet:
Letzte Bewertungen
Filme suchen nach
Mit dem Blu-ray Filmfinder können Sie Blu-rays nach vielen unterschiedlichen Kriterien suchen.
Die Filmbewertungen von kleinhirn wurde 341x besucht.