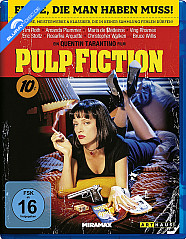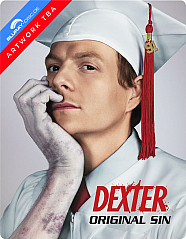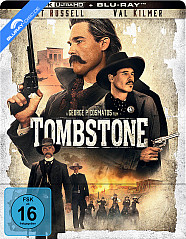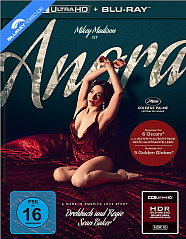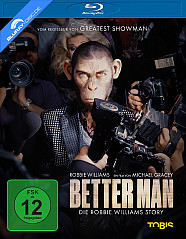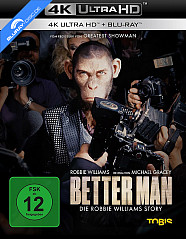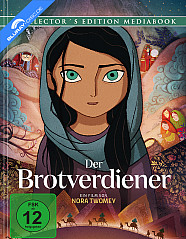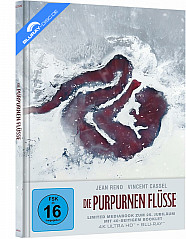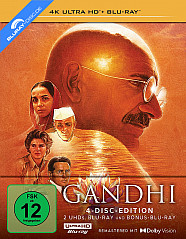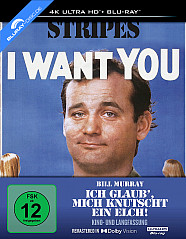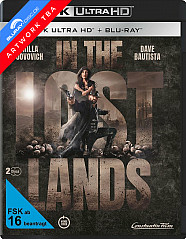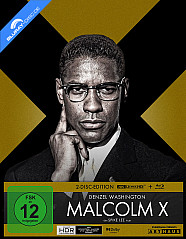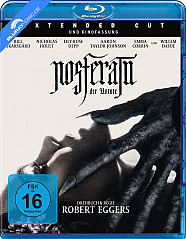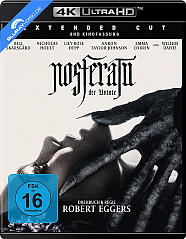Plaion Pictures verschiebt Blu-ray-Release von "Magnum: Die komplette Serie" auf den 30. Juni 2025"Rock 'n' Roll Ringo": Kirmes-Drama mit Martin Rohde ab 30.05. auf Blu-ray Disc"Ein Minecraft Film": Computerspielverfilmung mit Jason Momoa und Jack Black demnächst auf Blu-ray und 4K UHD - UPDATE 2Die bluray-disc.de Vorbestell- und Kaufcharts vom März 2025Erneut auf Blu-ray: "The Devil’s Rejects" und "3 from Hell" von Rob Zombie in Mediabook-EditionenItalo Cinema Collection: "Das Haus mit dem dunklen Keller - A Blade in the Dark" erscheint auf Ultra HD Blu-rayBald auf Blu-ray in Mediabooks: Die "Pulse"- und "Feast "-Horrorfilme von NSM Records - UPDATE 3Gewinnspiel: bluray-disc.de und Tobis Film verlosen "Better Man - Die Robbie Williams Story" auf Blu-ray, 4K UHD und DVDHeute neu auf Blu-ray Disc: "Mufasa", "Better Man - Die Robbie Williams Story", "Die purpurnen Flüsse" im 4K-Mediabook und mehrJede Menge tolle Preise gewinnen: Am 14. April startet der "bluray-disc.de Osterkalender 2025"
NEWSTICKER
Filmbewertungen von kleinhirn
Um es vorweg zu sagen: der Film hält, was er verspricht. Eine temporeiche Erzählung geht hier mit kurzweiliger Action Hand in Hand.
Wer bei Roland Emmerich allerdings feine Charakterzeichnungen oder tiefschürfende Dialoge erwartet, ist sicherlich nicht mehr ganz bei Trost. Dennoch erfüllt der Film um die Entführung und Rettung des amerikanischen Präsis, James Sawyer, durch den Ex-Soldaten John Cale, bei dem das Amiland so alles auffährt, was es zur Rettung ihrer No1 so aufzubieten hat, die Mindesterwartungen. Das es dabei nicht bei einem reinen Häuserkampf bleibt, bei dem die präsidiale Stiefelbutz zurückerobert werden muß, ist dabei bei Emmerich fast schon zwangsläufig. So spielen dann natürlich auch die Army, die Air Force, geheime Kommandozentralen, unterirdische Geheimgänge, Verschwörungstheorien, Atombomben, Präsidentenlimos, finstere Intrigen, osteuropäische Genickbrecher und ein elfjähriges Mädchen (John's Tochter Emily), das in 60 min. mehr Heldentaten vollbringt, als in Homers Odyssee besungen werden , keine ungewichtigen Rollen.
Zerdepperte Emmerich das Weiße Haus in Independence Day und 2012 noch ganz beiläufig, widmet er sich in White House Down jedes Zimmers einzeln, um dieses nachhaltig zu zerstören.
Dabei macht Roland hier seinem Ruf als "Master of Desaster" auch wieder alle Ehre. Wobei das eigentliche Desaster sich hier sicherlich nicht auf die Zerstörungsorgie bezieht, sondern auf den kübelweise ausgeschütte Pathos, den der Zuschauer ungewollt über sich ergehen laßen muß und dessen Penetranz nur schwer zu ertragen ist.
Obwohl die Melange aus altbewährten Actionzutaten an sich gut bei der Stange hält und es spielend schafft, den Feierabend zwischen den Championsleague Spielen etwas aufzupeppeln, gelingt es der Geschichte um den Securityanwärter. U.S. Capitol Police Officier John Cale, der mit seiner elfjährigen Tochter bei einer Besichtigungstour durch das Weiße Haus in den Schlamassel um die Präsidentenentführung gerät, auf Grund der tödlichen Dosis amerikanischen Patriotismuses, nicht, sich in die zweite Liga der Actionfilme zu spielen.
Ist die reine Action zwar noch allemal Die Hard würdig, kann man die Blödheit der Dialoge und den Schmalz der Rahmenhandlung beim besten Willen nicht ausblenden.
Angefangen bei der 11 jährigen Tochter, die in den Präsidenten verliebt ist, weil er "Daddy" lebend aus dem Afghanistankrieg zurückgeholt hat, über den Daddy selber, der sich keine ehrenvollere Aufgabe vorstellen kann, als sein Leben dem Schutz des Präsidenten zu widmen, bis hin zum Präsidenten selber, der eine reine Ausgeburt aller guten menschlichen Tugenden zu sein scheint.
Genau diese schleimig sülzigen Charakterzeichnungen, für die der Begriff "platt" noch zu dreidimensional gefasst scheint, sind es, die für den faden Nachgeschmack sorgen. Die unheilige Allianz zwischen Cale und Sawyer führt zu einem gegenseitigem zugeschleime und arschgekrieche, das jegliches akzeptables Maß überschreitet.
Der schwer zu ertragende Tiefpunkt ist die Schlußsequenz, bei der Emily, die sauer auf ihren Daddy ist, weil er nicht bei der Schulvorführung anwesend war, wo sie Fahnenschwänkerin war, im Garten vor dem weißen Haus steht und mit der Flagge des Präsidenten wedelt und so die Kampfjets zur Befehlsverweigerung der Bombadierung des weißen Hauses bewegt. Wohl dem, der seine Peristaltik unter Kontrolle hält, wenn die Galle den Rückwärtsgang einlegt.
Wäre Emmerich nicht mit diesem Faible für seichten Patriotismus, ekelerregendem Amerikanismus und Würgreiz provozierendem Familienschmalz geschlagen, hätte er ein filmisches Highlight schaffen können.
So aber ist das mit Logiklöchern gepflasterte Actionspektakel mit einer klebrigen Süße gesegnet, die für bleibendes Unbehagen in der Kehle sorgt.
Das Channing Tatuum dabei als Actioncharacter eine Fehlbesetzung darstellt und viel zu bübchenhaft wirkt, ist dabei ein fast schon zu vernachläßgendes Übel.
Positiv: Selten wurde der Raumklang so bereichernd eingesetzt, wie hier!
Wer bei Roland Emmerich allerdings feine Charakterzeichnungen oder tiefschürfende Dialoge erwartet, ist sicherlich nicht mehr ganz bei Trost. Dennoch erfüllt der Film um die Entführung und Rettung des amerikanischen Präsis, James Sawyer, durch den Ex-Soldaten John Cale, bei dem das Amiland so alles auffährt, was es zur Rettung ihrer No1 so aufzubieten hat, die Mindesterwartungen. Das es dabei nicht bei einem reinen Häuserkampf bleibt, bei dem die präsidiale Stiefelbutz zurückerobert werden muß, ist dabei bei Emmerich fast schon zwangsläufig. So spielen dann natürlich auch die Army, die Air Force, geheime Kommandozentralen, unterirdische Geheimgänge, Verschwörungstheorien, Atombomben, Präsidentenlimos, finstere Intrigen, osteuropäische Genickbrecher und ein elfjähriges Mädchen (John's Tochter Emily), das in 60 min. mehr Heldentaten vollbringt, als in Homers Odyssee besungen werden , keine ungewichtigen Rollen.
Zerdepperte Emmerich das Weiße Haus in Independence Day und 2012 noch ganz beiläufig, widmet er sich in White House Down jedes Zimmers einzeln, um dieses nachhaltig zu zerstören.
Dabei macht Roland hier seinem Ruf als "Master of Desaster" auch wieder alle Ehre. Wobei das eigentliche Desaster sich hier sicherlich nicht auf die Zerstörungsorgie bezieht, sondern auf den kübelweise ausgeschütte Pathos, den der Zuschauer ungewollt über sich ergehen laßen muß und dessen Penetranz nur schwer zu ertragen ist.
Obwohl die Melange aus altbewährten Actionzutaten an sich gut bei der Stange hält und es spielend schafft, den Feierabend zwischen den Championsleague Spielen etwas aufzupeppeln, gelingt es der Geschichte um den Securityanwärter. U.S. Capitol Police Officier John Cale, der mit seiner elfjährigen Tochter bei einer Besichtigungstour durch das Weiße Haus in den Schlamassel um die Präsidentenentführung gerät, auf Grund der tödlichen Dosis amerikanischen Patriotismuses, nicht, sich in die zweite Liga der Actionfilme zu spielen.
Ist die reine Action zwar noch allemal Die Hard würdig, kann man die Blödheit der Dialoge und den Schmalz der Rahmenhandlung beim besten Willen nicht ausblenden.
Angefangen bei der 11 jährigen Tochter, die in den Präsidenten verliebt ist, weil er "Daddy" lebend aus dem Afghanistankrieg zurückgeholt hat, über den Daddy selber, der sich keine ehrenvollere Aufgabe vorstellen kann, als sein Leben dem Schutz des Präsidenten zu widmen, bis hin zum Präsidenten selber, der eine reine Ausgeburt aller guten menschlichen Tugenden zu sein scheint.
Genau diese schleimig sülzigen Charakterzeichnungen, für die der Begriff "platt" noch zu dreidimensional gefasst scheint, sind es, die für den faden Nachgeschmack sorgen. Die unheilige Allianz zwischen Cale und Sawyer führt zu einem gegenseitigem zugeschleime und arschgekrieche, das jegliches akzeptables Maß überschreitet.
Der schwer zu ertragende Tiefpunkt ist die Schlußsequenz, bei der Emily, die sauer auf ihren Daddy ist, weil er nicht bei der Schulvorführung anwesend war, wo sie Fahnenschwänkerin war, im Garten vor dem weißen Haus steht und mit der Flagge des Präsidenten wedelt und so die Kampfjets zur Befehlsverweigerung der Bombadierung des weißen Hauses bewegt. Wohl dem, der seine Peristaltik unter Kontrolle hält, wenn die Galle den Rückwärtsgang einlegt.
Wäre Emmerich nicht mit diesem Faible für seichten Patriotismus, ekelerregendem Amerikanismus und Würgreiz provozierendem Familienschmalz geschlagen, hätte er ein filmisches Highlight schaffen können.
So aber ist das mit Logiklöchern gepflasterte Actionspektakel mit einer klebrigen Süße gesegnet, die für bleibendes Unbehagen in der Kehle sorgt.
Das Channing Tatuum dabei als Actioncharacter eine Fehlbesetzung darstellt und viel zu bübchenhaft wirkt, ist dabei ein fast schon zu vernachläßgendes Übel.
Positiv: Selten wurde der Raumklang so bereichernd eingesetzt, wie hier!
mit 3
mit 5
mit 5
mit 3
bewertet am 17.03.14 um 11:34
Platt, albern, pubertär.
An sich ganz nette Grundidee, in dieser Form aber sicherlich nur was für gaaaaanz jungebliebene.
An sich ganz nette Grundidee, in dieser Form aber sicherlich nur was für gaaaaanz jungebliebene.
mit 2
mit 3
mit 4
mit 3
bewertet am 16.03.14 um 13:18
Bride of Re-Animator (BoR) setzt in Punkto abstrusität erfreulicherweise nahtlos an seinem prominenten Vorgänger an.
10 Monate nach dem unerquicklichen Ausgang ihres Experimentes am Ende des ersten Teiles, schlagen sich Dr. Herbert West und Dr. Dan Caine nun als Lanzarettärzte durch die Wirren der lateinamerikanischen Bürgerkriege. Das Gute stets mit dem nützlichen verbindend, verlieren die beiden Wissenschaftler dabei aber nie die Forschung aus den Augen und weigern sich immer noch hartnäckig, den Tod als das Ende des Lebens zu akzeptieren. Bei der hohen Quote von Kollateralschäden, die solche Guerillakriege leider stets mit sich führen, wäre es doch eine unverzeibahre Sünde, nicht nebenbei noch etwas "Feldforschung" mit dem wohlbekannten grünen Serum, natürlich völlig uneigennützig, zu betreiben. Dabei wird dem einen oder anderen Gefallenen sein "ewiger Frieden" noch etwas in der Zeitachse nach hinten verlegt...
Um das Wissen über die Legenden die sich um die angebliche Sterblichkeit ranken bereichert, kehren Dr. West und Dr. Cain anschließend wieder in ihren universitären Alltag zurück um dort ihre neu gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen.
In der nächsten Stufe ihrer Experimente gelingt es ihnen mitlerweile, aus diversen wild zusammengewürfelten Extremitäten, komplett neue, skurrile Lebensformen zu erschaffen.
Vom Enthusiasmus des Erfolges angestachelt, beschließen die beiden Forscher nun, gänzlich unerschloßenes Terrain zu betreten und ihr Werk zu krönen: Einen komplett neuen Menschen, bestehend aus den besten Einzelteilen die das örtliche Leichenschauhaus zu bieten hat, zu erschaffen und den Hauch des Lebens einzuverleiben.
Während das Experiment so immer mehr an Gestalt annimmt, drohen ein übereifriger Polizist und der wiedererwachte Kopf von Dr. Carl Hill (Teil 1), der größten biomedizinischen Sensation der jüngeren Geschichte, noch vor ihrem endgültigen Durchbruch, einen Strich durch die Rechnung zu machen....
Entwickelt sich der Re-Animator noch gemächlich, um schließlich in einem furiosem Finale zu enden, geht es beim BoR schon gleich zu Beginn nicht gerade zimperlich zur Sache. Da der Grundgedanke ja hinlänglich bekannt ist, spart man sich hier die einleitende Geschichte und kommt gleich zur Sache.
So geben sich makabere, skurrile und kranke Einfälle von Anfang an einander die Klinke in die Hand und sorgen beim Zuschauer für 93 min. ungetrübter Splatterfreude.
Auch wenn BoR nicht den Fehler begeht, die gleiche Geschichte nochmal zu variieren, sondern konsequent weiterzuentwickeln, macht der erste Teil doch insgesamt etwas mehr Spaß, da er in sich logischer und stimmiger verläuft. BoR dagegen folgt zwar auch einer stringenten Erzählung wirkt aber an einigen Stellen zugunsten bizarrer Einfälle etwas konstruiert. Das macht sich vor allem im Finale bemerkbar, bei dem auf Kosten der Erzähllogik ein furioses Effektfeuerwerk abgefackelt wird.
Trotz dieser dezenten Kritikpunkte muß man BoR attestieren, daß er seiner hauptsächlichen Aufgabe, gleich dem ersten Teil, nämlich eine Menge Spaß unter den Connosseuren des abseitigen Humores zu verbreiten, vollends gerecht wird.#
Das Bild ist so gut wie zu keiner Zeit allererste Sahne. Führt man sich aber zu Gemüte, wie schwer es war, überhaupt an zelluloid Material einer Unrated Version zu gelangen und führt man sich vor Augen, in welch desolatem Zustand dieses war, muß man Capelight ein großes Lob für das Ergebnis Restaurierung aussprechen. Anstatt irgendwelche Filmfussel auf Bluray zu bannen, hat sich Capelight dazu entschloßen, unter Bewahrung des originalen Filmlooks auf allzu viel digitale Glättung zu verzichten und so echtes 80er jahre Flair zurück in die gute Stube zu holen.
Ähnliches gilt für den Ton.
10 Monate nach dem unerquicklichen Ausgang ihres Experimentes am Ende des ersten Teiles, schlagen sich Dr. Herbert West und Dr. Dan Caine nun als Lanzarettärzte durch die Wirren der lateinamerikanischen Bürgerkriege. Das Gute stets mit dem nützlichen verbindend, verlieren die beiden Wissenschaftler dabei aber nie die Forschung aus den Augen und weigern sich immer noch hartnäckig, den Tod als das Ende des Lebens zu akzeptieren. Bei der hohen Quote von Kollateralschäden, die solche Guerillakriege leider stets mit sich führen, wäre es doch eine unverzeibahre Sünde, nicht nebenbei noch etwas "Feldforschung" mit dem wohlbekannten grünen Serum, natürlich völlig uneigennützig, zu betreiben. Dabei wird dem einen oder anderen Gefallenen sein "ewiger Frieden" noch etwas in der Zeitachse nach hinten verlegt...
Um das Wissen über die Legenden die sich um die angebliche Sterblichkeit ranken bereichert, kehren Dr. West und Dr. Cain anschließend wieder in ihren universitären Alltag zurück um dort ihre neu gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen.
In der nächsten Stufe ihrer Experimente gelingt es ihnen mitlerweile, aus diversen wild zusammengewürfelten Extremitäten, komplett neue, skurrile Lebensformen zu erschaffen.
Vom Enthusiasmus des Erfolges angestachelt, beschließen die beiden Forscher nun, gänzlich unerschloßenes Terrain zu betreten und ihr Werk zu krönen: Einen komplett neuen Menschen, bestehend aus den besten Einzelteilen die das örtliche Leichenschauhaus zu bieten hat, zu erschaffen und den Hauch des Lebens einzuverleiben.
Während das Experiment so immer mehr an Gestalt annimmt, drohen ein übereifriger Polizist und der wiedererwachte Kopf von Dr. Carl Hill (Teil 1), der größten biomedizinischen Sensation der jüngeren Geschichte, noch vor ihrem endgültigen Durchbruch, einen Strich durch die Rechnung zu machen....
Entwickelt sich der Re-Animator noch gemächlich, um schließlich in einem furiosem Finale zu enden, geht es beim BoR schon gleich zu Beginn nicht gerade zimperlich zur Sache. Da der Grundgedanke ja hinlänglich bekannt ist, spart man sich hier die einleitende Geschichte und kommt gleich zur Sache.
So geben sich makabere, skurrile und kranke Einfälle von Anfang an einander die Klinke in die Hand und sorgen beim Zuschauer für 93 min. ungetrübter Splatterfreude.
Auch wenn BoR nicht den Fehler begeht, die gleiche Geschichte nochmal zu variieren, sondern konsequent weiterzuentwickeln, macht der erste Teil doch insgesamt etwas mehr Spaß, da er in sich logischer und stimmiger verläuft. BoR dagegen folgt zwar auch einer stringenten Erzählung wirkt aber an einigen Stellen zugunsten bizarrer Einfälle etwas konstruiert. Das macht sich vor allem im Finale bemerkbar, bei dem auf Kosten der Erzähllogik ein furioses Effektfeuerwerk abgefackelt wird.
Trotz dieser dezenten Kritikpunkte muß man BoR attestieren, daß er seiner hauptsächlichen Aufgabe, gleich dem ersten Teil, nämlich eine Menge Spaß unter den Connosseuren des abseitigen Humores zu verbreiten, vollends gerecht wird.#
Das Bild ist so gut wie zu keiner Zeit allererste Sahne. Führt man sich aber zu Gemüte, wie schwer es war, überhaupt an zelluloid Material einer Unrated Version zu gelangen und führt man sich vor Augen, in welch desolatem Zustand dieses war, muß man Capelight ein großes Lob für das Ergebnis Restaurierung aussprechen. Anstatt irgendwelche Filmfussel auf Bluray zu bannen, hat sich Capelight dazu entschloßen, unter Bewahrung des originalen Filmlooks auf allzu viel digitale Glättung zu verzichten und so echtes 80er jahre Flair zurück in die gute Stube zu holen.
Ähnliches gilt für den Ton.
mit 4
mit 4
mit 3
mit 4
bewertet am 15.03.14 um 15:39
Im Grunde genommen stellt Gravity die aufgebohrte Version eines aus den Fugen geratenen Weltraumausfluges dar, dessen Grundgedanke bereits in Kubricks Weltraumoper 2001 das Licht der Sci-Fi Welt erblickte und der in Sunshine konsequent weiterentwickelt wurde.
Die Ärztin Ryan Stone (Sandra Bullock) und der Astronaut Matt Kowalski (George Clooney) werden bei einem Außeneinsatz an der Spaceshuttle von einem Trümmerschauer eines explodierten Satteliten überrascht und der Möglichkeit beraubt, wieder heil mit ihrem Mutterschiff auf der Erde zu landen. Die einzige Möglichkeit, nicht wieder in die Erdathmosphäre einzutreten und als Funkemariechen in den Abendnachrichten zu landen, besteht darin, zwei nahegelegene Weltraumstationen zu erreichen und die dortigen Rettungskapseln zu aktivieren.
Da sich bei der Bullock aber der Sauerstoff allmählich dem Ende zuneigt und George nicht mehr allzuviel Treibstoff im Kanister zum manövrieren hat, bleibt ihnen nur eine geringe Chance gemeinsam zu überleben...
Ausgehend von dieser prekären Situation machen sich die beiden Astronauten in ihren Raumanzügen, quasi als Seilschaft, auf den einsamen Ritt durchs Weltall. Das dabei längst nicht alles glatt geht und der Trip in einem nackten Überlebenskampf mündet, ist dabei schon aus dramaturgischen Gründen beinahe zwangsläufig.
Auch wenn sich der Plott als einigermaßen originell erweist und mit etlichen Fallstricken aufwartet, fehlt es dem Film jedoch an erzählerischer Tiefe und wirklich packenden Sequenzen. Zu sehr ähneln sich die Widrigkeiten auf den Raumstationen und die wiederkehrenden Sattelitentrümmer, als das man wirklich von einem eskalierenden Spannungsscenario sprechen könnte.
Das die eher routiniert wirkenden Actionsequenzen zwar einen hohen visuellen Schauwert besitzen aber nie wirklich richtig unter die Haut gehen, sondern eher an das übliche Blockbuster Gewitter erinnern, liegt aber zum Teil auch an der etwas hölzern agierenden Sandra Bullock (die ca. 90% des Filmes ausmacht), die die Klautrophobie des gefangenseins im Raumanzug und die allgegenwärtige Todesangst nie richtig zu transportieren versteht. Insgesamt kommt sie über ein püppchenhaftes Auftreten, bei der ihr keine große schauspielerische Breite abverlangt wird, nicht hinaus, so daß ihr Oscargewinn einen dubiosen Nachgeschmack hinzerläßt.
Hinzu kommt noch, das man ständig von der atemberaubenden 3D Animation abgelenkt wird, so daß man sich viel mehr an der Tiefe des Weltalls und dem spektakulärem Blick auf die Erde berauscht, als sich auf die Entwicklung des Dramas zu konzentrieren.
Und genau in diesem vermeintlichen Schwachpunkt liegt aber jedoch auch die einzigartige Besonderheit des Filmes begründet, die ihn so absolut sehenswert macht. Nie zuvor wurde 3D wohl so filmdienlich angewand wie in Gravity.
Wer bisher den Mehrwert von 3D in Zweifel gezogen hat, wird hier unwiederruflich eines besseren belehrt.
Der Blick in die Unendlichkeit des Universums ist schlicht atemberaubend und sonst wohl nur Astronauten oder den Beduinen in der Sahara vorbehalten.
Der Exodus durchs All wird in seiner räumlichen Tiefe so dermaßen realitisch dargestellt, daß man sich ohne weiteres in die Lage der Einsamkeit und Verlorenheit der Astronauten hineinversetzen kann. Das gab es in dieser Konsequenz bisher noch nie.
Gemeinsam mit den wunderschönen Panoramaaufnahmen der durch die Schwärze des Weltalls gleitenden Erde, bietet sich dem Zuschauer ein einzigartiges Erlebnis, daß kein Mensch, der noch über die Fähigkeit des Staunens verfügt, entgehen lassen sollte.
Auch wenn sich das letzte Drittel des Filmes fast ausschließlich auf die Vorgänge in den Raumstationen und die Rettungskapsel konzentriert, sollte jeder zumindest einmal das 3D Ticket für diesen Trip gelöst haben...
Die Ärztin Ryan Stone (Sandra Bullock) und der Astronaut Matt Kowalski (George Clooney) werden bei einem Außeneinsatz an der Spaceshuttle von einem Trümmerschauer eines explodierten Satteliten überrascht und der Möglichkeit beraubt, wieder heil mit ihrem Mutterschiff auf der Erde zu landen. Die einzige Möglichkeit, nicht wieder in die Erdathmosphäre einzutreten und als Funkemariechen in den Abendnachrichten zu landen, besteht darin, zwei nahegelegene Weltraumstationen zu erreichen und die dortigen Rettungskapseln zu aktivieren.
Da sich bei der Bullock aber der Sauerstoff allmählich dem Ende zuneigt und George nicht mehr allzuviel Treibstoff im Kanister zum manövrieren hat, bleibt ihnen nur eine geringe Chance gemeinsam zu überleben...
Ausgehend von dieser prekären Situation machen sich die beiden Astronauten in ihren Raumanzügen, quasi als Seilschaft, auf den einsamen Ritt durchs Weltall. Das dabei längst nicht alles glatt geht und der Trip in einem nackten Überlebenskampf mündet, ist dabei schon aus dramaturgischen Gründen beinahe zwangsläufig.
Auch wenn sich der Plott als einigermaßen originell erweist und mit etlichen Fallstricken aufwartet, fehlt es dem Film jedoch an erzählerischer Tiefe und wirklich packenden Sequenzen. Zu sehr ähneln sich die Widrigkeiten auf den Raumstationen und die wiederkehrenden Sattelitentrümmer, als das man wirklich von einem eskalierenden Spannungsscenario sprechen könnte.
Das die eher routiniert wirkenden Actionsequenzen zwar einen hohen visuellen Schauwert besitzen aber nie wirklich richtig unter die Haut gehen, sondern eher an das übliche Blockbuster Gewitter erinnern, liegt aber zum Teil auch an der etwas hölzern agierenden Sandra Bullock (die ca. 90% des Filmes ausmacht), die die Klautrophobie des gefangenseins im Raumanzug und die allgegenwärtige Todesangst nie richtig zu transportieren versteht. Insgesamt kommt sie über ein püppchenhaftes Auftreten, bei der ihr keine große schauspielerische Breite abverlangt wird, nicht hinaus, so daß ihr Oscargewinn einen dubiosen Nachgeschmack hinzerläßt.
Hinzu kommt noch, das man ständig von der atemberaubenden 3D Animation abgelenkt wird, so daß man sich viel mehr an der Tiefe des Weltalls und dem spektakulärem Blick auf die Erde berauscht, als sich auf die Entwicklung des Dramas zu konzentrieren.
Und genau in diesem vermeintlichen Schwachpunkt liegt aber jedoch auch die einzigartige Besonderheit des Filmes begründet, die ihn so absolut sehenswert macht. Nie zuvor wurde 3D wohl so filmdienlich angewand wie in Gravity.
Wer bisher den Mehrwert von 3D in Zweifel gezogen hat, wird hier unwiederruflich eines besseren belehrt.
Der Blick in die Unendlichkeit des Universums ist schlicht atemberaubend und sonst wohl nur Astronauten oder den Beduinen in der Sahara vorbehalten.
Der Exodus durchs All wird in seiner räumlichen Tiefe so dermaßen realitisch dargestellt, daß man sich ohne weiteres in die Lage der Einsamkeit und Verlorenheit der Astronauten hineinversetzen kann. Das gab es in dieser Konsequenz bisher noch nie.
Gemeinsam mit den wunderschönen Panoramaaufnahmen der durch die Schwärze des Weltalls gleitenden Erde, bietet sich dem Zuschauer ein einzigartiges Erlebnis, daß kein Mensch, der noch über die Fähigkeit des Staunens verfügt, entgehen lassen sollte.
Auch wenn sich das letzte Drittel des Filmes fast ausschließlich auf die Vorgänge in den Raumstationen und die Rettungskapsel konzentriert, sollte jeder zumindest einmal das 3D Ticket für diesen Trip gelöst haben...
mit 3
mit 5
mit 4
mit 1
bewertet am 11.03.14 um 18:00
Der Italo Western von Mann zu Mann zählt zu den solideren Beiträgen des Genres und wird durch die charismatische Präsenz von Lee van Cleef und den athmosphärischen Score von Maestro Ennio Morricone geadelt.
Ansonsten wartet die Vergeltungsgeschichte um Ryan (van Cleef) und Bill (John Phillip Law) mit allem Gerümpel auf, die für den Italowestern typisch sind: verdorbene Charaktere, schmutzige Halunken, zwielichtiges Gesindel, rauhe Landschaften, ein Schuß Brutalität und komplexe Charakterkonstellationen.
Auffällig ist bei den Itaowestern im Gegensatz zu den meisten amerikanischen Pendants, daß Fehlen einer historischen, politischen oder sozialen Metaebene. Der Italowestern will nicht mehr sein, als eine Charakterstudie einsamer Rächer in einer Welt, in der jeder sein eigenes Schicksal in die Hand nehmen muß. Der geschichtliche Kontext bildet nur den Rahmen für die Verdichtung elementarer Schicksalsfragen der Menschen, die den Tod allgegenwärtig vor Augen haben.
In diesem Sinne reiht sich "Die Rechnung wird mit Blei bezahlt" (alternativ Titel) nahtlos in die Chronologie herausragender Italowestern ein.
Das es dabei um den Wettkampf zweier Revolverhelden, die sich an der selben Bande rächen wollen und sich gegenseitig stets zu behindern versuchen, um nicht um den süßen Geschmack der Rache betrogen zu werden, verleiht dem Film sogar noch eine besonders sportliche Note.
Der Sound kann sich hören lassen und die Qualität des Bildes schwankt zwischen bemerkenswert sauber und (in wenigen Scenen) grade noch akzeptabel.
Da das Ausgangsmaterial solcher Filme aber oft erbärmlich ist und viele Aufnahmen auch im Original nicht so scharf wie eine Chilischote sind, kann man davon ausgehen, daß man sich nahe am Maximum dessen bewegt, was rausgekitzelt werden konnte.
Besonders wichtig fällt hierbei auf (wie bei den anderen Explosiv Media Western), daß die Farbgebung und damit der Look des Filmes schön altmodisch und "dreckig" geblieben sind, und damit der Originalcharakter bewahrt wurde.
Ansonsten wartet die Vergeltungsgeschichte um Ryan (van Cleef) und Bill (John Phillip Law) mit allem Gerümpel auf, die für den Italowestern typisch sind: verdorbene Charaktere, schmutzige Halunken, zwielichtiges Gesindel, rauhe Landschaften, ein Schuß Brutalität und komplexe Charakterkonstellationen.
Auffällig ist bei den Itaowestern im Gegensatz zu den meisten amerikanischen Pendants, daß Fehlen einer historischen, politischen oder sozialen Metaebene. Der Italowestern will nicht mehr sein, als eine Charakterstudie einsamer Rächer in einer Welt, in der jeder sein eigenes Schicksal in die Hand nehmen muß. Der geschichtliche Kontext bildet nur den Rahmen für die Verdichtung elementarer Schicksalsfragen der Menschen, die den Tod allgegenwärtig vor Augen haben.
In diesem Sinne reiht sich "Die Rechnung wird mit Blei bezahlt" (alternativ Titel) nahtlos in die Chronologie herausragender Italowestern ein.
Das es dabei um den Wettkampf zweier Revolverhelden, die sich an der selben Bande rächen wollen und sich gegenseitig stets zu behindern versuchen, um nicht um den süßen Geschmack der Rache betrogen zu werden, verleiht dem Film sogar noch eine besonders sportliche Note.
Der Sound kann sich hören lassen und die Qualität des Bildes schwankt zwischen bemerkenswert sauber und (in wenigen Scenen) grade noch akzeptabel.
Da das Ausgangsmaterial solcher Filme aber oft erbärmlich ist und viele Aufnahmen auch im Original nicht so scharf wie eine Chilischote sind, kann man davon ausgehen, daß man sich nahe am Maximum dessen bewegt, was rausgekitzelt werden konnte.
Besonders wichtig fällt hierbei auf (wie bei den anderen Explosiv Media Western), daß die Farbgebung und damit der Look des Filmes schön altmodisch und "dreckig" geblieben sind, und damit der Originalcharakter bewahrt wurde.
mit 4
mit 4
mit 3
mit 4
bewertet am 01.03.14 um 15:36
Der Film ist der Rede nicht wert. Ein paar schicke Effekte hangeln sich um eine dümmliche Handlung und peinliche Dialoge.
Wer auf hirnverbranntes Patriotengehabe bis zum Anschlag steht, darf sich hier fühlen wie eine Made im Speck.
Wer auf hirnverbranntes Patriotengehabe bis zum Anschlag steht, darf sich hier fühlen wie eine Made im Speck.
mit 2
mit 4
mit 4
mit 2
bewertet am 27.02.14 um 11:27
Marlon Brando hin oder her, der wüste Rockerkrig von einst nötigt heute dem Zuschauer allenfalls ein müdes lächeln ab.
Was Johnny (Brando) mit seiner coolen Gang so an Schabernack in der Kleinstadt anrichtet um den Zorn des Pöbels zu entfachen, wird heut von jeder Grundschulklasse am Wandertag überboten: Wildes rumgeschubse, Bagatelldiebstahl, Mülleimer ausleeren, Mofas kreischen und die Flasche Bier im Kreis rumgehen lassen, war damals aber das Nonplusultra in Sachen Gesellschaftsschocking. Johnny und seine Jungens zeigen dem schäumenden Mob aber mal so richtig, wie man seinen Protest an der Gesellschaft rausläßt.
Zum Glück erkennt jedoch die junge Tochter des Polizisten, ihres Zeichens Bedienung in der Dorfkneipe, daß hinter der rauhen Fassade Johnnys eine gute Seele schlummert und gibt ihm die Möglichkeit, seine unterdrückten Gefühle der Liebe zu äußern.
Da er aber vor seinen Jungs den harten Kerl mimen muß, schafft er den Sprung der Vergangenheitsbewältigung nicht und es kommt nur zu einer symbolischen Sympathiebekundung.
Auch wenn die ungezogenen Bengels von einst, damals mit ihren Eskapaden sicherlich den Volkszorn auf sich gezogen haben, wirkt das präpubertäre Verhalten der Vorstadtrocker aus heutiger Sicht nur noch albern bis dämlich.
20 jährige Heranwachsende, die sich kindischer Benehmen als heutige 13 jährige Schulhofrowdys, schaffen es eigentlich nicht mehr wirkliche Empörung auszulösen oder Gewalt als Ventil für unterdrückte Emotionen nachvollziehbar darzustellen. Stattdessen prägt Mitleid für so spackiges Verhalten den Grundtenor des Filmes.
Aus dieser Sicht wirkt der Film heutzutage eher als Parodie, denn als ernst zunehmende Sozialkritik und Seelenstudie.
Nur der Wertewandel der Gesellschaft, die Gewalteskalation im Kino und der Abstumpfungseffekt der Zuschauer im Laufe der Jahrzehnte bleiben als interessante Fussnote dieses angestaubten Filmes als Diskussionsgrundlage in Erinnerung.
Was Johnny (Brando) mit seiner coolen Gang so an Schabernack in der Kleinstadt anrichtet um den Zorn des Pöbels zu entfachen, wird heut von jeder Grundschulklasse am Wandertag überboten: Wildes rumgeschubse, Bagatelldiebstahl, Mülleimer ausleeren, Mofas kreischen und die Flasche Bier im Kreis rumgehen lassen, war damals aber das Nonplusultra in Sachen Gesellschaftsschocking. Johnny und seine Jungens zeigen dem schäumenden Mob aber mal so richtig, wie man seinen Protest an der Gesellschaft rausläßt.
Zum Glück erkennt jedoch die junge Tochter des Polizisten, ihres Zeichens Bedienung in der Dorfkneipe, daß hinter der rauhen Fassade Johnnys eine gute Seele schlummert und gibt ihm die Möglichkeit, seine unterdrückten Gefühle der Liebe zu äußern.
Da er aber vor seinen Jungs den harten Kerl mimen muß, schafft er den Sprung der Vergangenheitsbewältigung nicht und es kommt nur zu einer symbolischen Sympathiebekundung.
Auch wenn die ungezogenen Bengels von einst, damals mit ihren Eskapaden sicherlich den Volkszorn auf sich gezogen haben, wirkt das präpubertäre Verhalten der Vorstadtrocker aus heutiger Sicht nur noch albern bis dämlich.
20 jährige Heranwachsende, die sich kindischer Benehmen als heutige 13 jährige Schulhofrowdys, schaffen es eigentlich nicht mehr wirkliche Empörung auszulösen oder Gewalt als Ventil für unterdrückte Emotionen nachvollziehbar darzustellen. Stattdessen prägt Mitleid für so spackiges Verhalten den Grundtenor des Filmes.
Aus dieser Sicht wirkt der Film heutzutage eher als Parodie, denn als ernst zunehmende Sozialkritik und Seelenstudie.
Nur der Wertewandel der Gesellschaft, die Gewalteskalation im Kino und der Abstumpfungseffekt der Zuschauer im Laufe der Jahrzehnte bleiben als interessante Fussnote dieses angestaubten Filmes als Diskussionsgrundlage in Erinnerung.
mit 2
mit 3
mit 3
mit 2
bewertet am 24.02.14 um 22:21
Sabata stellt neben Django den wohl beeindruckendsten Charakter des Spaghetti Westerns dar.
Auch wenn Westernurgestein Lee van Cleef hier als Sabata die Rolle des einsamen Rächers auf die Spitze treibt und damit nur knapp an einer Parodie des Genres vorbeischrammt, vereint er doch die besten Elemente des Italowesterns alle unter einem Hut und muß auch heute noch als Ikone betrachtet werden.
Herumtreiber Sabata hält sich in dem Westernkaff Daugherty auf, als er Zeuge eines Banküberfalles wird, bei dem 100.000 Dollar in Gold geraubt werden.
Als Meister im Umgang mit Groß- Mittel- und Kleinkalibrigen Schießeisen gelingt es ihm jedoch, die Schurken im Handumdrehen in die Jagdgründe zu schicken und das Gold unversehrt der Bank auszuhändigen.
Da der Raub jedoch vom reichen Bürger Stengel und Richter O'Hara geplant wurde, um mit diesem Gold Land zu spekulativen Zwecken zu erwerben, sind sie von Sabatas Erfolg nur mäßig entzückt. Deshalb versuchen die beiden Großkopferten auch schleunigst Sabata unter die Grasnarbe zu verfrachten, damit sie sich ungestört die Beute wieder unter den Nagel reißen können.
Da es bei Sabata aber allmählich zu dämmern beginnt, daß der Raub von offizieller Seite geplant war, macht er sich gemeinsam mit seiner Donnerbüchse und zwei skurilen Dorfbewohnern auf die Suche nach den Hintermännern und ihren Helfershelfern, um der Gerechtigkeit in Daugherty wieder ein wenig auf die Sprünge zu helfen...
Stilistisch mit seiner schmuddeligen Bildsprache und seinem morbiden Ambiente noch ganz in der Tradition großer Italowestern verankert, schlägt Sabata nun aber ganz neue, ironische, Saitentöne an. Als abgebrühter Pistolero gibt sich van Cleef zwar wie gewohnt selbstbewußt und kühl bis über die Grenzen der Realitätsverkennung hinaus, bleibt dabei jedoch gewohnt souverän und glaubhaft. Dem charismatischen Auftreten van Cleefs ist es dann auch zu verdanken, daß die Tür zur Persiflage zwar weit augestoßen, jedoch niemals durchschritten wird. Diese Entwicklung bliebTerence Hill (Mein Name ist Nobody) vorbehalten.
Aber es bedarf schon einer gehörigen Portion Selbstbeherrschung, um bei Sabatas Schießkünsten Haltung zu bewahren, und sich das Lachen zu verkneifen. Aus einem halben Dutzend verschiedener Waffen feuert Sabata im Laufe des Films nicht eine einzige Kugel daneben. Ein Parade Beispiel an Effizienz.
Ob aus einer selbstgebastelten Stummelpistole aus dem Handgelenk oder aus 200m über das offene Feld: Sabata trifft mit einer Präzision, gegen die selbst die Bewegungsabläufe eines Phil Taylors so ungehobelt und grobmotorisch aussehen, wie die eines besoffenen Elefantenbullen mit BSE im Endstadium zur Brunftzeit.
Natürlich soll hier der Zuschauer auch ein wenig Schmunzeln. Mit einem spannendem Duell auf Augenhöhe, wie z.b. in "Zwei glorreiche Halunken" hat dies aber nichts gemeinsam. Durch diesen humoristischen Kniff, sowie dem üppigen Waffenarsenal, das ebenso aus Q's Labor (James Bond) stammen könnte, erhält der Italowestern zwar neue Elemente, entkernt sich dabei aber selber und entlrdigt sich seines Sarkasmuses.
Doch dabei nimmt er nur die Entwicklung vorweg, die der Splatterhorror ca. 20 Jahre später vollzogen hat: Durch die eskalierende Zunahme von Gewalt und Brutalität, läuft jedes Genre unweigerlich auf den Punkt zu, ab dem eine weitere Steigerung nur noch ins Absurde führen kann. Dieser Steigerungslogik entzieht sich Sabata, in dem er dieser unfreiwilligen Komik gewollte heitere Charakterzüge und Situationskomiken entgegen stellt.
Doch Sabata hat mehr zu bieten, als bloß das Missing Link zwischen Django und Terence Hill darzustellen. Sabata ist nämlich in erster Linie ein höchst vergnügliches Filmerlebnis, mit einem ausgewogenen Verhältnis von Spannung, Action, Athmosphäre, gepflegter Schauspielkunst. Letztere wird auch durch das agieren von William Berger als Banjo, dem undurchsichtigem Partner von Sabata, bestätigt. Berger, ein österreichisch-amerikanischer Schauspieler, galt als so etwas wie der Alpen-Kinski und hat hippieesker Selbstdarsteller seine Karriere durch unzählige Beziehungs- und Drogeneskapaden immer wieder selbst ins Stocken gebracht. Aber auch Ignazio Spalla als fettleibiger Schmutzfink Carrincha ist ein bedeutendes Element des Filmes, da er so etwas wie den Archetypen des Italowestern symbolisiert, mit dem sich das Genre vom amerikanischen Vorläufer emanzipiert hat. Nicht mehr der tugendhafte Soldat/Cowboy steht hier im Mittelpunkt, sondern sein Gegenentwurf. Carrincha ist ungepflegt, übergewichtig, durchtrieben und von der Aura einer zweifelhaften Vergangenheit geprägt. In diesem Sinne werden hier die guten alten Spaghettiwesterntugenden in Form eines zwielichtigen Kauzes noch einmal in Reinform zelebriert. Nicht unwesentlich zum Vintage look des Filmes tragen die ausgewaschenen Farben und das die manchmal etwas grobschlächtigen Kameraschwenks bei, die Sabata ein ungehobeltes Aussehen verleihen.
Die Restaurierungsarbeiten an Ton, Musik und Bild sind als erstklassig gelungen zu bezeichnen und sichern explosive media einen Ehrenplatz auf der Loge für Filmliebhaber.
Auch wenn Westernurgestein Lee van Cleef hier als Sabata die Rolle des einsamen Rächers auf die Spitze treibt und damit nur knapp an einer Parodie des Genres vorbeischrammt, vereint er doch die besten Elemente des Italowesterns alle unter einem Hut und muß auch heute noch als Ikone betrachtet werden.
Herumtreiber Sabata hält sich in dem Westernkaff Daugherty auf, als er Zeuge eines Banküberfalles wird, bei dem 100.000 Dollar in Gold geraubt werden.
Als Meister im Umgang mit Groß- Mittel- und Kleinkalibrigen Schießeisen gelingt es ihm jedoch, die Schurken im Handumdrehen in die Jagdgründe zu schicken und das Gold unversehrt der Bank auszuhändigen.
Da der Raub jedoch vom reichen Bürger Stengel und Richter O'Hara geplant wurde, um mit diesem Gold Land zu spekulativen Zwecken zu erwerben, sind sie von Sabatas Erfolg nur mäßig entzückt. Deshalb versuchen die beiden Großkopferten auch schleunigst Sabata unter die Grasnarbe zu verfrachten, damit sie sich ungestört die Beute wieder unter den Nagel reißen können.
Da es bei Sabata aber allmählich zu dämmern beginnt, daß der Raub von offizieller Seite geplant war, macht er sich gemeinsam mit seiner Donnerbüchse und zwei skurilen Dorfbewohnern auf die Suche nach den Hintermännern und ihren Helfershelfern, um der Gerechtigkeit in Daugherty wieder ein wenig auf die Sprünge zu helfen...
Stilistisch mit seiner schmuddeligen Bildsprache und seinem morbiden Ambiente noch ganz in der Tradition großer Italowestern verankert, schlägt Sabata nun aber ganz neue, ironische, Saitentöne an. Als abgebrühter Pistolero gibt sich van Cleef zwar wie gewohnt selbstbewußt und kühl bis über die Grenzen der Realitätsverkennung hinaus, bleibt dabei jedoch gewohnt souverän und glaubhaft. Dem charismatischen Auftreten van Cleefs ist es dann auch zu verdanken, daß die Tür zur Persiflage zwar weit augestoßen, jedoch niemals durchschritten wird. Diese Entwicklung bliebTerence Hill (Mein Name ist Nobody) vorbehalten.
Aber es bedarf schon einer gehörigen Portion Selbstbeherrschung, um bei Sabatas Schießkünsten Haltung zu bewahren, und sich das Lachen zu verkneifen. Aus einem halben Dutzend verschiedener Waffen feuert Sabata im Laufe des Films nicht eine einzige Kugel daneben. Ein Parade Beispiel an Effizienz.
Ob aus einer selbstgebastelten Stummelpistole aus dem Handgelenk oder aus 200m über das offene Feld: Sabata trifft mit einer Präzision, gegen die selbst die Bewegungsabläufe eines Phil Taylors so ungehobelt und grobmotorisch aussehen, wie die eines besoffenen Elefantenbullen mit BSE im Endstadium zur Brunftzeit.
Natürlich soll hier der Zuschauer auch ein wenig Schmunzeln. Mit einem spannendem Duell auf Augenhöhe, wie z.b. in "Zwei glorreiche Halunken" hat dies aber nichts gemeinsam. Durch diesen humoristischen Kniff, sowie dem üppigen Waffenarsenal, das ebenso aus Q's Labor (James Bond) stammen könnte, erhält der Italowestern zwar neue Elemente, entkernt sich dabei aber selber und entlrdigt sich seines Sarkasmuses.
Doch dabei nimmt er nur die Entwicklung vorweg, die der Splatterhorror ca. 20 Jahre später vollzogen hat: Durch die eskalierende Zunahme von Gewalt und Brutalität, läuft jedes Genre unweigerlich auf den Punkt zu, ab dem eine weitere Steigerung nur noch ins Absurde führen kann. Dieser Steigerungslogik entzieht sich Sabata, in dem er dieser unfreiwilligen Komik gewollte heitere Charakterzüge und Situationskomiken entgegen stellt.
Doch Sabata hat mehr zu bieten, als bloß das Missing Link zwischen Django und Terence Hill darzustellen. Sabata ist nämlich in erster Linie ein höchst vergnügliches Filmerlebnis, mit einem ausgewogenen Verhältnis von Spannung, Action, Athmosphäre, gepflegter Schauspielkunst. Letztere wird auch durch das agieren von William Berger als Banjo, dem undurchsichtigem Partner von Sabata, bestätigt. Berger, ein österreichisch-amerikanischer Schauspieler, galt als so etwas wie der Alpen-Kinski und hat hippieesker Selbstdarsteller seine Karriere durch unzählige Beziehungs- und Drogeneskapaden immer wieder selbst ins Stocken gebracht. Aber auch Ignazio Spalla als fettleibiger Schmutzfink Carrincha ist ein bedeutendes Element des Filmes, da er so etwas wie den Archetypen des Italowestern symbolisiert, mit dem sich das Genre vom amerikanischen Vorläufer emanzipiert hat. Nicht mehr der tugendhafte Soldat/Cowboy steht hier im Mittelpunkt, sondern sein Gegenentwurf. Carrincha ist ungepflegt, übergewichtig, durchtrieben und von der Aura einer zweifelhaften Vergangenheit geprägt. In diesem Sinne werden hier die guten alten Spaghettiwesterntugenden in Form eines zwielichtigen Kauzes noch einmal in Reinform zelebriert. Nicht unwesentlich zum Vintage look des Filmes tragen die ausgewaschenen Farben und das die manchmal etwas grobschlächtigen Kameraschwenks bei, die Sabata ein ungehobeltes Aussehen verleihen.
Die Restaurierungsarbeiten an Ton, Musik und Bild sind als erstklassig gelungen zu bezeichnen und sichern explosive media einen Ehrenplatz auf der Loge für Filmliebhaber.
mit 4
mit 5
mit 4
mit 4
bewertet am 10.02.14 um 17:35
Schweigende Männer und sprechende Colts. Bleispuckende Pistoleros und schöne Senoritas. Feige dreckig und gemein, ja so muß ein Western sein...
Hätte Mister Leone mit seinen beiden Westernepen nicht den Maßstab auf ein nie wieder zu erreichendes Niveau geschraubt, würde Der Gehetzte der Sierra Madra sicherlich in der ersten Liga des Genres spielen.
In dem 1966 von Sergio Solima inszenierten Italowestern spielt Lee van Cleef die Rolle des Kopfgeldjägers Jonathan Corbet auf der Jagd nach dem Kinderschänder Chuchillo Sanchez (Thomas Milian). Corbet will diese eine Jagd noch übernehmen, bevor er sich im Auftrag des Eisenbahnunternehmers Brokstone (Walter Barnes) als Abgesandter des Staates Texas in Washington zur Ruhe setzen will.
Auf seinem einsamen Ritt durch die Prärie, die karge Wüste des texanischen Grenzlandes sowie die zerklüfteten Felsen der Sierra Madre kommt Corbes Conchilla zwar immer dichter auf die Fersen, muß ihn aber jedesmal durch widrige Umständen, Pech und auf Grund der Bauerschläue seines Widerpartes, in letzter Sekunde durch die Finger schlüpfen laßen.
So schafft es Conchilla schließlich in den vermeintlich sicheren Hafen, sein Heimatland Mexico, zu entkommen. Corbes jedoch, der die Verfolgung mitlerweile mit seinem eigenem Schicksal verknüpft hat, macht Conchilla in Mexico schnell ausfindig.
Kurz davor den Vergewaltiger zu stellen, taucht plötzlich Brokstone mit seinem Hofstaat auf, um Corbet bei der Treibjagd zur Hand zu gehen. Ist es reine Neugier und Jagdlust, die Brokstone nach Mexico verschlagen hat, oder steckt vielleicht viel mehr dahinter.....?
Kaum ein anderer Schauspieler hat den Italo Westernheld so archetypisch verkörpert wie Lee van Cleef. Mit seiner Mischung aus Männlichkeit und Härte, sowie seinem eisernen, durchdringenden Blick und einem Gesicht, daß von der rauhen Wildniss geprägt zu sein scheint, fügt er sich nahtlos in die spröde Weite des Landes ein.
Van Cleef spielte diese Rolle direkt nach Zwei glorreiche Halunken und mimt auch hier den einsamen Rächer. Das aber nicht nur Van Cleef noch unter dem Einfluß des Meisterwerkes stand, sondern auch das gesamte Produktionsteam, offenbart sich im Showdown, der auch hier in einer von Morricone's Musik untermalten Menage a Trois mündet, am deutlichsten.
Aber nicht nur beim Finale hat man sich am Meister orientiert. Auch die von Schmutz und Dreck geprägte Bildsprache, sowie die vielen Close Ups erinnern stark die geniale Vorlage. Das die Musik von Ennio Morricone hingegen leider nicht die Originalität und Weite des Vorgängers aufweist, trägt sicherlich mit dazu bei, daß dem gehetzten der Sierra Madre höhere Filmehren verwährt geblieben sind.
Bleibt zum Schluß noch zu vermerken, daß Explosiv Media einem der besten nicht Leone Italowestern überhaupt ein ansprechendes Booklet spendiert hat und sich durch das erstklassige Remastering viele Freunde im Saloon und auf der Ranch gemacht hat und sich voller Stolz einen Hilfssherrifstern auf die geschwellte Brust nageln darf!!!
Hätte Mister Leone mit seinen beiden Westernepen nicht den Maßstab auf ein nie wieder zu erreichendes Niveau geschraubt, würde Der Gehetzte der Sierra Madra sicherlich in der ersten Liga des Genres spielen.
In dem 1966 von Sergio Solima inszenierten Italowestern spielt Lee van Cleef die Rolle des Kopfgeldjägers Jonathan Corbet auf der Jagd nach dem Kinderschänder Chuchillo Sanchez (Thomas Milian). Corbet will diese eine Jagd noch übernehmen, bevor er sich im Auftrag des Eisenbahnunternehmers Brokstone (Walter Barnes) als Abgesandter des Staates Texas in Washington zur Ruhe setzen will.
Auf seinem einsamen Ritt durch die Prärie, die karge Wüste des texanischen Grenzlandes sowie die zerklüfteten Felsen der Sierra Madre kommt Corbes Conchilla zwar immer dichter auf die Fersen, muß ihn aber jedesmal durch widrige Umständen, Pech und auf Grund der Bauerschläue seines Widerpartes, in letzter Sekunde durch die Finger schlüpfen laßen.
So schafft es Conchilla schließlich in den vermeintlich sicheren Hafen, sein Heimatland Mexico, zu entkommen. Corbes jedoch, der die Verfolgung mitlerweile mit seinem eigenem Schicksal verknüpft hat, macht Conchilla in Mexico schnell ausfindig.
Kurz davor den Vergewaltiger zu stellen, taucht plötzlich Brokstone mit seinem Hofstaat auf, um Corbet bei der Treibjagd zur Hand zu gehen. Ist es reine Neugier und Jagdlust, die Brokstone nach Mexico verschlagen hat, oder steckt vielleicht viel mehr dahinter.....?
Kaum ein anderer Schauspieler hat den Italo Westernheld so archetypisch verkörpert wie Lee van Cleef. Mit seiner Mischung aus Männlichkeit und Härte, sowie seinem eisernen, durchdringenden Blick und einem Gesicht, daß von der rauhen Wildniss geprägt zu sein scheint, fügt er sich nahtlos in die spröde Weite des Landes ein.
Van Cleef spielte diese Rolle direkt nach Zwei glorreiche Halunken und mimt auch hier den einsamen Rächer. Das aber nicht nur Van Cleef noch unter dem Einfluß des Meisterwerkes stand, sondern auch das gesamte Produktionsteam, offenbart sich im Showdown, der auch hier in einer von Morricone's Musik untermalten Menage a Trois mündet, am deutlichsten.
Aber nicht nur beim Finale hat man sich am Meister orientiert. Auch die von Schmutz und Dreck geprägte Bildsprache, sowie die vielen Close Ups erinnern stark die geniale Vorlage. Das die Musik von Ennio Morricone hingegen leider nicht die Originalität und Weite des Vorgängers aufweist, trägt sicherlich mit dazu bei, daß dem gehetzten der Sierra Madre höhere Filmehren verwährt geblieben sind.
Bleibt zum Schluß noch zu vermerken, daß Explosiv Media einem der besten nicht Leone Italowestern überhaupt ein ansprechendes Booklet spendiert hat und sich durch das erstklassige Remastering viele Freunde im Saloon und auf der Ranch gemacht hat und sich voller Stolz einen Hilfssherrifstern auf die geschwellte Brust nageln darf!!!
mit 4
mit 4
mit 4
mit 3
bewertet am 15.01.14 um 23:38
Interessanter, hierzulande aber dem breiten Publikum kaum bekannter SciFi Horror, der zu den Highlights dieses Genres aus den 60ern gehören soll.
Das erste Gefühl, daß sich nach dem Sichten des Filmmaterial, noch bevor sich die Gedanken den Weg aus dem Nebel der Übermannung ins klärende Bewußtsein gebahnt haben, einstellt, ist: zumindest interessant.
Denn was sich an Geschichte um die eher spärliche Action aufbauscht, ist schon mehr als Hahnebüchen zu bezeichnen. Hier werden auf engsten Raum Physik, Parapsychologie, Religion, Anthropologie und Science Fiction bis an ihre Grenzen ausgereizt und zu einem Konglomerat verschmolzen, der sich freiwillig sicher nicht so zusammengefunden hätte. Wäre an der Geschichte nämlich auch nur eine Silbe wahr, müßten 5 Millionen Jahre Menschheitsgeschichte umgeschrieben werden. Das sich bei so einem kruden Mix Entsetzen und Bewunderung das Gleichgewicht halten, ist somit vorprogrammiert. Die Geschichte entwickelt sich nämlich zum Ende hin so sehr ins Abnorme, daß man Angst hat, gleich drehn se alle vor der Kammera völlig durch oder driften sanft in die parodistischen Gefilde ab. So übermannt den geneigten Zuschauer auch ein ums andere mal die leise Spekulation, selbst Monthy Python hätten in ihren besten Zeiten nicht so einen Stuß hingekriegt, und amüsiert sich köstlich.
Zu diesem ungewollten parodistischen Grundtenor tragen auch die Spezialeffekte zu einem nicht geringen Anteil bei. Denn die nicht grade für aufwendige Effekte bekannte Horrorfilmschmiede Hammer, untermauert die intellektuellen Höhenflüge der Autoren nur mit spärlicher und mitleidserregender visueller Kost, so daß man manchmal meint, die Protagonisten unterhalten sich gerade über einen anderen Film. Denn warum drei Totenköpfe und ein wackelnder Stahlcontainer zu artistischen geistigen Spekulationen in so luftige Höhen einladen, läßt sich auf Grund des Gesehenen nur schwer nachvollziehen. Das Professor Quatermass mit seinen unorthodoxen Mutmaßungen dabei dennoch immer wieder ins schwarze trift, übertrifft die Kombinationsgabe Sherlock Holmes um ein vielfaches!
Den absoluten Tiefpunkt des Filmes hingegen bietet die von Barbara in Trance visualisierte Scene, in der sich die Marsianer gegenseitig abschlachten. In ihrer unverfroren zur Schau gestellten Einfältigkeit, vor der sich auch "Beast Creatures" nicht zu verstecken braucht, droht diese sogar den ganzen Film mit in den Abgrund zu reißen.
Das der aber Film nicht aber im Niemandsland der Trashperlen versunken ist, liegt wohl an der doch durchaus angenehmen sixties Atmosphäre dieses B-Filmes, seinen ambitionierten Schauspielern, sowie einem Regisseur der sein Handwerk versteht und es schafft, mit einigen psychologischen Finessen, dem Film seine eigene Handschrift aufzudrücken.
Unter diesen Aspekten läßt sich die große Fangemeinde der Hammerfilme wohl auch am einfachsten erklären. Denn kaum woanders liegen das Auweia, Geil, das darf doch nicht wahr sein und abgefahren beieinander und laden so zu einer unnachahmlichen Geisterbahnfahrt der Gefühle ein.
Das das Mediabook hochwertig ist und sich die Mühen der Restauration sehen lassen können, sein abschließend noch lobend erwähnt.
Das erste Gefühl, daß sich nach dem Sichten des Filmmaterial, noch bevor sich die Gedanken den Weg aus dem Nebel der Übermannung ins klärende Bewußtsein gebahnt haben, einstellt, ist: zumindest interessant.
Denn was sich an Geschichte um die eher spärliche Action aufbauscht, ist schon mehr als Hahnebüchen zu bezeichnen. Hier werden auf engsten Raum Physik, Parapsychologie, Religion, Anthropologie und Science Fiction bis an ihre Grenzen ausgereizt und zu einem Konglomerat verschmolzen, der sich freiwillig sicher nicht so zusammengefunden hätte. Wäre an der Geschichte nämlich auch nur eine Silbe wahr, müßten 5 Millionen Jahre Menschheitsgeschichte umgeschrieben werden. Das sich bei so einem kruden Mix Entsetzen und Bewunderung das Gleichgewicht halten, ist somit vorprogrammiert. Die Geschichte entwickelt sich nämlich zum Ende hin so sehr ins Abnorme, daß man Angst hat, gleich drehn se alle vor der Kammera völlig durch oder driften sanft in die parodistischen Gefilde ab. So übermannt den geneigten Zuschauer auch ein ums andere mal die leise Spekulation, selbst Monthy Python hätten in ihren besten Zeiten nicht so einen Stuß hingekriegt, und amüsiert sich köstlich.
Zu diesem ungewollten parodistischen Grundtenor tragen auch die Spezialeffekte zu einem nicht geringen Anteil bei. Denn die nicht grade für aufwendige Effekte bekannte Horrorfilmschmiede Hammer, untermauert die intellektuellen Höhenflüge der Autoren nur mit spärlicher und mitleidserregender visueller Kost, so daß man manchmal meint, die Protagonisten unterhalten sich gerade über einen anderen Film. Denn warum drei Totenköpfe und ein wackelnder Stahlcontainer zu artistischen geistigen Spekulationen in so luftige Höhen einladen, läßt sich auf Grund des Gesehenen nur schwer nachvollziehen. Das Professor Quatermass mit seinen unorthodoxen Mutmaßungen dabei dennoch immer wieder ins schwarze trift, übertrifft die Kombinationsgabe Sherlock Holmes um ein vielfaches!
Den absoluten Tiefpunkt des Filmes hingegen bietet die von Barbara in Trance visualisierte Scene, in der sich die Marsianer gegenseitig abschlachten. In ihrer unverfroren zur Schau gestellten Einfältigkeit, vor der sich auch "Beast Creatures" nicht zu verstecken braucht, droht diese sogar den ganzen Film mit in den Abgrund zu reißen.
Das der aber Film nicht aber im Niemandsland der Trashperlen versunken ist, liegt wohl an der doch durchaus angenehmen sixties Atmosphäre dieses B-Filmes, seinen ambitionierten Schauspielern, sowie einem Regisseur der sein Handwerk versteht und es schafft, mit einigen psychologischen Finessen, dem Film seine eigene Handschrift aufzudrücken.
Unter diesen Aspekten läßt sich die große Fangemeinde der Hammerfilme wohl auch am einfachsten erklären. Denn kaum woanders liegen das Auweia, Geil, das darf doch nicht wahr sein und abgefahren beieinander und laden so zu einer unnachahmlichen Geisterbahnfahrt der Gefühle ein.
Das das Mediabook hochwertig ist und sich die Mühen der Restauration sehen lassen können, sein abschließend noch lobend erwähnt.
mit 4
mit 4
mit 3
mit 3
bewertet am 15.01.14 um 15:25
Der König des Bahnhofkinos hat wieder zugeschlagen.
Regisseur Jess Franco, dem es eigentlich nur darum ging, junge wabbernde Brüste und klaffende Wunden dem nach Schmuddel lechzenden Kinopublikum als Fraß vorzuwerfen, hat mit Jack the Ripper jedoch einen erstaunlich "komplexen" Film geschaffen. Wenn man mal davon absieht, daß Zürich als Drehort London doch nicht so ganz ersetzen kann und ein Burggraben eben nicht die Themse ist, kann der Film doch tatsächlich mit einem gewißen viktorianischem Flair aufwarten. Das dabei einige nächtliche Scenen mit Xenonstrahlern ausgeleuchtet zu sein scheinen, stört dabei wenig, da man sich bei einem Franco Film ohnehin am Rande des Trashuniversums wähnt, in dem eben andere Naturgesetze herrschen.
In den engen Gassen zwischen Themse und Bordel also treibt der Unhold Dennis Orloff (Klaus Kinski) sein Unwesen. Orloff ist seines Zeichens Arzt und knabbert seit seiner frühesten Jugend an einem traumatischen Erlebnis mit einer Prostituierten. Die einzige Möglichkeit in dieser prätherapeutischen Epoche, mit dieser Seelenpein fertig zu werden, besteht logischer Weise darin, Frauen die Brüste abzuschneiden und sie fachferecht zu zerstückeln. Von diesem Recht macht Orloff auch reichlich gebrauch, bis sich die Schlinge Scotland Yards immer enger um seinen Hals zusammenzieht...
Durch diese psychologische Komponente, erhält Jack the Ripper tatsächlich eine gewiße Komplexität, zumahl Kinski die innere Qual Orloffs mimisch überzeugend darzustellen vermag.
Aber auch die anderen Schauspieler sind mehr als Staffage und geben diesem Werk immerhin den Anschein der seriösität. Aber auch wenn Jack the Ripper mit Kinski, Geraldine Chaplin Herbert Lux und Andreas Mannkopf einigermaßen prominent besetzt ist, kann er sich auf Grund des Inhaltes und doch sehr schematischen Handlungablaufes nicht aus dem Dunstkreis des Exploitationfilmes lossagen.
Da dieses aber durchaus seinen eigenen Charme, und Franco eine riesen Fangemeinde, zu denen auch Polanski und Tarantino zählen, besitzt, geht das durchaus in Ordnung. Mit Rückendeckung solch cinematographischer Ikonen muß man sich außerdem der Befriedigung niederer Instinkte weniger schämen.
Was uns von Jess Franco noch alles ins Haus steht, kann man in den beigefügten Trailern erahnen. Auch wird dann die Bildungslücke, was man denn bitteschön unter dem Subgenre des Frauenfolterfilms zu verstehen hat, ein für alle mal geschloßen sein.
Das Bild ist hervorragend restauriert und im beigefügten Interview plaudert Produzent und Franco Liebhaber Erwin C. Dietrich aus dem Nähkästchen und läßt den geneigten Zuschauer an den Mühen der Restauration und den geplanten Veröffentlichungen teilhaben.
Moralisten sollten sich schon mal warm anziehen....
Regisseur Jess Franco, dem es eigentlich nur darum ging, junge wabbernde Brüste und klaffende Wunden dem nach Schmuddel lechzenden Kinopublikum als Fraß vorzuwerfen, hat mit Jack the Ripper jedoch einen erstaunlich "komplexen" Film geschaffen. Wenn man mal davon absieht, daß Zürich als Drehort London doch nicht so ganz ersetzen kann und ein Burggraben eben nicht die Themse ist, kann der Film doch tatsächlich mit einem gewißen viktorianischem Flair aufwarten. Das dabei einige nächtliche Scenen mit Xenonstrahlern ausgeleuchtet zu sein scheinen, stört dabei wenig, da man sich bei einem Franco Film ohnehin am Rande des Trashuniversums wähnt, in dem eben andere Naturgesetze herrschen.
In den engen Gassen zwischen Themse und Bordel also treibt der Unhold Dennis Orloff (Klaus Kinski) sein Unwesen. Orloff ist seines Zeichens Arzt und knabbert seit seiner frühesten Jugend an einem traumatischen Erlebnis mit einer Prostituierten. Die einzige Möglichkeit in dieser prätherapeutischen Epoche, mit dieser Seelenpein fertig zu werden, besteht logischer Weise darin, Frauen die Brüste abzuschneiden und sie fachferecht zu zerstückeln. Von diesem Recht macht Orloff auch reichlich gebrauch, bis sich die Schlinge Scotland Yards immer enger um seinen Hals zusammenzieht...
Durch diese psychologische Komponente, erhält Jack the Ripper tatsächlich eine gewiße Komplexität, zumahl Kinski die innere Qual Orloffs mimisch überzeugend darzustellen vermag.
Aber auch die anderen Schauspieler sind mehr als Staffage und geben diesem Werk immerhin den Anschein der seriösität. Aber auch wenn Jack the Ripper mit Kinski, Geraldine Chaplin Herbert Lux und Andreas Mannkopf einigermaßen prominent besetzt ist, kann er sich auf Grund des Inhaltes und doch sehr schematischen Handlungablaufes nicht aus dem Dunstkreis des Exploitationfilmes lossagen.
Da dieses aber durchaus seinen eigenen Charme, und Franco eine riesen Fangemeinde, zu denen auch Polanski und Tarantino zählen, besitzt, geht das durchaus in Ordnung. Mit Rückendeckung solch cinematographischer Ikonen muß man sich außerdem der Befriedigung niederer Instinkte weniger schämen.
Was uns von Jess Franco noch alles ins Haus steht, kann man in den beigefügten Trailern erahnen. Auch wird dann die Bildungslücke, was man denn bitteschön unter dem Subgenre des Frauenfolterfilms zu verstehen hat, ein für alle mal geschloßen sein.
Das Bild ist hervorragend restauriert und im beigefügten Interview plaudert Produzent und Franco Liebhaber Erwin C. Dietrich aus dem Nähkästchen und läßt den geneigten Zuschauer an den Mühen der Restauration und den geplanten Veröffentlichungen teilhaben.
Moralisten sollten sich schon mal warm anziehen....
mit 4
mit 4
mit 3
mit 3
bewertet am 08.01.14 um 11:12
Regisseur Neil Burger beweist 5 Jahre nach seinem athmosphärisch und visuell überzeugendem Historienkrimi "The Illusionist", daß es ihm auch am Gespür für zeitgemäße Großstadtthriller nicht mangelt.
In einem Erzählstil, der von treibenden elektronischen Beats gepuscht wird und sich durch eine selbstkommentierenden Stimme aus dem Off kennzeichnet, (Fightclub läßt grüßen) wird die Geschichte des erfolglosen Schriftstellers und Underdogs Eddie Morras (Bradley Cooper) geschildert, der nach dem Konsum einer neuen Superdroge zu Karrieresprüngen schwindelerregenden Ausmaßen ansetzt.
Unter dem Einfluß dieser Droge ist es dem Menschen möglich, auf nahezu 100% seiner Gehirnleistung, anstatt der normalen 20%, zurückzugreifen. Im Dauerfeuer seiner 100 Mrd. maximal beschleunigten Gehirnzellen purzelt der einstige Herumtreiber so über Nacht die soziale Leiter fast bis auf die letzten Sprossen empor. Ganz frei nach dem Credo Only the sky is the limit.
Aber wo Licht ist, gibts bekanntlich auch Schatten.
So währt Eddies ungebremster Höhenflug denn auch keine Ewigkeit. Der Dauerkonsum fordert, wen wunderts, nach einiger Zeit seinen Tribut: Eddie beginnt schon bald unter optischen Täuschungen und massiven Gedächtnislücken zu leiden. Mit diesen unerwarteten Komplikationen konfrontiert, beschließt er zügig, den Drogenkonsum zu drosseln, um seine geistige Gesundheit zu erhalten. Bei diesem Versuch wird ihm aber nicht nur schnell klar, daß er ohne sein Drogen Alter Ego auf dem gesellschaftlichem Parkett auf dem er mittlerweile tanzt, keine Minute überstehen kann, sondern es droht dem Wunderkind noch eine noch viel dramatischere Konsequenz: Ein abruptes Absetzen der Droge bedeutet nämlich unvermeintlich den langsamen und qualvollen Tod.
Wie also soll Eddie auf dem dünnen Eis der Hochfinanz weiter existieren, wenn der (gefundene) Drogenvorrat allmählich zu Neige geht und zwielichtige Typen, die einem so beiläufig mit der kalten Schneide den Körper von der Seele trennen wie sie Guten Tag sagen, mit allen Mitteln versuchen, an die begehrten Pillen zu kommen .....?
Storytechnisch entfernt sich Ohne Limit nicht weit von der alten Geschichte um Faust und seinen mephistolischen Pakt: eine gescheiterte Existenz wendet sich in völliger Verzweiflung an höhere Mächte, um sich vor dem eigenen Untergang zu retten. Diese Mächte führen den Protagonisten an die Sonnenseiten des Lebens, umgarnen sie mit Frauen, Geld und allen erdenklichen Sinnesfreuden, bevor sie erst zaghaft, dann aber unerbittlich den ausgehandelten Tribut einforden: die Seele.
So gesehen bereichert Ohne Limit die Geschichte des Dramas nur um eine neue Variation des alten Themas und wäre nicht weiter erwähnenswert. Was den Film aber auszeichnet, ist seine visuelle Umsetzung, die den Zuschauer schon in der Eröffnungsszene unweigerlich in seinen Sog zieht. Virtuose Kamerafahrten, interessante Charaktere und eine kühl ästhetische Bildsprache, in der die Großstadt mal als Goße, mal als Spielwiese für Global Player in Scene gesetzt wird, bilden den Hintergrund für Eddies komentenhaften Aufstieg. Durch optische Spielereien, mit teils psychedelisch anmutenden Sequenzen, soll die im wahsten Sinne des Wortes "grenzenlose" Wahnehmung für den Zuschauer versinnbildlicht werden. Auch wenn dies meist dem reinen Selbstzweck dient, wissen diese Mätzchen durchaus zu gefallen, zumahl diese in einer Handlung eingebettet sind, die progressiv nach vorne beschleunigt und den Zuschauer auf den Ausgang hinfiebern läßt.
Unter diesem Aspekt ist es dann auch etwas schade, daß das hohe Tempo vom Beginn des Filmes nicht bis zum Ende durchgehalten werden und das so gegebene Versprechen nicht eingelöst werden kann. Ab Mitte des Filmes hat sich der Aufstieg Eddies verlangsamt und das Halten des Status Quo bringt naturgemäß weniger Dynamik auf die Leinwand als seine Verwandlung. Dennoch verfügt auch die zweite Hälfte des Filmes über ausreichend Bindungskräfte, zumahl jetzt auch Robert De Niro die Bühne des Geschehens betritt und mit seiner Präsenz als Finanzkonzernkapitän, den Film noch einmal aufwertet und den gemäßigten (jedoch keinesfalls ermüdenden) Filmfluß locker wieder wettmacht.
Wenn sich auch der Regisseur eindeutig der Handschrift David Finchers Fight Club bedient, so muß man ihm attestieren, daß er sich die besten Elemente abgekupfert und ihre Wirkungsweisen genau studiert hat. Die rückblickend erzählte Geschichte, die Ehrlichkeit, die Härte und der virtuose visuelle Stil bannen auch hier den Zuschauer in seinen Bann. Das Ohne Limit den direkten Vergleich gegen Fightclub dennoch verliert, liegt vor allem daran, daß letzterer doch noch kompromißloser zu Werke geht und seine Geschichte mit mehreren Finessen gespickt ist als Ohne Limit.
Wäre das Ende von "Ohne Limit" denn auch weniger salopp, sondern etwas logischer und damit befriedigender geraten, bräuchte man sich auch nicht scheuen, den Film als "Fight Club"s kleinen Bruder zu bezeichnen.
In einem Erzählstil, der von treibenden elektronischen Beats gepuscht wird und sich durch eine selbstkommentierenden Stimme aus dem Off kennzeichnet, (Fightclub läßt grüßen) wird die Geschichte des erfolglosen Schriftstellers und Underdogs Eddie Morras (Bradley Cooper) geschildert, der nach dem Konsum einer neuen Superdroge zu Karrieresprüngen schwindelerregenden Ausmaßen ansetzt.
Unter dem Einfluß dieser Droge ist es dem Menschen möglich, auf nahezu 100% seiner Gehirnleistung, anstatt der normalen 20%, zurückzugreifen. Im Dauerfeuer seiner 100 Mrd. maximal beschleunigten Gehirnzellen purzelt der einstige Herumtreiber so über Nacht die soziale Leiter fast bis auf die letzten Sprossen empor. Ganz frei nach dem Credo Only the sky is the limit.
Aber wo Licht ist, gibts bekanntlich auch Schatten.
So währt Eddies ungebremster Höhenflug denn auch keine Ewigkeit. Der Dauerkonsum fordert, wen wunderts, nach einiger Zeit seinen Tribut: Eddie beginnt schon bald unter optischen Täuschungen und massiven Gedächtnislücken zu leiden. Mit diesen unerwarteten Komplikationen konfrontiert, beschließt er zügig, den Drogenkonsum zu drosseln, um seine geistige Gesundheit zu erhalten. Bei diesem Versuch wird ihm aber nicht nur schnell klar, daß er ohne sein Drogen Alter Ego auf dem gesellschaftlichem Parkett auf dem er mittlerweile tanzt, keine Minute überstehen kann, sondern es droht dem Wunderkind noch eine noch viel dramatischere Konsequenz: Ein abruptes Absetzen der Droge bedeutet nämlich unvermeintlich den langsamen und qualvollen Tod.
Wie also soll Eddie auf dem dünnen Eis der Hochfinanz weiter existieren, wenn der (gefundene) Drogenvorrat allmählich zu Neige geht und zwielichtige Typen, die einem so beiläufig mit der kalten Schneide den Körper von der Seele trennen wie sie Guten Tag sagen, mit allen Mitteln versuchen, an die begehrten Pillen zu kommen .....?
Storytechnisch entfernt sich Ohne Limit nicht weit von der alten Geschichte um Faust und seinen mephistolischen Pakt: eine gescheiterte Existenz wendet sich in völliger Verzweiflung an höhere Mächte, um sich vor dem eigenen Untergang zu retten. Diese Mächte führen den Protagonisten an die Sonnenseiten des Lebens, umgarnen sie mit Frauen, Geld und allen erdenklichen Sinnesfreuden, bevor sie erst zaghaft, dann aber unerbittlich den ausgehandelten Tribut einforden: die Seele.
So gesehen bereichert Ohne Limit die Geschichte des Dramas nur um eine neue Variation des alten Themas und wäre nicht weiter erwähnenswert. Was den Film aber auszeichnet, ist seine visuelle Umsetzung, die den Zuschauer schon in der Eröffnungsszene unweigerlich in seinen Sog zieht. Virtuose Kamerafahrten, interessante Charaktere und eine kühl ästhetische Bildsprache, in der die Großstadt mal als Goße, mal als Spielwiese für Global Player in Scene gesetzt wird, bilden den Hintergrund für Eddies komentenhaften Aufstieg. Durch optische Spielereien, mit teils psychedelisch anmutenden Sequenzen, soll die im wahsten Sinne des Wortes "grenzenlose" Wahnehmung für den Zuschauer versinnbildlicht werden. Auch wenn dies meist dem reinen Selbstzweck dient, wissen diese Mätzchen durchaus zu gefallen, zumahl diese in einer Handlung eingebettet sind, die progressiv nach vorne beschleunigt und den Zuschauer auf den Ausgang hinfiebern läßt.
Unter diesem Aspekt ist es dann auch etwas schade, daß das hohe Tempo vom Beginn des Filmes nicht bis zum Ende durchgehalten werden und das so gegebene Versprechen nicht eingelöst werden kann. Ab Mitte des Filmes hat sich der Aufstieg Eddies verlangsamt und das Halten des Status Quo bringt naturgemäß weniger Dynamik auf die Leinwand als seine Verwandlung. Dennoch verfügt auch die zweite Hälfte des Filmes über ausreichend Bindungskräfte, zumahl jetzt auch Robert De Niro die Bühne des Geschehens betritt und mit seiner Präsenz als Finanzkonzernkapitän, den Film noch einmal aufwertet und den gemäßigten (jedoch keinesfalls ermüdenden) Filmfluß locker wieder wettmacht.
Wenn sich auch der Regisseur eindeutig der Handschrift David Finchers Fight Club bedient, so muß man ihm attestieren, daß er sich die besten Elemente abgekupfert und ihre Wirkungsweisen genau studiert hat. Die rückblickend erzählte Geschichte, die Ehrlichkeit, die Härte und der virtuose visuelle Stil bannen auch hier den Zuschauer in seinen Bann. Das Ohne Limit den direkten Vergleich gegen Fightclub dennoch verliert, liegt vor allem daran, daß letzterer doch noch kompromißloser zu Werke geht und seine Geschichte mit mehreren Finessen gespickt ist als Ohne Limit.
Wäre das Ende von "Ohne Limit" denn auch weniger salopp, sondern etwas logischer und damit befriedigender geraten, bräuchte man sich auch nicht scheuen, den Film als "Fight Club"s kleinen Bruder zu bezeichnen.
mit 4
mit 5
mit 4
mit 2
bewertet am 08.01.14 um 11:06
3,5 Punkte für den gelungenen Familienfilm und 'nen halben obendrauf für die zahlreichen 3D Effekte.
Monster und Aliens beschreibt die Schlacht der irdischen Freaks gegen außerirdische Invasoren. Die Monster sind dabei entweder aus fehlgeschlagenen Experimenten hervorgegangen oder aus dem ewigen Eis aufgetaut worden. Nur Susan ist auf ihrer Hochzeitfeier von einem verstrahlten Meteoriten getroffen worden und zur 12 Meter Amazone mutiert.
Nach ihrem "Unfall" wird Susan umgehend vom Militär eingefangen und in eine geheime Bunkeranlage, tief unter der Wüste Arizonas, gesperrt. Hier lernt sie all die anderen Monster kennen, die ebenfalls in Gefangenschaft gehalten werden, aber zum Glück ein lustiges Miteinander pflegen.
Als eines schönen Tages allerdings plötzlich ein Ufo am Firnament auftaucht und die Außerirdischen der Erdbevölkerung umgehend klar machen, daß sie nicht zum Frisbeespielen die Reise durchs Universum zur Erde angetreten haben, sondern um die Menschheit zu vernichten um sich selbst dort anzusiedeln, ist's mit der Gemütlichkeit für die Monster abrupt vorbei. Da das Militär gegen die Kampfroboter der Invasoren nichts auszurichte imstande ist, werden die letzten Hoffnungen an die ungewöhnlichen Fähigkeiten der Exoten geknüpft und die lustige Schar wird aus ihrem Käfig gelassen um in der Schlacht für die Zukunft der Menschen zu kämpfen...
Monster und Aliens besticht dabei durch eine Inszenierung, die in ihrem progressiven Tempo und der hohen Humorfrequenz bis zum fulminanten Finale niemals nachläßt. Dadurch ergibt sich ein konstant hoher Unterhaltungswert, der glücklicher Weise zu keinem Zeitpunkt infantilen Gags oder moralinsauren, geschweige denn pathetischen Anspielungen weichen muß.
Da der Humor, trotz aller Virtuosität recht brav und harmlos, eben kindgerecht bleibt, und da sich die Animationskünste aus heutiger Sicht über weite Strecken auf niedrigem (jedoch keineswegs billig wirkendem) Niveau bewegen, bleibt ein Punkt schön bei Vati.
Monster und Aliens beschreibt die Schlacht der irdischen Freaks gegen außerirdische Invasoren. Die Monster sind dabei entweder aus fehlgeschlagenen Experimenten hervorgegangen oder aus dem ewigen Eis aufgetaut worden. Nur Susan ist auf ihrer Hochzeitfeier von einem verstrahlten Meteoriten getroffen worden und zur 12 Meter Amazone mutiert.
Nach ihrem "Unfall" wird Susan umgehend vom Militär eingefangen und in eine geheime Bunkeranlage, tief unter der Wüste Arizonas, gesperrt. Hier lernt sie all die anderen Monster kennen, die ebenfalls in Gefangenschaft gehalten werden, aber zum Glück ein lustiges Miteinander pflegen.
Als eines schönen Tages allerdings plötzlich ein Ufo am Firnament auftaucht und die Außerirdischen der Erdbevölkerung umgehend klar machen, daß sie nicht zum Frisbeespielen die Reise durchs Universum zur Erde angetreten haben, sondern um die Menschheit zu vernichten um sich selbst dort anzusiedeln, ist's mit der Gemütlichkeit für die Monster abrupt vorbei. Da das Militär gegen die Kampfroboter der Invasoren nichts auszurichte imstande ist, werden die letzten Hoffnungen an die ungewöhnlichen Fähigkeiten der Exoten geknüpft und die lustige Schar wird aus ihrem Käfig gelassen um in der Schlacht für die Zukunft der Menschen zu kämpfen...
Monster und Aliens besticht dabei durch eine Inszenierung, die in ihrem progressiven Tempo und der hohen Humorfrequenz bis zum fulminanten Finale niemals nachläßt. Dadurch ergibt sich ein konstant hoher Unterhaltungswert, der glücklicher Weise zu keinem Zeitpunkt infantilen Gags oder moralinsauren, geschweige denn pathetischen Anspielungen weichen muß.
Da der Humor, trotz aller Virtuosität recht brav und harmlos, eben kindgerecht bleibt, und da sich die Animationskünste aus heutiger Sicht über weite Strecken auf niedrigem (jedoch keineswegs billig wirkendem) Niveau bewegen, bleibt ein Punkt schön bei Vati.
mit 4
mit 5
mit 4
mit 3
bewertet am 02.01.14 um 22:08
Schwungvolles Stelldichein altgedienter Horrorrecken aus der Zeit des klassischen Hollywoodskinos, die hier auf ihre alten Tage nochmal von ihrer "privaten" Seite zu sehen sind.
Frankenstein, Der Wolfsmensch, Die Mumie, der Unsichtbare und eine ganze weitere Horde Exoten aus dem Gruselkabinett der Filmgeschichte finden sich in Graf Draculas Hotel Transilvanien ein, um dort die Volljährigkeit seiner gerade 118 gewordenen Tochter, Mavis, zu feiern. Das Hotel Transilvanien wurde vom Grafen als Trutzburg gegen die Menschen errichtet und mit einer Menge Zauberfallen und Hexenzinober vor den Menschen, die in des Grafen Vergangenheit eine tragische Rolle gespielt haben, versteckt.
Natürlich kommt es wie es kommen muß, und ein junger Globetrotter, Jonathan, stolpert in die Vorbereitungen zur Geburtstagsgala. Um ein Skandal zu verhindern, wird Jonathan umgeschminkt und der Gästeschar fortan als Urgroßenkel von Frankensteins rechtem Arm präsentiert.
Zwischen Mavis und Jonathan funkt es selbstverständlich schon bei der ersten Begegnung und im Rest des Filmes geht es letztendlich nur noch darum, wie die zwei Seelen zueinander finden. Das es bei dem Versuch Draculas, die Tochter von Jonathan fernzuhalten und den Monstern seine wahre Identität zu verbergen äußerst turbulent zugeht und erst viele Vorurteile abgebaut und Hindernisse überwunden werden müßen, liegt in der Natur der Sache und liefert die Steilvorlage für schräge Situationskomik.
So ist es wohl auch nicht verwunderlich, daß das Zielpublikum für Hotel Transilvanien in erster Linie heranwachsende Jugendliche sein dürften, die sich ebenfalls in Ihrem Freiheitsdrang von ihren Eltern blockiert sehen dürften und mit Mavis und Jonathans Kampf um Freiheit und Selbstbestimmung eifrig mitfiebern können.
Allerdings verrät schon die FSK 6 untrügerisch, daß es trotz aller Schauergestalten und Albtraumhaften Wesen, niemals richtig gruselig, geschweige denn böse wird und der Humor sich in seichteren Gefilden bewegt.
Trotz dieser Einschränkungen, ist der Film auch für Erwachsene sehenswert. Das liegt zum einen daran, daß er niemals auf Kleinkindniveau mit alberne Blödelleien abrutscht, sondern auch mit einem für das adoleszente Publikum tragfähigen Humor ausgestattet ist, der diese Zielgruppe das ein oder andere mal zum ausgiebigen Gebrauch seiner Lachmuskulatur nötigt. Zum anderen aber eben auch an den vielen liebevollen Hommages und Parodien der Gruselmonster, die dem jügeren Publikum wohl höchstens noch vom hörensagen bekannt sein dürften.
Auch trägt das Necken der beiden Teenager, welches man durchaus als ausgewogen bezeichnen kann, da es sich doch insgesamt frei von Kitsch und alterstypisch präsentiert, zum nachhaltig runden Gesamteindruck bei.
Da es an 2 bis 3 Stellen dann doch auch mal etwas makaberer wird, schimmert aber eben durch, welches Potential vorhanden ist und welche Steigerung des Humors in erwachsengerechterer Unterhaltung noch möglich gewesen wäre. Auf Grund dieser vertanen Chance gibts einen Punkt Abzug.
Trotzdem ist Hotel Transilvanien ein Animationsfilm, der vorbildlich demonstriert, wie man einen Feelgood Movie auf unterhaltsame Weise inszenieren kann, ohne metertief im moralinsaurem Schleim zu ersticken. Sehenswert!
Frankenstein, Der Wolfsmensch, Die Mumie, der Unsichtbare und eine ganze weitere Horde Exoten aus dem Gruselkabinett der Filmgeschichte finden sich in Graf Draculas Hotel Transilvanien ein, um dort die Volljährigkeit seiner gerade 118 gewordenen Tochter, Mavis, zu feiern. Das Hotel Transilvanien wurde vom Grafen als Trutzburg gegen die Menschen errichtet und mit einer Menge Zauberfallen und Hexenzinober vor den Menschen, die in des Grafen Vergangenheit eine tragische Rolle gespielt haben, versteckt.
Natürlich kommt es wie es kommen muß, und ein junger Globetrotter, Jonathan, stolpert in die Vorbereitungen zur Geburtstagsgala. Um ein Skandal zu verhindern, wird Jonathan umgeschminkt und der Gästeschar fortan als Urgroßenkel von Frankensteins rechtem Arm präsentiert.
Zwischen Mavis und Jonathan funkt es selbstverständlich schon bei der ersten Begegnung und im Rest des Filmes geht es letztendlich nur noch darum, wie die zwei Seelen zueinander finden. Das es bei dem Versuch Draculas, die Tochter von Jonathan fernzuhalten und den Monstern seine wahre Identität zu verbergen äußerst turbulent zugeht und erst viele Vorurteile abgebaut und Hindernisse überwunden werden müßen, liegt in der Natur der Sache und liefert die Steilvorlage für schräge Situationskomik.
So ist es wohl auch nicht verwunderlich, daß das Zielpublikum für Hotel Transilvanien in erster Linie heranwachsende Jugendliche sein dürften, die sich ebenfalls in Ihrem Freiheitsdrang von ihren Eltern blockiert sehen dürften und mit Mavis und Jonathans Kampf um Freiheit und Selbstbestimmung eifrig mitfiebern können.
Allerdings verrät schon die FSK 6 untrügerisch, daß es trotz aller Schauergestalten und Albtraumhaften Wesen, niemals richtig gruselig, geschweige denn böse wird und der Humor sich in seichteren Gefilden bewegt.
Trotz dieser Einschränkungen, ist der Film auch für Erwachsene sehenswert. Das liegt zum einen daran, daß er niemals auf Kleinkindniveau mit alberne Blödelleien abrutscht, sondern auch mit einem für das adoleszente Publikum tragfähigen Humor ausgestattet ist, der diese Zielgruppe das ein oder andere mal zum ausgiebigen Gebrauch seiner Lachmuskulatur nötigt. Zum anderen aber eben auch an den vielen liebevollen Hommages und Parodien der Gruselmonster, die dem jügeren Publikum wohl höchstens noch vom hörensagen bekannt sein dürften.
Auch trägt das Necken der beiden Teenager, welches man durchaus als ausgewogen bezeichnen kann, da es sich doch insgesamt frei von Kitsch und alterstypisch präsentiert, zum nachhaltig runden Gesamteindruck bei.
Da es an 2 bis 3 Stellen dann doch auch mal etwas makaberer wird, schimmert aber eben durch, welches Potential vorhanden ist und welche Steigerung des Humors in erwachsengerechterer Unterhaltung noch möglich gewesen wäre. Auf Grund dieser vertanen Chance gibts einen Punkt Abzug.
Trotzdem ist Hotel Transilvanien ein Animationsfilm, der vorbildlich demonstriert, wie man einen Feelgood Movie auf unterhaltsame Weise inszenieren kann, ohne metertief im moralinsaurem Schleim zu ersticken. Sehenswert!
mit 4
mit 5
mit 5
mit 2
bewertet am 31.12.13 um 11:31
Üppig ausgestatte Westernoper, die doch deutlich mehr Tiefgang und Substanz hat, als die teils vernichtenden Kritiken vermuten laßen.
San Francisco Anfang des 20. Jahrhunderts: Ein kleiner Junge schlendert über eine Kirmes an der San Francisco Bay. Im Hintergrund befindet sich die Golden Gate Bridge noch im Bau und das Hafenviertel ist nur wenig mehr als eine Ansammlung von ärmlichen Hütten. Der Junge betritt ein Westernpanorama und begafft mit einer Tüte Popcorn in der Hand die ausgestopften Westernexponate. Als er sich einen alten, faltigen Indianerhäuptling zuwendet, erwacht dieser zum Leben und beginnt dem erstaunten Knirps die Geschichte seines Lebens zu erzählen: Die Geschichte vom Indianer Tonto und dem Staatsanwalt John Reid der auf der Jagd nach dem Erzbösewicht Cavendish zum Lone Ranger wird.
Die Geschichte beginnt einige Jahrzehnte vor der Kirmes mit einer fulminanten Befreiungsaktion Cavendishs aus einem Gefängniswaggon der Eisenbahn. Der ebenfalls mitinhaftierte Tonto kann im Laufe eines wilden Gefechtes Cavendish zwar wieder bändigen, wird aber im letzten Moment vom Staatsanwalt Reid, der keine Selbstjustiz duldet, an der Exekution des Fieslings gehindert. Die Befreiung Cavendishs endet mit einer spektakulären Zugentgleisung, die Tonto und Reid nur mit äußerstem Dusel in einer atemberaubend in Scene gesetzten Zerstörungsorgie überleben.
Reids Bruder, seines Zeichens Ranger, macht sich nach der Flucht Cavendishs mit seinen Gefolgsleuten und John unmittelbar auf den Weg, Cavendish wieder dingfest zu machen. Dabei tappen sie jedoch in einen Hinterhalt, den nur John Reid schwerverletzt überlebt. Als dieser mit allem möglichen Indianerbrimborium wieder aufgepeppelt wird, steckt er sich den Rangerstern seines toten Bruders an die Brust und zieht fortan gemeinsam mit Tonto als Lone Ranger seine Wege.
Was nun folgt, ist eine für Disney und Verbinski ungewöhnt düstere, komplexe und zum teil überraschend harte Geschichte um den Eisenbahnbau im Westen Amerikas, die Ausrottung der Indianer, den Raubbau an ihrem Reichtum und über den Erzkapitalismus der (einiger) Gründungsväter Amerikas, die mit dem Mythos, daß es in Gods Own Country ein jeder mit ehrlicher harter Arbeit zu Wohlstand und Glück bringen kann, Schluß machen.
Nach der exorbitanten Eröffnungssequenz tritt dann der Lone Ranger jedoch erst einmal heftig auf das Bremspedal, was das Tempo des Filmes anbelangt. Es wird sich nun ausgiebig Zeit genommen, die relevanten Charaktere des Plots behutsam einzuführen und eine Geschichte um Rache, Gier und Verrat zu entspinnen. Die abruppte Drosselung des Tempos verstört den verwöhnten Zuschauer zunächst ein wenig, da er es doch hier mit einer Bruckheimer/Verbinski Produktion zu tun hat, und sich daher im Popcornuniversum wähnt. So sehr das nicht wieder einsetzende Effektgewitter auch den einen Zuschauer auf Grund enttäuschter Erwartungshaltung wundert und verstört, so sehr genießt der andere jetzt das verlaßen der actionüberladenen Oberflächlichkeit. Das liegt zum einen an der üppig ausgestatteten Westernwelt, die mehr fürs Auge zu bieten hat als manch ein überkandidelter MTV Videoclip, zum anderen aber eben auch an der Handlung, die durch interessante Wendungen und nichtlinearer Erzählstruktur ebenso zu überzeugen vermag, wie die von Dreck und Hitze geschundenen Seelen, die diese archaische Welt bevölkern. Die Detailverliebtheit erinnert dabei stark an Leones Westerklassiker "Spiel mir das Lied vom Tod", dem auch in einigen Sequenzen überdeutlich Referenz erwiesen wird.
Das es bei all dem Blut und Greuel jedoch nie zu ernst wird, ist allen voran Johnny Depp als Tonto zu verdanken. Immer wieder schafft Depp es, mit seiner fast traumwandlerischen Präsenz, die Kohlen aus dem Feuer zu ziehen und durch seinen lakonischen Humor, dem ganzen Geschehen einen Stempel aufzudrücken, der für gute Laune und Unterhaltung sorgt, so daß sich der Freund der leichten Muse niemals ängstigen muß, gegen seinen Willen in ein ernst gemeintes Filmwerk mit Arthausanspruch geraten zu sein.
Dabei bleibt festzuhalten, daß sich Depp hier schon deutlicher von seiner tuntigen Attitüde, die noch allzugut aus dem Fluch der Karibik in Erinnerung ist, distanziert, als es zuletzt in Dark Shadows der Fall gewesen ist. Er gibt sich zwar auch hier leicht schusselig, macht sich aber zu keinem Zeitpunkt zur Witzfigur oder sich gar des Slappsticks verdächtig. Vermutlich wollte man die Fans von Jack Sparrow nicht allzu sehr vor den Kopf stoßen aber auch gleichzeitig nicht zuviel Öl ins Feuer des historisch belasteten Verhältnisses der Amerikaner zu ihren Ureinwohnern gießen. Daraus läßt sich Depps Spagat zwischen Komödie und "ernsthafter" Mime wohl am besten erklären und man kann ihm attestieren, daß sein lavieren zwischen diesen verschiedenen Spielarten des Schauspiels nicht nur gelungen ist, sondern sogar trefflich unterhält.
Dazu trägt sicherlich auch die Wahl des Lone Rangers, Armie Hammer, bei, der zwar durchaus befriedigend agiert, neben Depp aber doch etwas blaß wirkt und ihn dadurch noch mehr herausragen läßt. Neben den zuvor für die Rolle des Rangers Reid vorgesehenen Brad Pitt oder Ryan Gosling wäre dies für Depp sicherlich etwas anders ausgegangen.
Genau bei diesem Spagat setzen aber auch die meisten Kritiken an. Lone Ranger wird vorgeworfen, er wisse eigentlich nicht genau was er eigentlich sein will. Es sei ein Film, der auf der Suche nach seiner eigenen Identität ist.
Und diese Kritik ist berechtigt. Nicht nur, daß Lone Ranger die ersten 15 min. etwas verspricht, was er nur zum Ende hin wieder einhalten kann: Nämlich furiose Action.
Auch reißt er meines Erachtens zuviele Themenkomplexe in seinen 2,5 Std. Spielzeit an, als der Zuschauer bewältigen kann. Es werden unter dem Mantel der Unterhaltung zu viele Aspekte der amerikanischen Geschichte, wie z.b. der Landraub der Indianer durch die Weißen, angeschnitten. Solche Themen hätten sicherlich in seperater, ausführlicherer und vor allem in einer seriöseren Athmosphäre zur Geltung kommen müßen.
Ist Lone Ranger nun ein Buddy Movie, eine Rachegeschichte, eine Selbsfindungsparabel, eine Kapitalismuskritik oder einfach nur eine Mär aus dem wilden Westen? Man weiß es nicht genau und fühlt sich nach dem Abspann des Filmes etwas hilflos und allein gelassen. Die Zerissenheit des Filmes, ob nun gewollt oder nicht, drückt Johnny Depp dabei mit seinem zwiespältigem Charakter fast stellvertretend für das gesamte Werk aus.
Doch trotz aller berechtigten Kritik, sollte man nicht außer acht laßen, daß der Lone Ranger, trotz einiger Längen und dem damit zwangsläufig einhergehenden Spannungsabfall im Mittelteil, vor allem ein außergewöhnlich unterhaltsamer Film ist, der alle Aspekte die das Westernenre so Groß gemacht haben, würdigt und mit viel Respekt vor der Tradition zelebriert. Ob es nun die übergroßen Panoramen des Monument Valleys, die schier endlosen Weiten des Westens, das kernige Rachedrama oder einfach nur die liebevoll gestalten Kulissen sind. All daß findet im Lone Ranger Ausdrucksformen, die sich nahe an der Grenze zur filmischen Perfektion bewegen.
Bleibt so zu hoffen, daß der Film im Laufe der Zeit eine Neubewertung und entsprechende Reputation erfährt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist ihm auf Grund seiner Oppulenz und des etwas sperrigen, unorthodoxen Themenkonglomerats auf jeden Fall jetzt schon beschieden...
San Francisco Anfang des 20. Jahrhunderts: Ein kleiner Junge schlendert über eine Kirmes an der San Francisco Bay. Im Hintergrund befindet sich die Golden Gate Bridge noch im Bau und das Hafenviertel ist nur wenig mehr als eine Ansammlung von ärmlichen Hütten. Der Junge betritt ein Westernpanorama und begafft mit einer Tüte Popcorn in der Hand die ausgestopften Westernexponate. Als er sich einen alten, faltigen Indianerhäuptling zuwendet, erwacht dieser zum Leben und beginnt dem erstaunten Knirps die Geschichte seines Lebens zu erzählen: Die Geschichte vom Indianer Tonto und dem Staatsanwalt John Reid der auf der Jagd nach dem Erzbösewicht Cavendish zum Lone Ranger wird.
Die Geschichte beginnt einige Jahrzehnte vor der Kirmes mit einer fulminanten Befreiungsaktion Cavendishs aus einem Gefängniswaggon der Eisenbahn. Der ebenfalls mitinhaftierte Tonto kann im Laufe eines wilden Gefechtes Cavendish zwar wieder bändigen, wird aber im letzten Moment vom Staatsanwalt Reid, der keine Selbstjustiz duldet, an der Exekution des Fieslings gehindert. Die Befreiung Cavendishs endet mit einer spektakulären Zugentgleisung, die Tonto und Reid nur mit äußerstem Dusel in einer atemberaubend in Scene gesetzten Zerstörungsorgie überleben.
Reids Bruder, seines Zeichens Ranger, macht sich nach der Flucht Cavendishs mit seinen Gefolgsleuten und John unmittelbar auf den Weg, Cavendish wieder dingfest zu machen. Dabei tappen sie jedoch in einen Hinterhalt, den nur John Reid schwerverletzt überlebt. Als dieser mit allem möglichen Indianerbrimborium wieder aufgepeppelt wird, steckt er sich den Rangerstern seines toten Bruders an die Brust und zieht fortan gemeinsam mit Tonto als Lone Ranger seine Wege.
Was nun folgt, ist eine für Disney und Verbinski ungewöhnt düstere, komplexe und zum teil überraschend harte Geschichte um den Eisenbahnbau im Westen Amerikas, die Ausrottung der Indianer, den Raubbau an ihrem Reichtum und über den Erzkapitalismus der (einiger) Gründungsväter Amerikas, die mit dem Mythos, daß es in Gods Own Country ein jeder mit ehrlicher harter Arbeit zu Wohlstand und Glück bringen kann, Schluß machen.
Nach der exorbitanten Eröffnungssequenz tritt dann der Lone Ranger jedoch erst einmal heftig auf das Bremspedal, was das Tempo des Filmes anbelangt. Es wird sich nun ausgiebig Zeit genommen, die relevanten Charaktere des Plots behutsam einzuführen und eine Geschichte um Rache, Gier und Verrat zu entspinnen. Die abruppte Drosselung des Tempos verstört den verwöhnten Zuschauer zunächst ein wenig, da er es doch hier mit einer Bruckheimer/Verbinski Produktion zu tun hat, und sich daher im Popcornuniversum wähnt. So sehr das nicht wieder einsetzende Effektgewitter auch den einen Zuschauer auf Grund enttäuschter Erwartungshaltung wundert und verstört, so sehr genießt der andere jetzt das verlaßen der actionüberladenen Oberflächlichkeit. Das liegt zum einen an der üppig ausgestatteten Westernwelt, die mehr fürs Auge zu bieten hat als manch ein überkandidelter MTV Videoclip, zum anderen aber eben auch an der Handlung, die durch interessante Wendungen und nichtlinearer Erzählstruktur ebenso zu überzeugen vermag, wie die von Dreck und Hitze geschundenen Seelen, die diese archaische Welt bevölkern. Die Detailverliebtheit erinnert dabei stark an Leones Westerklassiker "Spiel mir das Lied vom Tod", dem auch in einigen Sequenzen überdeutlich Referenz erwiesen wird.
Das es bei all dem Blut und Greuel jedoch nie zu ernst wird, ist allen voran Johnny Depp als Tonto zu verdanken. Immer wieder schafft Depp es, mit seiner fast traumwandlerischen Präsenz, die Kohlen aus dem Feuer zu ziehen und durch seinen lakonischen Humor, dem ganzen Geschehen einen Stempel aufzudrücken, der für gute Laune und Unterhaltung sorgt, so daß sich der Freund der leichten Muse niemals ängstigen muß, gegen seinen Willen in ein ernst gemeintes Filmwerk mit Arthausanspruch geraten zu sein.
Dabei bleibt festzuhalten, daß sich Depp hier schon deutlicher von seiner tuntigen Attitüde, die noch allzugut aus dem Fluch der Karibik in Erinnerung ist, distanziert, als es zuletzt in Dark Shadows der Fall gewesen ist. Er gibt sich zwar auch hier leicht schusselig, macht sich aber zu keinem Zeitpunkt zur Witzfigur oder sich gar des Slappsticks verdächtig. Vermutlich wollte man die Fans von Jack Sparrow nicht allzu sehr vor den Kopf stoßen aber auch gleichzeitig nicht zuviel Öl ins Feuer des historisch belasteten Verhältnisses der Amerikaner zu ihren Ureinwohnern gießen. Daraus läßt sich Depps Spagat zwischen Komödie und "ernsthafter" Mime wohl am besten erklären und man kann ihm attestieren, daß sein lavieren zwischen diesen verschiedenen Spielarten des Schauspiels nicht nur gelungen ist, sondern sogar trefflich unterhält.
Dazu trägt sicherlich auch die Wahl des Lone Rangers, Armie Hammer, bei, der zwar durchaus befriedigend agiert, neben Depp aber doch etwas blaß wirkt und ihn dadurch noch mehr herausragen läßt. Neben den zuvor für die Rolle des Rangers Reid vorgesehenen Brad Pitt oder Ryan Gosling wäre dies für Depp sicherlich etwas anders ausgegangen.
Genau bei diesem Spagat setzen aber auch die meisten Kritiken an. Lone Ranger wird vorgeworfen, er wisse eigentlich nicht genau was er eigentlich sein will. Es sei ein Film, der auf der Suche nach seiner eigenen Identität ist.
Und diese Kritik ist berechtigt. Nicht nur, daß Lone Ranger die ersten 15 min. etwas verspricht, was er nur zum Ende hin wieder einhalten kann: Nämlich furiose Action.
Auch reißt er meines Erachtens zuviele Themenkomplexe in seinen 2,5 Std. Spielzeit an, als der Zuschauer bewältigen kann. Es werden unter dem Mantel der Unterhaltung zu viele Aspekte der amerikanischen Geschichte, wie z.b. der Landraub der Indianer durch die Weißen, angeschnitten. Solche Themen hätten sicherlich in seperater, ausführlicherer und vor allem in einer seriöseren Athmosphäre zur Geltung kommen müßen.
Ist Lone Ranger nun ein Buddy Movie, eine Rachegeschichte, eine Selbsfindungsparabel, eine Kapitalismuskritik oder einfach nur eine Mär aus dem wilden Westen? Man weiß es nicht genau und fühlt sich nach dem Abspann des Filmes etwas hilflos und allein gelassen. Die Zerissenheit des Filmes, ob nun gewollt oder nicht, drückt Johnny Depp dabei mit seinem zwiespältigem Charakter fast stellvertretend für das gesamte Werk aus.
Doch trotz aller berechtigten Kritik, sollte man nicht außer acht laßen, daß der Lone Ranger, trotz einiger Längen und dem damit zwangsläufig einhergehenden Spannungsabfall im Mittelteil, vor allem ein außergewöhnlich unterhaltsamer Film ist, der alle Aspekte die das Westernenre so Groß gemacht haben, würdigt und mit viel Respekt vor der Tradition zelebriert. Ob es nun die übergroßen Panoramen des Monument Valleys, die schier endlosen Weiten des Westens, das kernige Rachedrama oder einfach nur die liebevoll gestalten Kulissen sind. All daß findet im Lone Ranger Ausdrucksformen, die sich nahe an der Grenze zur filmischen Perfektion bewegen.
Bleibt so zu hoffen, daß der Film im Laufe der Zeit eine Neubewertung und entsprechende Reputation erfährt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist ihm auf Grund seiner Oppulenz und des etwas sperrigen, unorthodoxen Themenkonglomerats auf jeden Fall jetzt schon beschieden...
mit 4
mit 5
mit 5
mit 3
bewertet am 26.12.13 um 11:00
Der ideale Film, um sentimentale Charakterregungen nachhaltig aus der eigenen Gefühlswelt zu verbannen.
Doch bevor es wieder ordentlich zur Sache geht, fängt Kick Ass 2 zuerst einmal dort an, wo der erste Teil aufhört: Dave (Kick Ass) wird von dem kindlich kichernden Mindy (Hit Girl), auf einem Schrottplatz, zur Abhärtung von Leib und Seele, mit einer Pistole über den Haufen geschoßen. Natürlich hat Dave eine kugelsichere Weste an und überlebt dabei.
Was humoristisch also zunächst wie ein müder Aufguß des ersten Teiles anmutet, bei dem auf den bewährten Strickmustern des Vorgängers herumgeritten wird, entpuppt sich jedoch glücklicher Weise schnell als eigenständiger Film, der dem ersten in Punkto Spaß und Brutalität in nichts nachsteht.
Mindy Wesenskern indessen hat sich nach dem Tod ihres Vaters (Big Daddy) kaum verändert. Unter der süßen Teeniefratze verbirgt sich noch immer der gewaltgeile Sprößling aus dem ersten Teil, der entgegen des strickten Verbotes ihres Vormundes, noch immer heimlich auf Verbrecherjagd geht.
Dave hingegen hat sich nach seinem letzten Auftritt als Kick Ass zur Ruhe gesetzt und führt das Leben eines durchschnittlichen Highschool Teenagers.
So richtig glücklich ist er mit dieser Form des vorgezogenen Vorruhestand jedoch nicht wirklich und beschließt daher, wieder Kontakt zum Hitgirl aufzunehmen. Des sinnentlerten zeitvertreibes überdrüssig, juckt es ihn wieder unter den Fingern, mit ihr die Stadt von kriminellen Subjekten zu säubern.
Kaum hat das Duo aber wieder losgelegt, ist's mit der Selbstjustiz auch im handumdrehen schon wieder vorbei. Mindys Vormund hat nämlich Wind von den heimlichen Aktivitäten bekommen und unterbindet die Unternehmungen seiner Schutzbefohlenen auf der Stelle: Mindy soll sich statt Hobbygangster auf den Friedhof zu knüppeln, in der Highschool gleichaltrige Freunde suchen und das Leben eines normalen Jugendlichen führen: sich schminken, über Freundinnen lästern und eine Boygroup anschmachten. So aufregend stellt sich der Vormund das Mindys neues Mindys vor.
Dave, derweil frustiert darüber wieder alleine kämpfen zu müßen, schließt sich umgehend einer Gruppe selbsternannter Superhelden an, die sich einst im Fahrwasser von Kick Ass an die Öffentlichkeit getraut haben. Unter dem Kommando des Collonels Stars and Stripes findet Dave eine Gruppe gleichgesinnter und fühlt sich wieder in seinem Element. Eine lose Beziehung zu einer Punkbraut aus dem Haufen sympathischer Loser, die nächtens als "Night Bitch" auf Patroulie geht, trägt ihr übriges zu seinem Wohlbefinden bei.
Das Feierabend Superhelden Team formt sich auch wirklich keinen Moment zu spät. Denn Red Mist aus dem ersten Teil ist wieder aktiv. Nachdem der Sohn des im Vorgängers von Kick Ass getöteten Bösewichtes versehentlich seine eigene Mutter im Solarium gegrillt hat, schlüpft er in den Latexanzug seiner Mutter und übt fortan als "Motherfucker" Rache an seinem Erzfeind. Dabei schart er mit seinem geerbten Vermögen eine ganze Horde verwegener Auftragskiller um sich, die ihm bei der Liquidierung von Kick Ass behilflich sein sollen.
Mindy derweil tut sich mit dem Leben als Musterteenie schwer, da sie dummerweise an die größten Schnepfen in der Schule geraten ist. Von diesen wird sie allerdings von Beginn an nur als amüsantes Spielzeug verstanden und als exotischer Zeitvertreib mißbraucht.
Während Mindy also die ersten Gehversuche als Modepüppchen unternimmt und Erfahrungen mit dem Charakter von Society Girls macht, zieht sich die Schlinge um den Hals von Kick Ass immer enger zusammen. Motherfucker ist nämlich gemeinsam mit "Mother Russia", einer unbarmherzigen Killermaschine, Dave mittlerweile ganz eng auf den Fersen. Mindy muß sich nun ganz schnell entscheiden: Wird sie zum Good American Girl oder folgt sie ihrer inneren Stimme und beschützt Dave...?
Kick Ass 2 begeht also glücklicherweise nicht wie zuerst befürchtet den Fehler vieler anderer Fortsetzungen, den Vorgänger einfach zu kopieren oder krampfhaft zu versuchen, der Geschichte neue Impulse zu geben und damit den Charakter des Filmes zu verwässern, sondern erfindet im Geist des Alten eine neue Variation dergleichen. Zwar sind seit dem ersten Teil 4 Jahre vergangen und unsere Protagonisten müßen sich mit anderen, alterspezifischen Problemen wie der lästigen Pubertät herumschlagen. Aber abgesehen von diesem neuen Kontext, bleibt sich Kick Ass in seinen Grundfesten treu und trotzt mit allen Mitteln der Politic Correctness. Dies zeigt sich vor allem in den ultrabrutalen Gewaltscenen die sich im starken Kontrast zu den sensiblen Teenagerseelen befinden, dem herrlich makaberen schwarzen Humor und den frühpubertären Anspielungen weit unter der Schamgrenze.
Auch wenn der Grundtenor also hier wieder eindeutig satirischer Natur ist und der Film im Grunde eine Menge Freude verbreitet, bleibt dem Zuschauer doch gerade wegen der auf die Spitze getriebenen Gewalt, manches Lachen böse im Halse stecken...
Doch bevor es wieder ordentlich zur Sache geht, fängt Kick Ass 2 zuerst einmal dort an, wo der erste Teil aufhört: Dave (Kick Ass) wird von dem kindlich kichernden Mindy (Hit Girl), auf einem Schrottplatz, zur Abhärtung von Leib und Seele, mit einer Pistole über den Haufen geschoßen. Natürlich hat Dave eine kugelsichere Weste an und überlebt dabei.
Was humoristisch also zunächst wie ein müder Aufguß des ersten Teiles anmutet, bei dem auf den bewährten Strickmustern des Vorgängers herumgeritten wird, entpuppt sich jedoch glücklicher Weise schnell als eigenständiger Film, der dem ersten in Punkto Spaß und Brutalität in nichts nachsteht.
Mindy Wesenskern indessen hat sich nach dem Tod ihres Vaters (Big Daddy) kaum verändert. Unter der süßen Teeniefratze verbirgt sich noch immer der gewaltgeile Sprößling aus dem ersten Teil, der entgegen des strickten Verbotes ihres Vormundes, noch immer heimlich auf Verbrecherjagd geht.
Dave hingegen hat sich nach seinem letzten Auftritt als Kick Ass zur Ruhe gesetzt und führt das Leben eines durchschnittlichen Highschool Teenagers.
So richtig glücklich ist er mit dieser Form des vorgezogenen Vorruhestand jedoch nicht wirklich und beschließt daher, wieder Kontakt zum Hitgirl aufzunehmen. Des sinnentlerten zeitvertreibes überdrüssig, juckt es ihn wieder unter den Fingern, mit ihr die Stadt von kriminellen Subjekten zu säubern.
Kaum hat das Duo aber wieder losgelegt, ist's mit der Selbstjustiz auch im handumdrehen schon wieder vorbei. Mindys Vormund hat nämlich Wind von den heimlichen Aktivitäten bekommen und unterbindet die Unternehmungen seiner Schutzbefohlenen auf der Stelle: Mindy soll sich statt Hobbygangster auf den Friedhof zu knüppeln, in der Highschool gleichaltrige Freunde suchen und das Leben eines normalen Jugendlichen führen: sich schminken, über Freundinnen lästern und eine Boygroup anschmachten. So aufregend stellt sich der Vormund das Mindys neues Mindys vor.
Dave, derweil frustiert darüber wieder alleine kämpfen zu müßen, schließt sich umgehend einer Gruppe selbsternannter Superhelden an, die sich einst im Fahrwasser von Kick Ass an die Öffentlichkeit getraut haben. Unter dem Kommando des Collonels Stars and Stripes findet Dave eine Gruppe gleichgesinnter und fühlt sich wieder in seinem Element. Eine lose Beziehung zu einer Punkbraut aus dem Haufen sympathischer Loser, die nächtens als "Night Bitch" auf Patroulie geht, trägt ihr übriges zu seinem Wohlbefinden bei.
Das Feierabend Superhelden Team formt sich auch wirklich keinen Moment zu spät. Denn Red Mist aus dem ersten Teil ist wieder aktiv. Nachdem der Sohn des im Vorgängers von Kick Ass getöteten Bösewichtes versehentlich seine eigene Mutter im Solarium gegrillt hat, schlüpft er in den Latexanzug seiner Mutter und übt fortan als "Motherfucker" Rache an seinem Erzfeind. Dabei schart er mit seinem geerbten Vermögen eine ganze Horde verwegener Auftragskiller um sich, die ihm bei der Liquidierung von Kick Ass behilflich sein sollen.
Mindy derweil tut sich mit dem Leben als Musterteenie schwer, da sie dummerweise an die größten Schnepfen in der Schule geraten ist. Von diesen wird sie allerdings von Beginn an nur als amüsantes Spielzeug verstanden und als exotischer Zeitvertreib mißbraucht.
Während Mindy also die ersten Gehversuche als Modepüppchen unternimmt und Erfahrungen mit dem Charakter von Society Girls macht, zieht sich die Schlinge um den Hals von Kick Ass immer enger zusammen. Motherfucker ist nämlich gemeinsam mit "Mother Russia", einer unbarmherzigen Killermaschine, Dave mittlerweile ganz eng auf den Fersen. Mindy muß sich nun ganz schnell entscheiden: Wird sie zum Good American Girl oder folgt sie ihrer inneren Stimme und beschützt Dave...?
Kick Ass 2 begeht also glücklicherweise nicht wie zuerst befürchtet den Fehler vieler anderer Fortsetzungen, den Vorgänger einfach zu kopieren oder krampfhaft zu versuchen, der Geschichte neue Impulse zu geben und damit den Charakter des Filmes zu verwässern, sondern erfindet im Geist des Alten eine neue Variation dergleichen. Zwar sind seit dem ersten Teil 4 Jahre vergangen und unsere Protagonisten müßen sich mit anderen, alterspezifischen Problemen wie der lästigen Pubertät herumschlagen. Aber abgesehen von diesem neuen Kontext, bleibt sich Kick Ass in seinen Grundfesten treu und trotzt mit allen Mitteln der Politic Correctness. Dies zeigt sich vor allem in den ultrabrutalen Gewaltscenen die sich im starken Kontrast zu den sensiblen Teenagerseelen befinden, dem herrlich makaberen schwarzen Humor und den frühpubertären Anspielungen weit unter der Schamgrenze.
Auch wenn der Grundtenor also hier wieder eindeutig satirischer Natur ist und der Film im Grunde eine Menge Freude verbreitet, bleibt dem Zuschauer doch gerade wegen der auf die Spitze getriebenen Gewalt, manches Lachen böse im Halse stecken...
mit 4
mit 5
mit 3
mit 3
bewertet am 23.12.13 um 23:20
Der Mann mit der Todeskralle verläßt sein geliebtes Baumhaus und begibt sich auf die Reise nach Fernost, um dort an den Wunden seiner Vergangenheit zu lecken und ein paar verwöhnte Sushi Gören zu beschützen.
Im zweiten Weltkrieg rettete Wolverine einst beim Atombombenabwurf auf Nagasaki dem Japanischem Offizier Yashida das Leben.
60 Jahre später hat Wolverine vom eitlen Treiben der Menschen und Mutanten die Schnauze gestrichen voll und streift gemeinsam mit Gevatter Bär durch die Wälder Nordamerikas, immer auf der Suche nach einem Eimer frischem Honig.
In einem nahegelegenem Bergdorf wird er von der jungen Yukido, einer Adoptivtochter Yashidas aufgespürt, als er gerade einer Horde ungehobelten Wilderern das Handwerk legen will. Yashida liege im sterben, sagt sie zu ihm, und er habe den Wunsch, seinen einstigen Lebensretter noch einmal sehen, bevor er das Zeitliche segne.
Der Hartnäckigkeit Yukido ist es also zu verdanken, daß sich Wolverine schließlich breitschlagen läßt, Pause von seinem Trapperleben zu machen und wieder Tuchfühlung mit der Zivilisation aufzunehmen.
In Tokio angekommen, offenbart Yashida, mittlerweile der reichste Japaner des Landes, Wolverine, daß er ihm die Sterblichkeit im Tausch gegen seine Unverwundbarkeitsgene anbieten könne. Wolverine lehnt jedoch dankend ab und bereitet sich für seine Rückreise vor. Als er am nächsten Morgen aufwacht ist Yashida bereits verschieden und Wolverine bleibt aus Pietätsgründen schließlich bis zu seinem Begräbniss.
Hier fangen die Dinge auf einmal an außer Kontrolle zu geraten: Die leibliche Enkelin Yashidas, Mariko, gerät auf einmal ins Visier der Yakuzza und entgeht einem Mordanschlag bei der Beerdigung nur dadurch knapp, da sie von Wolverine in einer atemberaubenden Verfolgungsjagd, u.a. auf dem Dach eines Hochgeschwindigkeitzuges, gerettet werden kann. Dabei in letzter Sekunde dem Tod von der Schippe gesprungen, macht Wolverine eine höchst verstörende Entdeckung: Seine Wunden heilen nicht mehr, wie bisher, wie von Zauberhand. Stattdessen trieft Blut in Strömen aus seinen klaffenden Wunden. Irgendetwas muß also bei dem Besuch Yashidas mit ihm passiert sein, was sein Autoimmunsystem in Brei verwandelt hat. Leise beginnt ihm zu dämmern, daß die Reise ins Land der aufgehenden Sonne sein Untergang bedeuten könnte.
Er beginnt sich Gedanken zu machen welche Rolle die undurchsichtige Ärztin Yashidas und welche sein Sohn Shingen, der Vater Marikos, der seine Tochter schlägt, bei dem Geschehen spielen? Und hat auch der schmierige Justizminister, der versprochene Ehemann Harikas, seine verdarbten Hände mit im Spiel? Welche Funktion kommt dem Ninjaclan Haradas zu, der seit Generationen die Yashidafamilie beschützt? Dieses und noch viel mehr herauszufinden, ist nun die Aufgabe von Wolverine und seiner Schutzbefohlenen Mariko.
Regisseur Mangold hat sich keine leichte Aufgabe zu eigen gemacht, Wolverine aus seinem natürlichen Habitat in das exotische Japan zu verlagern, wo er sich frei vom X-Men Balast neu erfinden und feinere Schichten seiner Seele offenlegen kann. Und man muß leider feststellen, daß er sich dabei verhoben hat. Das tritt vor allem in den permanent eingestreuten Traumsequenzen und Visionen, in denen ihn seine große Liebe Jean Grey immer wieder aufsucht, zu Tage. Grey, auch einst ein X-Men, wurde von Wolverine getötet, nachdem sie ihre unfaßbaren Kräfte nicht mehr unter Kontrolle hatte und sie gesamte X-Men Sippschaft auszurotten drohte.
In seinen Träumen bittet sie Wolverine jedoch immer wieder, endlich zu ihr, ins Reich des Todes zu kommen, da sie sich nach ihm verzehre. Seine Unsterblichkeit macht den Wunsch jedoch unerfüllbar, worunter Wolverine Höllenqualen erleidet.
So ambitioniert Mangold auch zu Werke geht, den Charakter des Wolverines aus der zweidimensionalität der Comicvorlage zu befreien und ihn mit einem hyperaktiven Unterbewußtsein ins Reich der Normalsterblichen einzugliedern, so überflüßig ist dieses Unterfangen auch. Mangold ist dabei aber ein kleiner und unbedeutender Schönheitsfehler unterlaufen: Wolverines herumdoktern mit seiner Posttraumatische Belastungstörung kümmert nämlich im Grunde genommen keine Sau. Eh schon eine der bestbeleuchteten Charaktere des X-Men Universums, hat Wolverine dank der ausgefeilten Drehbücher der Vorgänger und der begnadeten Regisseure wie Bryan Singer und Matthew Vaughn schon so viel Profil und komplexität erhalten, daß es als eigenständiges Geschöpf neben real existierenden Personen bestehen kann. Dabei ist die zentrale Charaktereigenschaft, die Rolle des Wolfes im Schafspelz, Hugh Jackman auf den Leib geschneidert und sollte immer im Mittelpunkt der Erzählung stehen. Wenn Jackman das Tier im Manne rausläßt, ist er voll und ganz in seinem Element und bringt den bestialischen Aspekt seiner Persönlichkeit zur zerstörerischen Entfaltung. Das Jackman in diesen Momenten zu Wolverin WIRD und nicht nur spielt, ist auch genau das, was seine Rolle so einzigartig macht und was die Zuschauer sehen wollen.
Jetzt auf seine Psüchowehwehchen einzugehen, entkräftet den Charakter nur und nimmt ihm ein ganzes Stück von seiner animalischen Präsenz. So ist Mangold bei der Menschwerdung Wolverines also ein gutes Stück über das Ziel hinausgeschoßen und hat der Rolle mit der vermeintlichen Komplexisierung seines Seelenlebens eher geschadet als genutzt. Die Charakterzeichnung war mit X-Men Origins bereits vollends gelungen und somit eigentlich auch abgeschloßen. Eine weitere Differenzierung war demnach nicht mehr nötig.
Aber nicht nur bei der Ausgestaltung der Personalien geht Mangold neue Wege, auch mit dem japanischen Set überrascht er die Zuschauer. Mag die Intention des Regisseures auch gewesen sein, Wolverine aus seinem X-Men Kontext herauszulösen und den Mutanten vor neue Herausforderungen zu stellen, so mag man Mangold attestieren, daß das Vorhaben zwar löblich aber letztendlich doch überflüßig ist. Denn außer einer Aneinanderreihung von Japanklischees, bei denen es immer wieder um Ehre, Schwertkämpfe und die Verbundenheit mit der Tradition geht, kann dem Zuschauer eigentlich nichts Neues angeboten werden. Dabei ist es natürlich eine Geschmackssache, ob man nun Schwertkämpfe mag oder eben nicht. Ich persönlich finde halt ellenlange Degenduelle mit ständigen Rotationen um die eigene Achse, einer wuseligen Gegnerschar, die in perfekter Choreographie vorne, neben, über, unter und hinter dem Hauptakteur in Stücke gelegt wird, ziemlich schnell ermüdend.
Die Variationsmöglichkeiten sind hier eben begrenzt und irgendwie meint man, das alles schon 100.000 mal irgendwo anders gesehen zu haben. Ein bißchen mehr Kawumm hätte hier und da den Film sicher aufgewertet, zumahl es auch die sonstigen, spärlich zugunsten der Charakterzeichnung eingestreuten Actionsequenzen, an Originalität vermißen lassen.
Zum einen wären da die Verfolgung auf dem Dach eines Hochgeschwindigkeitzuges und zum anderen der Endkampf. Beide können, obwohl fulminat in Scene gesetzt, nicht nachhaltig begeistern. Eine Verfolgungsjagd auf dem Dach eines Zuges ist natürlich im Grunde genommen kalter Kaffee und wurde erst neulich schon beim Lone Ranger bis zum Exzess ausgereizt. Außer dem ständigen wegducken und überspringen von Hochleitungskabeln und Werbeschildern, wird hier auch nicht allzuviel geboten und nutzt sich daher schnell ab. Hochspannungskino sollte sich eben nicht bloß auf die Stromkabel beschränken.
Bleibt also noch der finale Kampf zu bewerten. Aber auch hier läuft der Film nicht zu Höchstform auf. Letztendlich geht es auch dort wiedereinmal nur um ein banales Degengefecht, wenn auch mit technischen Mitteln aufgeplustert. Das hat man aber im Laufe des Filmes aber mittlerweile so oft gesehen, daß sich das ständige herumreiten auf japanischen Samuraitraditionen schon bis auf die Knochen abgenutzt hat. Natürlich laufen hier auch alle Fäden zusammen und der Zuschauer erfährt auch die Ganze Wahrheit, die sich hinter Yashida und seinen Recken verbirgt. Aber das ist selbstverständlich auch das mindeste, was man Verlangen kann.
So bleibt unterm Strich festzuhalten, daß die ambitionierte Charakterentwicklung im Kern überflüßig ist und sich an der strikten Fixierung auf japanische Sitten und Traditionen todläuft. Mangold wäre in diesem Fall mit der alten Binsenweisheit "Schuster, bleib bei deinen Leisten" sicherlich besser beraten gewesen, hätte sich an X-Men Origins orientiert und Wolverine einen ebenbürtigen Widersacher zur Seite gestellt.
So enttäuschend dieses Spin Off aber auch ist, muß man fairerweise sagen, daß Wolverine: Der Weg des Kriegers, kein totaler Rohkrepierer ist. Die schauspielerische Leistung befindet sich auf durchweg hohem Niveau und Jackman macht mit seiner Präsenz vieles wieder wett. Der Unterhaltungsfaktor liegt auf durchschnittlichem Niveau und langt allemal, dem trüben Alltag für 2 Std. Ade zu sagen.
Nur sollten Wolverine, ebenso wie übrigens James Bond, leuchtende Ikonen der Filmwelt bleiben, und nicht auf menschliches Normalmaß runterpsychologisiert werden. Das ist der Helden Tod!!!
Im zweiten Weltkrieg rettete Wolverine einst beim Atombombenabwurf auf Nagasaki dem Japanischem Offizier Yashida das Leben.
60 Jahre später hat Wolverine vom eitlen Treiben der Menschen und Mutanten die Schnauze gestrichen voll und streift gemeinsam mit Gevatter Bär durch die Wälder Nordamerikas, immer auf der Suche nach einem Eimer frischem Honig.
In einem nahegelegenem Bergdorf wird er von der jungen Yukido, einer Adoptivtochter Yashidas aufgespürt, als er gerade einer Horde ungehobelten Wilderern das Handwerk legen will. Yashida liege im sterben, sagt sie zu ihm, und er habe den Wunsch, seinen einstigen Lebensretter noch einmal sehen, bevor er das Zeitliche segne.
Der Hartnäckigkeit Yukido ist es also zu verdanken, daß sich Wolverine schließlich breitschlagen läßt, Pause von seinem Trapperleben zu machen und wieder Tuchfühlung mit der Zivilisation aufzunehmen.
In Tokio angekommen, offenbart Yashida, mittlerweile der reichste Japaner des Landes, Wolverine, daß er ihm die Sterblichkeit im Tausch gegen seine Unverwundbarkeitsgene anbieten könne. Wolverine lehnt jedoch dankend ab und bereitet sich für seine Rückreise vor. Als er am nächsten Morgen aufwacht ist Yashida bereits verschieden und Wolverine bleibt aus Pietätsgründen schließlich bis zu seinem Begräbniss.
Hier fangen die Dinge auf einmal an außer Kontrolle zu geraten: Die leibliche Enkelin Yashidas, Mariko, gerät auf einmal ins Visier der Yakuzza und entgeht einem Mordanschlag bei der Beerdigung nur dadurch knapp, da sie von Wolverine in einer atemberaubenden Verfolgungsjagd, u.a. auf dem Dach eines Hochgeschwindigkeitzuges, gerettet werden kann. Dabei in letzter Sekunde dem Tod von der Schippe gesprungen, macht Wolverine eine höchst verstörende Entdeckung: Seine Wunden heilen nicht mehr, wie bisher, wie von Zauberhand. Stattdessen trieft Blut in Strömen aus seinen klaffenden Wunden. Irgendetwas muß also bei dem Besuch Yashidas mit ihm passiert sein, was sein Autoimmunsystem in Brei verwandelt hat. Leise beginnt ihm zu dämmern, daß die Reise ins Land der aufgehenden Sonne sein Untergang bedeuten könnte.
Er beginnt sich Gedanken zu machen welche Rolle die undurchsichtige Ärztin Yashidas und welche sein Sohn Shingen, der Vater Marikos, der seine Tochter schlägt, bei dem Geschehen spielen? Und hat auch der schmierige Justizminister, der versprochene Ehemann Harikas, seine verdarbten Hände mit im Spiel? Welche Funktion kommt dem Ninjaclan Haradas zu, der seit Generationen die Yashidafamilie beschützt? Dieses und noch viel mehr herauszufinden, ist nun die Aufgabe von Wolverine und seiner Schutzbefohlenen Mariko.
Regisseur Mangold hat sich keine leichte Aufgabe zu eigen gemacht, Wolverine aus seinem natürlichen Habitat in das exotische Japan zu verlagern, wo er sich frei vom X-Men Balast neu erfinden und feinere Schichten seiner Seele offenlegen kann. Und man muß leider feststellen, daß er sich dabei verhoben hat. Das tritt vor allem in den permanent eingestreuten Traumsequenzen und Visionen, in denen ihn seine große Liebe Jean Grey immer wieder aufsucht, zu Tage. Grey, auch einst ein X-Men, wurde von Wolverine getötet, nachdem sie ihre unfaßbaren Kräfte nicht mehr unter Kontrolle hatte und sie gesamte X-Men Sippschaft auszurotten drohte.
In seinen Träumen bittet sie Wolverine jedoch immer wieder, endlich zu ihr, ins Reich des Todes zu kommen, da sie sich nach ihm verzehre. Seine Unsterblichkeit macht den Wunsch jedoch unerfüllbar, worunter Wolverine Höllenqualen erleidet.
So ambitioniert Mangold auch zu Werke geht, den Charakter des Wolverines aus der zweidimensionalität der Comicvorlage zu befreien und ihn mit einem hyperaktiven Unterbewußtsein ins Reich der Normalsterblichen einzugliedern, so überflüßig ist dieses Unterfangen auch. Mangold ist dabei aber ein kleiner und unbedeutender Schönheitsfehler unterlaufen: Wolverines herumdoktern mit seiner Posttraumatische Belastungstörung kümmert nämlich im Grunde genommen keine Sau. Eh schon eine der bestbeleuchteten Charaktere des X-Men Universums, hat Wolverine dank der ausgefeilten Drehbücher der Vorgänger und der begnadeten Regisseure wie Bryan Singer und Matthew Vaughn schon so viel Profil und komplexität erhalten, daß es als eigenständiges Geschöpf neben real existierenden Personen bestehen kann. Dabei ist die zentrale Charaktereigenschaft, die Rolle des Wolfes im Schafspelz, Hugh Jackman auf den Leib geschneidert und sollte immer im Mittelpunkt der Erzählung stehen. Wenn Jackman das Tier im Manne rausläßt, ist er voll und ganz in seinem Element und bringt den bestialischen Aspekt seiner Persönlichkeit zur zerstörerischen Entfaltung. Das Jackman in diesen Momenten zu Wolverin WIRD und nicht nur spielt, ist auch genau das, was seine Rolle so einzigartig macht und was die Zuschauer sehen wollen.
Jetzt auf seine Psüchowehwehchen einzugehen, entkräftet den Charakter nur und nimmt ihm ein ganzes Stück von seiner animalischen Präsenz. So ist Mangold bei der Menschwerdung Wolverines also ein gutes Stück über das Ziel hinausgeschoßen und hat der Rolle mit der vermeintlichen Komplexisierung seines Seelenlebens eher geschadet als genutzt. Die Charakterzeichnung war mit X-Men Origins bereits vollends gelungen und somit eigentlich auch abgeschloßen. Eine weitere Differenzierung war demnach nicht mehr nötig.
Aber nicht nur bei der Ausgestaltung der Personalien geht Mangold neue Wege, auch mit dem japanischen Set überrascht er die Zuschauer. Mag die Intention des Regisseures auch gewesen sein, Wolverine aus seinem X-Men Kontext herauszulösen und den Mutanten vor neue Herausforderungen zu stellen, so mag man Mangold attestieren, daß das Vorhaben zwar löblich aber letztendlich doch überflüßig ist. Denn außer einer Aneinanderreihung von Japanklischees, bei denen es immer wieder um Ehre, Schwertkämpfe und die Verbundenheit mit der Tradition geht, kann dem Zuschauer eigentlich nichts Neues angeboten werden. Dabei ist es natürlich eine Geschmackssache, ob man nun Schwertkämpfe mag oder eben nicht. Ich persönlich finde halt ellenlange Degenduelle mit ständigen Rotationen um die eigene Achse, einer wuseligen Gegnerschar, die in perfekter Choreographie vorne, neben, über, unter und hinter dem Hauptakteur in Stücke gelegt wird, ziemlich schnell ermüdend.
Die Variationsmöglichkeiten sind hier eben begrenzt und irgendwie meint man, das alles schon 100.000 mal irgendwo anders gesehen zu haben. Ein bißchen mehr Kawumm hätte hier und da den Film sicher aufgewertet, zumahl es auch die sonstigen, spärlich zugunsten der Charakterzeichnung eingestreuten Actionsequenzen, an Originalität vermißen lassen.
Zum einen wären da die Verfolgung auf dem Dach eines Hochgeschwindigkeitzuges und zum anderen der Endkampf. Beide können, obwohl fulminat in Scene gesetzt, nicht nachhaltig begeistern. Eine Verfolgungsjagd auf dem Dach eines Zuges ist natürlich im Grunde genommen kalter Kaffee und wurde erst neulich schon beim Lone Ranger bis zum Exzess ausgereizt. Außer dem ständigen wegducken und überspringen von Hochleitungskabeln und Werbeschildern, wird hier auch nicht allzuviel geboten und nutzt sich daher schnell ab. Hochspannungskino sollte sich eben nicht bloß auf die Stromkabel beschränken.
Bleibt also noch der finale Kampf zu bewerten. Aber auch hier läuft der Film nicht zu Höchstform auf. Letztendlich geht es auch dort wiedereinmal nur um ein banales Degengefecht, wenn auch mit technischen Mitteln aufgeplustert. Das hat man aber im Laufe des Filmes aber mittlerweile so oft gesehen, daß sich das ständige herumreiten auf japanischen Samuraitraditionen schon bis auf die Knochen abgenutzt hat. Natürlich laufen hier auch alle Fäden zusammen und der Zuschauer erfährt auch die Ganze Wahrheit, die sich hinter Yashida und seinen Recken verbirgt. Aber das ist selbstverständlich auch das mindeste, was man Verlangen kann.
So bleibt unterm Strich festzuhalten, daß die ambitionierte Charakterentwicklung im Kern überflüßig ist und sich an der strikten Fixierung auf japanische Sitten und Traditionen todläuft. Mangold wäre in diesem Fall mit der alten Binsenweisheit "Schuster, bleib bei deinen Leisten" sicherlich besser beraten gewesen, hätte sich an X-Men Origins orientiert und Wolverine einen ebenbürtigen Widersacher zur Seite gestellt.
So enttäuschend dieses Spin Off aber auch ist, muß man fairerweise sagen, daß Wolverine: Der Weg des Kriegers, kein totaler Rohkrepierer ist. Die schauspielerische Leistung befindet sich auf durchweg hohem Niveau und Jackman macht mit seiner Präsenz vieles wieder wett. Der Unterhaltungsfaktor liegt auf durchschnittlichem Niveau und langt allemal, dem trüben Alltag für 2 Std. Ade zu sagen.
Nur sollten Wolverine, ebenso wie übrigens James Bond, leuchtende Ikonen der Filmwelt bleiben, und nicht auf menschliches Normalmaß runterpsychologisiert werden. Das ist der Helden Tod!!!
mit 3
mit 4
mit 4
mit 4
bewertet am 23.12.13 um 18:44
Danny Boyle (Trainspotting) liefert mit Trance einen verzwickten Psychokrimi ab, der mit seiner kompromißlosen Inszenierung nahtlos an die Tradition moderner englischer Gangsterfilme anknüpft.
Sicherheitsmann Simon arbeitet in einem Auktionshaus. Oberste Prämisse bei einem Diebstahl in diesem Unternehmen ist: Nicht den Helden spielen. Kein Kunstwerk ist das Leben eines Menschen wert.
Als es eines Tages der Ganove Frank mit seinen Kumpanen auf das 25.000.000 Pfund schwere Meisterwerk "Fliegende Hexen" des spanischen Künstlers Goya abgesehen haben, geht mit Simon dennoch der Gaul durch und er versucht das Bild zu evakuieren. Kurz bevor er es jedoch in einer Tasche verpackt in den rettenden Tresor legen kann, wird er von Frank gestellt. Im Zuge der Bildübergabe mit dem Gangster kommt es zu einem Handgemenge, bei dem Simon mit einem Gewehrkolben so schwer am Kopf getroffen wird, daß er das Bewußtsein verliert.
Als er im Krankenhaus wieder zu sich kommt, leidet er unter Amnesie. Er kann sich weder daran erinnern, warum er den Helden spielen und das Bild retten wollte, noch wo sich das Bild momentan befindet. Denn zur Überraschung der Gangster wurde das Bild von Simon aus dem Rahmen entfernt, bevor es zur Übergabe kam. Das ist umso erstaunlicher, da sich schnell herausstellt, daß Simon mit Frank und seinen Gaunerkumpanen befreundet ist und sich kooperativ an der Entwendung des Bildes beteiligen wollte.
So vor einem großen Dilemma stehend, einigt man sich darauf, Simons Gedächtnis mittels Hypnose anzuzapfen, um sich so Zugang zu den Informationen, die sich tief im Gedächtnis des Sicherheitsmannes vergraben haben, zu verschaffen. Im Zuge dessen wählt sich Simon die bildhübsche Psychologin Theresa als die Therapeutin seines Vertrauens aus.
Je tiefer Simon jedoch in den Hypnosesitzungen in sein Unterbewußtsein dringt, desto komplexer und rätselhafter gestaltet sich die Situation. Realität verschwimmt mit Wunsch, Wunsch mitTraum und Traum mit Trauma. Im Zuge der Behandlung wird die Therapeutin zu allem Überfluß auch noch zur heimlichen Liebe Simons, die sich schließlich bis zur Obsession steigert. Dies verkompliziert das ohnehin schon angespannte Verhältniss in der Gruppe noch zusätzlich, zumahl sich auch Frank für die attraktive Frau zu interessieren beginnt. Und zu guter letzt scheint es dann auch noch eine böse Wahrheit in den tiefsten Windungen von Simon's Gehirn zu geben, die sich mit allen Mitteln der Erinnerung zu entziehen versucht, anscheinend aber der Schlüßel für all diese Ereignisse zu sein scheint...
Natürlich erfindet Boyle auch hier nicht das Rad neu. Psychofilme, in denen Realität und Suggestion Hand in Hand einhergehen um den Zuschauer auf eine falsche Fährte zu locken gibt es mit Sicherheit schon seit Adam und Eva. So handelt es sich auch hier lediglich um eine weitere Variation des des Bäumchen Wechsel Dich Spieles. In jeder Sitzung Simons kommen neue Details ans Licht, die der Handlung immer wieder in eine neue Richtung treiben, bzw. den Zuschauer an der Nase herumführen, indem sie ihn im unklaren lassen, ob die Handlung jetzt immer noch auf der Trance oder auf der Realitätsebene stattfindet. Auch werden die Anfangs klaren Rollenverteilungen, wer ist hier Täter und wer das Opfer, im Verlaufe der Geschichte immer vager und verschwimmen zum Schluß hin vollends, so daß dem Zuschauer allmählich der Boden unter den Füßen weggezogen wird, da er das Geschehen des Filmes bis zum klärenden Finale, intelektuell immer weniger einzuordnen vermag.
Neben diesem in sich verschlungenen Plot überzeugt Trance aber vor allem durch einen Handlungsverlauf, bei welchem das Vexierspiel mit Traum und Wirklichkeit, nicht etwa wie bei Inception, dem reinen Selbstzweck dient und sich damit an der Übertreibung der doppelten Boden Thematik bis in schwindelnde Höhen erlabt, oder sich etwa auf eine Ebene metaphysischer Pseudologik mit Esoterikanspruch begibt, sondern sich immer zweckdienlich an dem eigentlichen Kern der Geschichte, dem komplexen Kriminalfall, orientiert.
Das dabei am Ende nicht alle offene Fragen bis ins Detail befriedigend geklärt werden, zerstört den insgesamt guten Gesamteindruch nicht nachhaltig, hinterläßt jedoch einen kleinen Wermutstropfen, da man ohne weiteres den gesamten Coup zu einem schlüßigen Puzzle hätte zusammenfügen können ohne dabei die Logik aus den Augen zu verlieren.
Da sich Trance aber schauspielerisch und visuell auf einem ganz hohem Niveau bewegt , seien Boyle diese Abzüge in der B-Note, gerade bei einem durch seine kühle Ästhetik stilistisch so ausgereiften Streifen, dem es an pikanten und derben Scenen, ganz im Geiste des neuen britischen Gangsterfilmes, wahrlich nicht mangelt, gerne Verziehen.
Sicherheitsmann Simon arbeitet in einem Auktionshaus. Oberste Prämisse bei einem Diebstahl in diesem Unternehmen ist: Nicht den Helden spielen. Kein Kunstwerk ist das Leben eines Menschen wert.
Als es eines Tages der Ganove Frank mit seinen Kumpanen auf das 25.000.000 Pfund schwere Meisterwerk "Fliegende Hexen" des spanischen Künstlers Goya abgesehen haben, geht mit Simon dennoch der Gaul durch und er versucht das Bild zu evakuieren. Kurz bevor er es jedoch in einer Tasche verpackt in den rettenden Tresor legen kann, wird er von Frank gestellt. Im Zuge der Bildübergabe mit dem Gangster kommt es zu einem Handgemenge, bei dem Simon mit einem Gewehrkolben so schwer am Kopf getroffen wird, daß er das Bewußtsein verliert.
Als er im Krankenhaus wieder zu sich kommt, leidet er unter Amnesie. Er kann sich weder daran erinnern, warum er den Helden spielen und das Bild retten wollte, noch wo sich das Bild momentan befindet. Denn zur Überraschung der Gangster wurde das Bild von Simon aus dem Rahmen entfernt, bevor es zur Übergabe kam. Das ist umso erstaunlicher, da sich schnell herausstellt, daß Simon mit Frank und seinen Gaunerkumpanen befreundet ist und sich kooperativ an der Entwendung des Bildes beteiligen wollte.
So vor einem großen Dilemma stehend, einigt man sich darauf, Simons Gedächtnis mittels Hypnose anzuzapfen, um sich so Zugang zu den Informationen, die sich tief im Gedächtnis des Sicherheitsmannes vergraben haben, zu verschaffen. Im Zuge dessen wählt sich Simon die bildhübsche Psychologin Theresa als die Therapeutin seines Vertrauens aus.
Je tiefer Simon jedoch in den Hypnosesitzungen in sein Unterbewußtsein dringt, desto komplexer und rätselhafter gestaltet sich die Situation. Realität verschwimmt mit Wunsch, Wunsch mitTraum und Traum mit Trauma. Im Zuge der Behandlung wird die Therapeutin zu allem Überfluß auch noch zur heimlichen Liebe Simons, die sich schließlich bis zur Obsession steigert. Dies verkompliziert das ohnehin schon angespannte Verhältniss in der Gruppe noch zusätzlich, zumahl sich auch Frank für die attraktive Frau zu interessieren beginnt. Und zu guter letzt scheint es dann auch noch eine böse Wahrheit in den tiefsten Windungen von Simon's Gehirn zu geben, die sich mit allen Mitteln der Erinnerung zu entziehen versucht, anscheinend aber der Schlüßel für all diese Ereignisse zu sein scheint...
Natürlich erfindet Boyle auch hier nicht das Rad neu. Psychofilme, in denen Realität und Suggestion Hand in Hand einhergehen um den Zuschauer auf eine falsche Fährte zu locken gibt es mit Sicherheit schon seit Adam und Eva. So handelt es sich auch hier lediglich um eine weitere Variation des des Bäumchen Wechsel Dich Spieles. In jeder Sitzung Simons kommen neue Details ans Licht, die der Handlung immer wieder in eine neue Richtung treiben, bzw. den Zuschauer an der Nase herumführen, indem sie ihn im unklaren lassen, ob die Handlung jetzt immer noch auf der Trance oder auf der Realitätsebene stattfindet. Auch werden die Anfangs klaren Rollenverteilungen, wer ist hier Täter und wer das Opfer, im Verlaufe der Geschichte immer vager und verschwimmen zum Schluß hin vollends, so daß dem Zuschauer allmählich der Boden unter den Füßen weggezogen wird, da er das Geschehen des Filmes bis zum klärenden Finale, intelektuell immer weniger einzuordnen vermag.
Neben diesem in sich verschlungenen Plot überzeugt Trance aber vor allem durch einen Handlungsverlauf, bei welchem das Vexierspiel mit Traum und Wirklichkeit, nicht etwa wie bei Inception, dem reinen Selbstzweck dient und sich damit an der Übertreibung der doppelten Boden Thematik bis in schwindelnde Höhen erlabt, oder sich etwa auf eine Ebene metaphysischer Pseudologik mit Esoterikanspruch begibt, sondern sich immer zweckdienlich an dem eigentlichen Kern der Geschichte, dem komplexen Kriminalfall, orientiert.
Das dabei am Ende nicht alle offene Fragen bis ins Detail befriedigend geklärt werden, zerstört den insgesamt guten Gesamteindruch nicht nachhaltig, hinterläßt jedoch einen kleinen Wermutstropfen, da man ohne weiteres den gesamten Coup zu einem schlüßigen Puzzle hätte zusammenfügen können ohne dabei die Logik aus den Augen zu verlieren.
Da sich Trance aber schauspielerisch und visuell auf einem ganz hohem Niveau bewegt , seien Boyle diese Abzüge in der B-Note, gerade bei einem durch seine kühle Ästhetik stilistisch so ausgereiften Streifen, dem es an pikanten und derben Scenen, ganz im Geiste des neuen britischen Gangsterfilmes, wahrlich nicht mangelt, gerne Verziehen.
mit 4
mit 4
mit 3
mit 3
bewertet am 19.12.13 um 13:39
Akira Kurosawas 1985 inszeniertes Historienepos, bei dem der Zerfall einer japanischen Herrscherdynastie durch die Intrigen seiner machtberauschten Nachkommen geschildert wird, gehört mit Sicherheit zum inneren Canon der Filmkunst, unterhält den (westlichen?) Zuschauer zunächst aber nur bedingt.
Das liegt zum einen an der sperrigen Eröffnungsscene des Films, wo in statischer Theatermanier der alternde Fürst Hidetora Ichimonji sein Reich an seine 3 Söhne Taro, Jiro und Saburo verteilt. Hier wird gleich den hohen Erwartungen des Zuschauers, der sich auf Grund des außergewöhnlich guten Renommees des Filmes, auf ein überschwengliches Filmvergnügen gefreut hat, der Schwung genommen.
In dieser steifen, von traditionellen Umgangsformen geprägten Unterredung, kommen aber auch sogleich die unterschwellig vorhandenen Differenzen der Söhne ans Tageslicht. Während sich Taro und Jiro heuchlerisch dem Patriachen anbiedern, lehnt Saburo seinen Anteil ab, da er seine Brüder durchschaut und mit Klarsicht darlegt, wie sich seine Brüder über das Erbe in die Haare kriegen, und, sobald sie einen Teil des Reiches besitzen, den Fürst in Ungnade stoßen werden, um sich den Rest des Reiches einzuverleiben.
Doch davon will Hidetora überhaupt nichts wissen. Da er nur das Herrschen, nicht aber das Zuhören gewohnt ist, verbannt er den Querulanten Saburo mit seinem Diener Tango ins Exil und teilt sein Reich unter Taro und Jiro gleichermaßen auf.
Taro, jetzt Eigentümer des Herrscherhauses seines Vaters, nutzt allerdings, wie von Saburo vorhergesagt, die erstbeste Lapalie, um seinen Vater zu verstoßen. So enttäuscht über seinen Sohn, macht sich der Fürst mit seiner Leibwache auf den Weg zur Residenz seines zweiten Sohnes Jiro. Da dieser jedoch der Leibwache seines Vaters den Zugang verwährt, macht dieser sich auf eine weitere Reise und steuert das Schloß seines verstoßenen Sohnes Saburo an. Dieser hat sein Zuhause jedoch verlaßen und weilt nun in einer abgelegenen Burgruine. Als sich Hidetora in dem unbehausten Schloß niederlassen will, wird er von den Armeen Jiros und Taros angegriffen, die sich zu diesem Zweck verbündet haben. Bei dem Gefecht wird Hidetaros Leibwache vollkommen ausgelöscht. Er selbst kann sich jedoch im letzten Moment aus der brennenden Burg retten, büßt aber seinen Verstand ein, da das Leid der erlittenen Enttäuschungen einfach zuviel für ihn waren.
Bei dieser Schlacht läßt Jiro seinen Bruder Taro aber praktischer Weise gleich mit umbringen, um so das Reich in seiner Person zu vereinigen. Taros Frau Kaede jedoch, macht sich sofort an den neuen Herrscher ran. Und zwar so erfolgreich, daß dieser zustimmt, seine Nochfrau Sue töten zu lassen. Diese kann jedoch entkommen, da der mit dem Mord beauftragte General die Tat nicht mit seinem Ethos vereinbaren konnte.
In der Zwischenzeit hat der Verstoßene Bruder Saburo, immer noch gewillt, sich mit seinem Vater zu versöhnen, von den Untaten seiner Geschwister gehört und bildet eine Allianz aus ehemaligen Kriegsgegnern Hidetoras gegen Jiro.
Hidetaro, inzwischen vom verstoßenem Diener Tango aufgespürt, ist mittlerweile bei einem blinden Eremiten aufgenommen worden. Diesem ließ er einst im Streit die Augen ausstechen. Die einzigen Freuden des Einsiedlers sind nur noch sein Flötenspiel und sein Glaube an den Buddhismus, von dem er überzeugt ist, daß dieser das Schicksal des Menschen eines Tages zum Guten hinführen wird. Bei ihm findet sich später auch die geflohene Frau Jiros, Sue, ein.
Als währenddessen Jiro von der Mobilmachung Saburos Alianz in Kenntnis gerät, setzt er seine Armee ebenfalls in Alarmbereitschaft.
Vor der entscheidenden Schlacht kann zunächst ein Waffenstillstand ausgehandelt werden. Die so gewonnene Zeit möchte Saburo nutzen, um seinen Vater Hidetaro aufzuspüren. Diesen vermeintlich günstigen Zeitpunkt nutzt der Schurke Jiro jedoch, um die verfeindete Allianz anzugreifen. Jiros Armee ist jedoch der Kriegslist des Gegners nicht gewachsen und wird schnell dezimiert. Außerdem erfährt Jiro, daß mitlerweile eine weitere Armee der Allianz seine Residenz angreift.
Währenddessen hat die allein im Schloß weilende Kaede (die Frau Jiros) eine Truppe ausgesandt, um die geflohene (Ex) Frau Jiros, Sue, zu töten. Das Killerkommando macht nach einiger Suche auch die Hütte des Einsiedlers ausfindig, wo sich Hidaro und Sue aufhalten. Bei dieser Gelegenheit töten sie nicht nur Sue und Hidetaro, sondern auch Saburo, der kurz zuvor eingetroffen ist und sich wieder mit seinem Vater (der daraufhin wieder aus seiner geistigen Umnachtung erwacht ist) versöhnt hat.
Als der Genaral, der sich aus ethischen Erwägungen einst weigerte Sue zu töten, davon erfährt und ihm die Auftragsgeberin Kaete dazu noch erzählt, sie habe von Anfang an den Untergang der Dynastie des Hauses Ichimonji geplant, enthauptet der General Kaete umgehend. Sie war die Tochter eines Clanführers, dem Hidetora einst großes Leid zugefügt hat.
Im Kampf um die Residenz Jiros fällt schließlich auch der General und Jiro höchstpersönlich.
Am Ende dieses Massensterbens bleiben nur noch der Hofnarr Hidetoras und der blinde Eremit übrig. Der Hofnarr liegt jetzt klagend auf dem Boden des Schlachtfeldes, brüskiert sich über das Fehlen Gottes Gnaden auf Erden klagt und über den Wahnsinn der Menschen.
Der blinde Eremiten tastet sich mit seinem Stock an einem Abgrund entlang. Dabei fällt ihm eine buddhistische Schrift aus der Hand, die den Abhang hinunter rollt. Die Botschaften sind klar: Der Mensch wandelt stetig am Abgrund des Seins, er tapst sich vorsichtig und unbeholfen durchs Leben und hat dabei ständig den Tod vor Augen. Kein Buddha kann dem Menschen bei der Bewältigung seines Lebens und seiner Leiden helfen. So sehr sich der Mensch auch an die Schriften und an den Glauben klammert: Kein Gott bringt Erlösung, keine Religion Linderung. Religionen sind die hoffnungsvollen Hirngespinnste der Menschen, angesichts seiner Hilflosigkeit gegenüber dem Schicksal. Der Mensch in seinem Elend ist ganz auf sich allein gestellt. Es gibt keine Hilfe einer sich erbarmenden Instanz, so sehr er sich das auch wünschen mag...
Der Name des Filmes RAN, was übersetzt etwa soviel wie "Chaos" bedeutet, hätte für den Film nicht besser gewählt werden können. Denn wie sich schon unschwer aus der Beschreibung der Handlung ableiten läßt, wird hier alles andere als eine lineare Handlungsform propagiert. Ganz im Gegenteil wird der Film hier in seiner reinen Form als Metapher für das Leben als eine unentwirrbare Verflechtung von Psychologie, Schicksal und Gesellschaft geschildert, daß sich jeder Berechenbarkeit und Hoffnung auf Erlösung entzieht.
Die Erlösung, bzw. daß Wirken einer höheren Macht auf die sich der Mensch im Notfall berufen kann, war, wenn auch nur am Rande explizit erwähnt, sicherlich eines der Hauptanliegen Kurosawas und zieht sich bei genauerer Analyse wie ein roter Faden durch die Handlung. Der Mensch klammert sich in seiner Verzweiflung an höhere Mächte und bittet um ein korrigierendes Eingreifen Gottes in sein Schicksal. Aber wie sehr er auch bettelt und bittet, am Ende ist Hilfe durch göttlichen Beistand nur ein illusorisches, kindisches Wunschdenken, um die elementare Angst vor dem Chaos und dem Tod zu mildern. Wer der Wirklichkeit im Angesicht des Leidens auf der Welt ungeschminkt ins Auge schaut, muß feststellen, daß der Mensch in seinem Wirken ganz auf sich allein gestellt ist. Gott (Buddha) ist Tod.
Aber Ran läßt sich sicher nicht auf diesen nihilistischen Aspekt reduzieren. Auch spielt der immer wieder zitierte Verweis, bei RAN würde es sich um eine moderne Variante von Shakespeares King Lear handeln, eine entscheidene Rolle, da bei Shakespeare die Dramen vorzugsweise in den höheren Gesellschaftsschichten angesiedelt sind und die dortigen Intrigen und Schicksalsschläge ebenso zum persönlichen bzw. erweiterten Ruin beitragen, wie es bei RAN der Fall ist. Gleichermaßen läßt sich der Inszenierungsstil als Verbeugung vor dem Theater deuten. Die Scenen sind, wie auf der Bühne notwendig, wohlgeordnet durchchoreographiert und alle Personen haben ihren festen Platz. Die Weite des Raumes bleibt oft ungenutzt und ein organisches durcheinander wird hier nicht geduldet. Die strenge Anordnung und steife Kommunikationsform verweisen natürlich auch auf die Tyrannei jede Spontanität unterdrückender Vorschriften, japanischer Riten und Gebräuche. Auch sind sie eine Reminiszenz an die klassische Tragödie, in dessen Tradition sich der Film wissen will. Beide Aspekte stehen hier gleichberechtigt nebeneinander.
Die geordnete äußere Form steht dann auch im Kontrast zum Chaos der Lebensumstände. So sehr sich der Mensch auch um Normen und die Bewahrung von Tradition bemüht, letztendlich macht der Lauf des Schicksales alle Bemühungen um Kontrolle zunichte, wobei der Tod immer den ultimativen Kontrollverlust darstellt. Die befreiende und zerstörerische Macht des Chaos bricht dann in den epochalen Schlachtscenen auch ungezügelt hervor. In der Wut des Gefechtes, da wo das Leben unkontrolliert den Schutzschirm der Konventionen durchbricht, ist keine Beherrschung mehr möglich. Das gebändigte Tier im Menschen verläßt seinen Zwinger der Sozialisation und das Leben zeigt sein wahres Gesicht: Chaos. Instinkt. RAN.
Was bei Kurosawas Spätwerk sofort ins Auge sticht ist seine prägnante Bildsprache. Aus dieser läßt sich oft mehr ablesen als aus der reinen Handlung und ist zur Entschlüßelung dieses Kunstwerkes unerläßlich.
Auf der einen Seite ist RAN, speziell in den Dialogscenen, kühl und durcharrangiert wie ein japanisches Teehaus, in den Schlachtscenen hingegen bunt und überbordend wie das sprudelnde leben selbst. Sind die Dialogscenen noch von einer matten Farbgebung, die die Unterdrückung der Emotionen, entsprechende der japanischen Kultur, gekennzeichnet, so sind die Farben in den Schlachten ausufernd, und die Gesten der Krieger erinnern in ihrer übersteigerten Dramatik an das Ausdruckkino Sergej Eisensteins. Hier wären wohl allen voran Panzerkreuzer Potemkin und Oktober mit ihrem expressionistischen Exzessen zu nennen.
Durch die bildlich wertende Darstellung des Geschehens, enthält RAN auch eine sozialpolitische Komponente. Die von Funktionalität und Bräuchen durchsetzte japanische Gesellschaft wird hier zwar als praktikabel tolleriert, gleichzeitig wird sie als blaß, farb- und freudlos, statisch und tot dargestellt. Echtes Leben in seiner ganzen Farben- und Ausdruckspracht entfaltet sich erst, wenn, wie in den Kriegsscenen, alle hemmenden Konventionen abgestreift und die bloße, wenn auch animalische, aber freie Seele offengelegt werden kann.
Auf Grund der historischen, theologischen, sozialen, philosophischen Dichte und der stilistischen Besonderheiten, entfaltet der Film wohl erst nach ausgiebiger Betrachtung mehr und mehr von seiner Bedeutung. Nur wenn es dem Zuschauer gelingt, sich neben dem Gesehenen, dem Subtext der symbolschwangeren Bildsprache, der oft mehr zu entlocken ist als der reinen Handlung, zu öffnen, wird er die volle Tiefe dieses Werkes ermeßen können. Dies ist zwar nicht immer einfach und vieles bleibt wohl einer letzten Analyse verschloßen, wer jedoch die Mühen nicht scheut, dem Film mit Akribie auf den Zahn zu fühlen, stößt auf einen Inhaltlichen Reichtum, der selten ist in der Filmwelt und den geneigten Feierabendcineasten reichlich belohnt...
Das liegt zum einen an der sperrigen Eröffnungsscene des Films, wo in statischer Theatermanier der alternde Fürst Hidetora Ichimonji sein Reich an seine 3 Söhne Taro, Jiro und Saburo verteilt. Hier wird gleich den hohen Erwartungen des Zuschauers, der sich auf Grund des außergewöhnlich guten Renommees des Filmes, auf ein überschwengliches Filmvergnügen gefreut hat, der Schwung genommen.
In dieser steifen, von traditionellen Umgangsformen geprägten Unterredung, kommen aber auch sogleich die unterschwellig vorhandenen Differenzen der Söhne ans Tageslicht. Während sich Taro und Jiro heuchlerisch dem Patriachen anbiedern, lehnt Saburo seinen Anteil ab, da er seine Brüder durchschaut und mit Klarsicht darlegt, wie sich seine Brüder über das Erbe in die Haare kriegen, und, sobald sie einen Teil des Reiches besitzen, den Fürst in Ungnade stoßen werden, um sich den Rest des Reiches einzuverleiben.
Doch davon will Hidetora überhaupt nichts wissen. Da er nur das Herrschen, nicht aber das Zuhören gewohnt ist, verbannt er den Querulanten Saburo mit seinem Diener Tango ins Exil und teilt sein Reich unter Taro und Jiro gleichermaßen auf.
Taro, jetzt Eigentümer des Herrscherhauses seines Vaters, nutzt allerdings, wie von Saburo vorhergesagt, die erstbeste Lapalie, um seinen Vater zu verstoßen. So enttäuscht über seinen Sohn, macht sich der Fürst mit seiner Leibwache auf den Weg zur Residenz seines zweiten Sohnes Jiro. Da dieser jedoch der Leibwache seines Vaters den Zugang verwährt, macht dieser sich auf eine weitere Reise und steuert das Schloß seines verstoßenen Sohnes Saburo an. Dieser hat sein Zuhause jedoch verlaßen und weilt nun in einer abgelegenen Burgruine. Als sich Hidetora in dem unbehausten Schloß niederlassen will, wird er von den Armeen Jiros und Taros angegriffen, die sich zu diesem Zweck verbündet haben. Bei dem Gefecht wird Hidetaros Leibwache vollkommen ausgelöscht. Er selbst kann sich jedoch im letzten Moment aus der brennenden Burg retten, büßt aber seinen Verstand ein, da das Leid der erlittenen Enttäuschungen einfach zuviel für ihn waren.
Bei dieser Schlacht läßt Jiro seinen Bruder Taro aber praktischer Weise gleich mit umbringen, um so das Reich in seiner Person zu vereinigen. Taros Frau Kaede jedoch, macht sich sofort an den neuen Herrscher ran. Und zwar so erfolgreich, daß dieser zustimmt, seine Nochfrau Sue töten zu lassen. Diese kann jedoch entkommen, da der mit dem Mord beauftragte General die Tat nicht mit seinem Ethos vereinbaren konnte.
In der Zwischenzeit hat der Verstoßene Bruder Saburo, immer noch gewillt, sich mit seinem Vater zu versöhnen, von den Untaten seiner Geschwister gehört und bildet eine Allianz aus ehemaligen Kriegsgegnern Hidetoras gegen Jiro.
Hidetaro, inzwischen vom verstoßenem Diener Tango aufgespürt, ist mittlerweile bei einem blinden Eremiten aufgenommen worden. Diesem ließ er einst im Streit die Augen ausstechen. Die einzigen Freuden des Einsiedlers sind nur noch sein Flötenspiel und sein Glaube an den Buddhismus, von dem er überzeugt ist, daß dieser das Schicksal des Menschen eines Tages zum Guten hinführen wird. Bei ihm findet sich später auch die geflohene Frau Jiros, Sue, ein.
Als währenddessen Jiro von der Mobilmachung Saburos Alianz in Kenntnis gerät, setzt er seine Armee ebenfalls in Alarmbereitschaft.
Vor der entscheidenden Schlacht kann zunächst ein Waffenstillstand ausgehandelt werden. Die so gewonnene Zeit möchte Saburo nutzen, um seinen Vater Hidetaro aufzuspüren. Diesen vermeintlich günstigen Zeitpunkt nutzt der Schurke Jiro jedoch, um die verfeindete Allianz anzugreifen. Jiros Armee ist jedoch der Kriegslist des Gegners nicht gewachsen und wird schnell dezimiert. Außerdem erfährt Jiro, daß mitlerweile eine weitere Armee der Allianz seine Residenz angreift.
Währenddessen hat die allein im Schloß weilende Kaede (die Frau Jiros) eine Truppe ausgesandt, um die geflohene (Ex) Frau Jiros, Sue, zu töten. Das Killerkommando macht nach einiger Suche auch die Hütte des Einsiedlers ausfindig, wo sich Hidaro und Sue aufhalten. Bei dieser Gelegenheit töten sie nicht nur Sue und Hidetaro, sondern auch Saburo, der kurz zuvor eingetroffen ist und sich wieder mit seinem Vater (der daraufhin wieder aus seiner geistigen Umnachtung erwacht ist) versöhnt hat.
Als der Genaral, der sich aus ethischen Erwägungen einst weigerte Sue zu töten, davon erfährt und ihm die Auftragsgeberin Kaete dazu noch erzählt, sie habe von Anfang an den Untergang der Dynastie des Hauses Ichimonji geplant, enthauptet der General Kaete umgehend. Sie war die Tochter eines Clanführers, dem Hidetora einst großes Leid zugefügt hat.
Im Kampf um die Residenz Jiros fällt schließlich auch der General und Jiro höchstpersönlich.
Am Ende dieses Massensterbens bleiben nur noch der Hofnarr Hidetoras und der blinde Eremit übrig. Der Hofnarr liegt jetzt klagend auf dem Boden des Schlachtfeldes, brüskiert sich über das Fehlen Gottes Gnaden auf Erden klagt und über den Wahnsinn der Menschen.
Der blinde Eremiten tastet sich mit seinem Stock an einem Abgrund entlang. Dabei fällt ihm eine buddhistische Schrift aus der Hand, die den Abhang hinunter rollt. Die Botschaften sind klar: Der Mensch wandelt stetig am Abgrund des Seins, er tapst sich vorsichtig und unbeholfen durchs Leben und hat dabei ständig den Tod vor Augen. Kein Buddha kann dem Menschen bei der Bewältigung seines Lebens und seiner Leiden helfen. So sehr sich der Mensch auch an die Schriften und an den Glauben klammert: Kein Gott bringt Erlösung, keine Religion Linderung. Religionen sind die hoffnungsvollen Hirngespinnste der Menschen, angesichts seiner Hilflosigkeit gegenüber dem Schicksal. Der Mensch in seinem Elend ist ganz auf sich allein gestellt. Es gibt keine Hilfe einer sich erbarmenden Instanz, so sehr er sich das auch wünschen mag...
Der Name des Filmes RAN, was übersetzt etwa soviel wie "Chaos" bedeutet, hätte für den Film nicht besser gewählt werden können. Denn wie sich schon unschwer aus der Beschreibung der Handlung ableiten läßt, wird hier alles andere als eine lineare Handlungsform propagiert. Ganz im Gegenteil wird der Film hier in seiner reinen Form als Metapher für das Leben als eine unentwirrbare Verflechtung von Psychologie, Schicksal und Gesellschaft geschildert, daß sich jeder Berechenbarkeit und Hoffnung auf Erlösung entzieht.
Die Erlösung, bzw. daß Wirken einer höheren Macht auf die sich der Mensch im Notfall berufen kann, war, wenn auch nur am Rande explizit erwähnt, sicherlich eines der Hauptanliegen Kurosawas und zieht sich bei genauerer Analyse wie ein roter Faden durch die Handlung. Der Mensch klammert sich in seiner Verzweiflung an höhere Mächte und bittet um ein korrigierendes Eingreifen Gottes in sein Schicksal. Aber wie sehr er auch bettelt und bittet, am Ende ist Hilfe durch göttlichen Beistand nur ein illusorisches, kindisches Wunschdenken, um die elementare Angst vor dem Chaos und dem Tod zu mildern. Wer der Wirklichkeit im Angesicht des Leidens auf der Welt ungeschminkt ins Auge schaut, muß feststellen, daß der Mensch in seinem Wirken ganz auf sich allein gestellt ist. Gott (Buddha) ist Tod.
Aber Ran läßt sich sicher nicht auf diesen nihilistischen Aspekt reduzieren. Auch spielt der immer wieder zitierte Verweis, bei RAN würde es sich um eine moderne Variante von Shakespeares King Lear handeln, eine entscheidene Rolle, da bei Shakespeare die Dramen vorzugsweise in den höheren Gesellschaftsschichten angesiedelt sind und die dortigen Intrigen und Schicksalsschläge ebenso zum persönlichen bzw. erweiterten Ruin beitragen, wie es bei RAN der Fall ist. Gleichermaßen läßt sich der Inszenierungsstil als Verbeugung vor dem Theater deuten. Die Scenen sind, wie auf der Bühne notwendig, wohlgeordnet durchchoreographiert und alle Personen haben ihren festen Platz. Die Weite des Raumes bleibt oft ungenutzt und ein organisches durcheinander wird hier nicht geduldet. Die strenge Anordnung und steife Kommunikationsform verweisen natürlich auch auf die Tyrannei jede Spontanität unterdrückender Vorschriften, japanischer Riten und Gebräuche. Auch sind sie eine Reminiszenz an die klassische Tragödie, in dessen Tradition sich der Film wissen will. Beide Aspekte stehen hier gleichberechtigt nebeneinander.
Die geordnete äußere Form steht dann auch im Kontrast zum Chaos der Lebensumstände. So sehr sich der Mensch auch um Normen und die Bewahrung von Tradition bemüht, letztendlich macht der Lauf des Schicksales alle Bemühungen um Kontrolle zunichte, wobei der Tod immer den ultimativen Kontrollverlust darstellt. Die befreiende und zerstörerische Macht des Chaos bricht dann in den epochalen Schlachtscenen auch ungezügelt hervor. In der Wut des Gefechtes, da wo das Leben unkontrolliert den Schutzschirm der Konventionen durchbricht, ist keine Beherrschung mehr möglich. Das gebändigte Tier im Menschen verläßt seinen Zwinger der Sozialisation und das Leben zeigt sein wahres Gesicht: Chaos. Instinkt. RAN.
Was bei Kurosawas Spätwerk sofort ins Auge sticht ist seine prägnante Bildsprache. Aus dieser läßt sich oft mehr ablesen als aus der reinen Handlung und ist zur Entschlüßelung dieses Kunstwerkes unerläßlich.
Auf der einen Seite ist RAN, speziell in den Dialogscenen, kühl und durcharrangiert wie ein japanisches Teehaus, in den Schlachtscenen hingegen bunt und überbordend wie das sprudelnde leben selbst. Sind die Dialogscenen noch von einer matten Farbgebung, die die Unterdrückung der Emotionen, entsprechende der japanischen Kultur, gekennzeichnet, so sind die Farben in den Schlachten ausufernd, und die Gesten der Krieger erinnern in ihrer übersteigerten Dramatik an das Ausdruckkino Sergej Eisensteins. Hier wären wohl allen voran Panzerkreuzer Potemkin und Oktober mit ihrem expressionistischen Exzessen zu nennen.
Durch die bildlich wertende Darstellung des Geschehens, enthält RAN auch eine sozialpolitische Komponente. Die von Funktionalität und Bräuchen durchsetzte japanische Gesellschaft wird hier zwar als praktikabel tolleriert, gleichzeitig wird sie als blaß, farb- und freudlos, statisch und tot dargestellt. Echtes Leben in seiner ganzen Farben- und Ausdruckspracht entfaltet sich erst, wenn, wie in den Kriegsscenen, alle hemmenden Konventionen abgestreift und die bloße, wenn auch animalische, aber freie Seele offengelegt werden kann.
Auf Grund der historischen, theologischen, sozialen, philosophischen Dichte und der stilistischen Besonderheiten, entfaltet der Film wohl erst nach ausgiebiger Betrachtung mehr und mehr von seiner Bedeutung. Nur wenn es dem Zuschauer gelingt, sich neben dem Gesehenen, dem Subtext der symbolschwangeren Bildsprache, der oft mehr zu entlocken ist als der reinen Handlung, zu öffnen, wird er die volle Tiefe dieses Werkes ermeßen können. Dies ist zwar nicht immer einfach und vieles bleibt wohl einer letzten Analyse verschloßen, wer jedoch die Mühen nicht scheut, dem Film mit Akribie auf den Zahn zu fühlen, stößt auf einen Inhaltlichen Reichtum, der selten ist in der Filmwelt und den geneigten Feierabendcineasten reichlich belohnt...
mit 4
mit 3
mit 3
mit 4
bewertet am 22.11.13 um 18:07
Eigentlich sollte man ja gegen die Indizierung von Filmen protestieren. Man sollte auf die Straße gehen und für das Recht auf küstlerische Freiheit und gegen die Entmündigung des Bürgers kämpfen.
In diesem Falle aber trifft genau das Gegenteil zu. Man wünscht sich sehnlichst die gute alte Beschlagnahme wieder herbei und liebäugelt mit einer Staatsmacht, die uns vor solchen Machwerken in Schutz nimmt.
Was sich der Regisseur Jaff Renfroe dreistet, uns hier vor die Nase zu setzen, hat nichts mit den Ansprüchen der Filmkultur des 21. Jahrhunderts zu tun, sondern erfüllt sogar auf Grund der bewußten Vorenthaltung einer nennenswerten Spannungskurve, den Tatbestand der vorsätzlichen temporären cerebralen Anästhesie des Konsumenten gegen seinen Willen.
Nicht allein, daß die computergenerierten Kulissen nicht über das Niveau von handgemalten Kulissen eines Provinztheaters hinausreichen, nein, auch die Handlung ist ist so dünn, daß man sich über die gesamte Leidenszeit von 90min. nichts sehnlicher wünscht, sie möge sich doch bitte wenigstens zeitweise eindimensionales Niveau erreichen: Hier wird nichts erklärt oder hinterleuchtet. Man hätte doch bitteschön wenigstens die Hintergründe beleuchten können, was zu den Mutationen in der Nachbarkolonie geführt hat, um die Geschichte mit einem Minimum an erzählerischer Tiefe zu würzen. Sogar drittklassige Ballerspiele machen das.
Die Lustlose Inszenierung macht die Sache aber noch schlimmer: Der Film macht so müde, daß es auch letztendlich keinen mehr interessiert, wieso die Bewohner Kolonie 3 die Pest an den Hacken haben. Da kann man alternativ besser der Kreismeisterschaft im Dressurreiten zugucken. Und sogar einem Faultier beim Mittagsschlaf zuzugucken, pumpt mehr Adrenalin in die Venen, als diese müde Gammelfleischbeschauung.
Se lbst die Action(=Gewalt)scenen, eigentlich das Salz in der Suppe, 'tschuldigung: in der Kloake, dieses Filmes, sind einfach nur primitiv. Wer auf Kannibalismus- und Zombieschrott auf Videospielniveau steht, der mag bei der einen oder anderen Scene noch ein keusches Flämmchen der Euphorie in seiner Seele auflodern sehen. Bei all denjenigen aber, die auf eine ausgetüftelte Dramatik oder gar beklemmende Spannung zu hoffen gewagt haben, legt sich schnell ein zäher Teppich der Langeweile und des Ekels über die von diesem namenlosen Grauen geschundene Maske.
Den einzigen kleinen Lichtblick bilden hier wohl die Schauspieler, die, allen voran Laurence Fishbourne, ihre einfallslosen Dialoge immerhin erhobenen Hauptes über sich ergehen lassen und gute Mine zum bösem Film machen. Fishbourne ist dann auch der erste, der von dem ungeniert zur Schau gestellten Dilettantismus die Faxen dick hat und, als er realisiert in welchem Schlamassel er da reingeraten ist, Selbsachtung beweist und sich selbst aus dem Film katapultiert.
Soviel Rückrat hätte man Splendid Films auch gewünscht und die Courage, die Gesamte Produktion dem gestandenen Mimen gleich hinterher zu schleudern und dem Regisseur die Lizenz zu entziehen...
In diesem Falle aber trifft genau das Gegenteil zu. Man wünscht sich sehnlichst die gute alte Beschlagnahme wieder herbei und liebäugelt mit einer Staatsmacht, die uns vor solchen Machwerken in Schutz nimmt.
Was sich der Regisseur Jaff Renfroe dreistet, uns hier vor die Nase zu setzen, hat nichts mit den Ansprüchen der Filmkultur des 21. Jahrhunderts zu tun, sondern erfüllt sogar auf Grund der bewußten Vorenthaltung einer nennenswerten Spannungskurve, den Tatbestand der vorsätzlichen temporären cerebralen Anästhesie des Konsumenten gegen seinen Willen.
Nicht allein, daß die computergenerierten Kulissen nicht über das Niveau von handgemalten Kulissen eines Provinztheaters hinausreichen, nein, auch die Handlung ist ist so dünn, daß man sich über die gesamte Leidenszeit von 90min. nichts sehnlicher wünscht, sie möge sich doch bitte wenigstens zeitweise eindimensionales Niveau erreichen: Hier wird nichts erklärt oder hinterleuchtet. Man hätte doch bitteschön wenigstens die Hintergründe beleuchten können, was zu den Mutationen in der Nachbarkolonie geführt hat, um die Geschichte mit einem Minimum an erzählerischer Tiefe zu würzen. Sogar drittklassige Ballerspiele machen das.
Die Lustlose Inszenierung macht die Sache aber noch schlimmer: Der Film macht so müde, daß es auch letztendlich keinen mehr interessiert, wieso die Bewohner Kolonie 3 die Pest an den Hacken haben. Da kann man alternativ besser der Kreismeisterschaft im Dressurreiten zugucken. Und sogar einem Faultier beim Mittagsschlaf zuzugucken, pumpt mehr Adrenalin in die Venen, als diese müde Gammelfleischbeschauung.
Se lbst die Action(=Gewalt)scenen, eigentlich das Salz in der Suppe, 'tschuldigung: in der Kloake, dieses Filmes, sind einfach nur primitiv. Wer auf Kannibalismus- und Zombieschrott auf Videospielniveau steht, der mag bei der einen oder anderen Scene noch ein keusches Flämmchen der Euphorie in seiner Seele auflodern sehen. Bei all denjenigen aber, die auf eine ausgetüftelte Dramatik oder gar beklemmende Spannung zu hoffen gewagt haben, legt sich schnell ein zäher Teppich der Langeweile und des Ekels über die von diesem namenlosen Grauen geschundene Maske.
Den einzigen kleinen Lichtblick bilden hier wohl die Schauspieler, die, allen voran Laurence Fishbourne, ihre einfallslosen Dialoge immerhin erhobenen Hauptes über sich ergehen lassen und gute Mine zum bösem Film machen. Fishbourne ist dann auch der erste, der von dem ungeniert zur Schau gestellten Dilettantismus die Faxen dick hat und, als er realisiert in welchem Schlamassel er da reingeraten ist, Selbsachtung beweist und sich selbst aus dem Film katapultiert.
Soviel Rückrat hätte man Splendid Films auch gewünscht und die Courage, die Gesamte Produktion dem gestandenen Mimen gleich hinterher zu schleudern und dem Regisseur die Lizenz zu entziehen...
mit 1
mit 4
mit 4
mit 1
bewertet am 22.11.13 um 15:41
Mit einfachen Mitteln gestalteter aber grundsolider Genrebeitrag, der sich an den bewährten Mitteln der Blair Witch Project Welle orientiert.
Wie beim Blair Witch Project, bekommt auch beim Europa Report der Zuschauer zusammengeschnittenes Videomaterial zu Gesicht. Dieses stammt hier feilich nicht von einer eskalierten Schnitzeljagd, sonder von der Jupitermond Europa Expedition.
Das Europa Project wurde ins Leben gerufen, als Wissenschaftler entdeckt haben, daß sich unter dem Eispanzer der Oberfläche Europas riesige Seen mit thermischen Aktivitäten (ideale Voraussetzungen für die Entstehung von Leben) befinden. Die Europa Expedition hat nun die Aufgabe, genauer zu untersuchen, ob es außer uns noch anderes Leben im All gibt...
Im völlig unaufgeregten Stil wird der Zuschauer zunächst Zeuge des Alltages an Bord. Behutsam werden die Astronauten und ihr tägliches Einerlei vorgestellt. Bei den Astronauten handelt es sich nicht, wie in den meisten amerikanischen Produktionen, um Space Heros, sondern um recht gewöhnliche Exemplare der Gattung Mensch.
So normal wie die Menschen, so "irdisch" gestaltet sich auch die Mission an sich. Auf SciFi Schnickschnack wie Warpantrieb, Schutzschilde, Phaserkanonen und Lichtschwerter wird hier zu Gunsten einer sich an der momentanen technischen Realität orientierenden Machbarkeit entlanggehangelt. Damit wird die Situation an Bord unmittel- und nachfühlbarer. Die Schwierigkeiten, wie die Probleme mit der psychologischen Isolation und der Trinkwasserrückgewinnung (man kann sichs denken) sind daher auch schlichter menschlicher Natur und werden im pseudodokumentarischem Stil völlig unaufgeregt abgehandelt.
So schlicht dieses Stilmittel ist, so effektiv ist es auch diesmal. Das liegt einerseits an dem durchweg überzeugendem Cast, der seine Rollen erwachsen, seriös und souverän vorzutragen versteht, zum anderen aber auch an dem Filmset, daß in seiner Ausstattung zwar spärlich aber völlig glaubhaft wirkt. Ein anderer, nicht zu unterschätzender Vorteil gegenüber dem Blair Witch Projekt und anderen Handkamerafilmen ist, daß hier auf eine ruhige Kameraführung Wert gelegt wurde. Lediglich bei den Aufnahmen aus den Helmkameras wackelt es ein wenig. Trotzdem ist hier durchgehend alles deutlich zu erkennen und es gibt keine Details, die man nur erahnen kann. Somit ist das Zuschauen deutlich entspannter, als mit einer nervigen Wackelkamera.
Als sich die Mission schließlich dem Jupitermond nähert, nimmt auch die Dramatik an Fahrt auf. Nicht nur riskante Ausseneinsätze müßen bewältigt werden, sondern zu allem Überfluss reißt auch noch der Kontakt zur Erde ab. So ganz allein auf sich gestellt, nähert sich die Mission ihrem Ziel und schafft es sogar erfolgreich mit ihrer Raumkapsel auf der eisigen Oberfläche Europas zu landen.
Die Hinweise, daß möglicherweise Leben unter der eisigen Oberfläche existiert, verdichten sich schnell...
Wie bereits gesagt, bedient sich Europa Report einfacher technischer Mittel. Diese evtl. Manko wird jedoch durch die solide Inszenierung, einer intelligenten Dramaturgie und glaubwürdigen Charakteren mühelos überspielt. Das man sich dabei Motiven diverser Vorbilder bedient und diese diebischer Weise einfach zu einer neuen Patchworkarbeit zusammenfügt hat, sei bei diesem Ergebnis gerne Verziehen.
Den einzigen Kritikpunkt den ich sehe, der dann letztendlich auch zu einem Punkt Abzug geführt hat, ist der, daß sich Europa Report mit seinem semidokumentarischem Stil am Ende selbst ein Bein gestellt hat. So gelungen man die möglichst exakte Darstellung der Raumfahrt aus heutiger Sicht bewerten muß, um den Zuschauer unmittelbar am Geschehen teilhaben zu lassen, so sehr lahmt er zum Schluß an seiner Bindung an wissenschaftlicher Realität. Hier wäre dem Film am Ende ein drastischeres Abrutschen in die die Gefilde des Horrorgenres bzw. ein zurückgreifen auf die Stilmittelkiste des Schockereffektes, zu wünschen gewesen. Die Spannungskurve steigt zwar folgerichtig bis zum Ende des Filmes kontinuierlich an, erfüllt jedoch nicht ihr Versprechen und kann daher wohl nur noch Filmneulinge in Schockstarre versetzen.
Das geübte Auge hätte sich da einen gewaltigeren Tusch gewünscht...
Wie beim Blair Witch Project, bekommt auch beim Europa Report der Zuschauer zusammengeschnittenes Videomaterial zu Gesicht. Dieses stammt hier feilich nicht von einer eskalierten Schnitzeljagd, sonder von der Jupitermond Europa Expedition.
Das Europa Project wurde ins Leben gerufen, als Wissenschaftler entdeckt haben, daß sich unter dem Eispanzer der Oberfläche Europas riesige Seen mit thermischen Aktivitäten (ideale Voraussetzungen für die Entstehung von Leben) befinden. Die Europa Expedition hat nun die Aufgabe, genauer zu untersuchen, ob es außer uns noch anderes Leben im All gibt...
Im völlig unaufgeregten Stil wird der Zuschauer zunächst Zeuge des Alltages an Bord. Behutsam werden die Astronauten und ihr tägliches Einerlei vorgestellt. Bei den Astronauten handelt es sich nicht, wie in den meisten amerikanischen Produktionen, um Space Heros, sondern um recht gewöhnliche Exemplare der Gattung Mensch.
So normal wie die Menschen, so "irdisch" gestaltet sich auch die Mission an sich. Auf SciFi Schnickschnack wie Warpantrieb, Schutzschilde, Phaserkanonen und Lichtschwerter wird hier zu Gunsten einer sich an der momentanen technischen Realität orientierenden Machbarkeit entlanggehangelt. Damit wird die Situation an Bord unmittel- und nachfühlbarer. Die Schwierigkeiten, wie die Probleme mit der psychologischen Isolation und der Trinkwasserrückgewinnung (man kann sichs denken) sind daher auch schlichter menschlicher Natur und werden im pseudodokumentarischem Stil völlig unaufgeregt abgehandelt.
So schlicht dieses Stilmittel ist, so effektiv ist es auch diesmal. Das liegt einerseits an dem durchweg überzeugendem Cast, der seine Rollen erwachsen, seriös und souverän vorzutragen versteht, zum anderen aber auch an dem Filmset, daß in seiner Ausstattung zwar spärlich aber völlig glaubhaft wirkt. Ein anderer, nicht zu unterschätzender Vorteil gegenüber dem Blair Witch Projekt und anderen Handkamerafilmen ist, daß hier auf eine ruhige Kameraführung Wert gelegt wurde. Lediglich bei den Aufnahmen aus den Helmkameras wackelt es ein wenig. Trotzdem ist hier durchgehend alles deutlich zu erkennen und es gibt keine Details, die man nur erahnen kann. Somit ist das Zuschauen deutlich entspannter, als mit einer nervigen Wackelkamera.
Als sich die Mission schließlich dem Jupitermond nähert, nimmt auch die Dramatik an Fahrt auf. Nicht nur riskante Ausseneinsätze müßen bewältigt werden, sondern zu allem Überfluss reißt auch noch der Kontakt zur Erde ab. So ganz allein auf sich gestellt, nähert sich die Mission ihrem Ziel und schafft es sogar erfolgreich mit ihrer Raumkapsel auf der eisigen Oberfläche Europas zu landen.
Die Hinweise, daß möglicherweise Leben unter der eisigen Oberfläche existiert, verdichten sich schnell...
Wie bereits gesagt, bedient sich Europa Report einfacher technischer Mittel. Diese evtl. Manko wird jedoch durch die solide Inszenierung, einer intelligenten Dramaturgie und glaubwürdigen Charakteren mühelos überspielt. Das man sich dabei Motiven diverser Vorbilder bedient und diese diebischer Weise einfach zu einer neuen Patchworkarbeit zusammenfügt hat, sei bei diesem Ergebnis gerne Verziehen.
Den einzigen Kritikpunkt den ich sehe, der dann letztendlich auch zu einem Punkt Abzug geführt hat, ist der, daß sich Europa Report mit seinem semidokumentarischem Stil am Ende selbst ein Bein gestellt hat. So gelungen man die möglichst exakte Darstellung der Raumfahrt aus heutiger Sicht bewerten muß, um den Zuschauer unmittelbar am Geschehen teilhaben zu lassen, so sehr lahmt er zum Schluß an seiner Bindung an wissenschaftlicher Realität. Hier wäre dem Film am Ende ein drastischeres Abrutschen in die die Gefilde des Horrorgenres bzw. ein zurückgreifen auf die Stilmittelkiste des Schockereffektes, zu wünschen gewesen. Die Spannungskurve steigt zwar folgerichtig bis zum Ende des Filmes kontinuierlich an, erfüllt jedoch nicht ihr Versprechen und kann daher wohl nur noch Filmneulinge in Schockstarre versetzen.
Das geübte Auge hätte sich da einen gewaltigeren Tusch gewünscht...
mit 3
mit 4
mit 4
mit 2
bewertet am 14.11.13 um 14:27
Auch der neue Supi wandelt auf den altbewährten Pfaden der CGI durchtränkten Comicverfilmungen. Spezialeffekte en masse gehen mit einer recht Substanzlosen Rachestory Hand in Hand, wobei mal wieder das Wohl der gesamten Menschheit auf dem Spiel steht. Am Anfang lernen wir viel über die Kindheit des Helden, seinen moralischen Werdegang, seine prägenden Kindheitserlebnisse, und am Ende liegt mal wieder eine amerikanische Großstadt in Schutt und Asche.
So weit so gut. Um einen Nachbarschaftsstreit wegen eines Loches im Maschendrahtzaun zu schlichten bedarf es keines Superhelden. Da reicht das Orakel des Dorfältesten völlig aus.
Superhelden sind nun einmal zu Größerem geschaffen. So geht es auch völlig in Ordnung, den obligatorischen Kampf Gut gegen Böse auf kosmische Maße auszuweiten und in einer infernalischen Zerstörungsorgie münden zu lassen.
Wie aber so oft, kommt die Charakterzeichnung und damit die Spannung zu kurz. Obwohl die schauspielerischen Leistungen durchweg respektabel sind, werden die interpersonellen Ausdifferenzierungen immer wieder zu schnell vom Spezialeffektgewitter geschluckt, so daß diese keinen tragfähigen Boden für ein wirklich packendes Drama ausbilden können.
Somit ist Man of Steel zwar grundsolides Unterhaltungskino mit einem hohem Schauwert, jedoch hallt die Nachwirkung nicht über den letzten Schluck aus dem XXL Colabecher hinaus.
Da man in der Regel von solch Großproduktionen auch nicht wirklich erwartet, außerhalb cineastischer Untiefen zu manövrieren, erfüllt auch Man of Steel die gedrosselten Erwartungen zur Genüge. Zumahl sich der Regisseur Zack Snyder auch weniger durch Substanz als denn durch Form auf sich aufmerksam gemacht hat.
Dennoch ist der neue Supermannfilm kein totaler Rohrkrepierer und die Story wartet sogar mit einer gewißen Komplexität auf. Dies ist wohl vor allem dem Co Drehbuchautor Christopher Nolan zu verdanken, dessen Faible für eine ausführliche Erhebung der biographischen Anamnese seit seiner Batman-Triologie jedem Hinterwäldler bekannt sein dürfte. Der Grundstein für ein packendes Drama war also gelegt. Um so bedauerlicher ist also die Unterlassung spannungsbildender Elemente durch menschliche Konflikte. Aber das wäre auch zu schön gewesen.
Ein weiterer Störfaktor ist jedoch die unruhige Kameraführung in den Actionsequenzen, die die Freude an den Zerstörungsorgien erheblich trübt, da man nur ein viertel mitbekommt. Ohne diesen nervtötenden Faktor würde Supi im Rahmen seines Metierrs vielleicht sogar an der 4 Punkte Marke kratzen.
Wer weiß...
So weit so gut. Um einen Nachbarschaftsstreit wegen eines Loches im Maschendrahtzaun zu schlichten bedarf es keines Superhelden. Da reicht das Orakel des Dorfältesten völlig aus.
Superhelden sind nun einmal zu Größerem geschaffen. So geht es auch völlig in Ordnung, den obligatorischen Kampf Gut gegen Böse auf kosmische Maße auszuweiten und in einer infernalischen Zerstörungsorgie münden zu lassen.
Wie aber so oft, kommt die Charakterzeichnung und damit die Spannung zu kurz. Obwohl die schauspielerischen Leistungen durchweg respektabel sind, werden die interpersonellen Ausdifferenzierungen immer wieder zu schnell vom Spezialeffektgewitter geschluckt, so daß diese keinen tragfähigen Boden für ein wirklich packendes Drama ausbilden können.
Somit ist Man of Steel zwar grundsolides Unterhaltungskino mit einem hohem Schauwert, jedoch hallt die Nachwirkung nicht über den letzten Schluck aus dem XXL Colabecher hinaus.
Da man in der Regel von solch Großproduktionen auch nicht wirklich erwartet, außerhalb cineastischer Untiefen zu manövrieren, erfüllt auch Man of Steel die gedrosselten Erwartungen zur Genüge. Zumahl sich der Regisseur Zack Snyder auch weniger durch Substanz als denn durch Form auf sich aufmerksam gemacht hat.
Dennoch ist der neue Supermannfilm kein totaler Rohrkrepierer und die Story wartet sogar mit einer gewißen Komplexität auf. Dies ist wohl vor allem dem Co Drehbuchautor Christopher Nolan zu verdanken, dessen Faible für eine ausführliche Erhebung der biographischen Anamnese seit seiner Batman-Triologie jedem Hinterwäldler bekannt sein dürfte. Der Grundstein für ein packendes Drama war also gelegt. Um so bedauerlicher ist also die Unterlassung spannungsbildender Elemente durch menschliche Konflikte. Aber das wäre auch zu schön gewesen.
Ein weiterer Störfaktor ist jedoch die unruhige Kameraführung in den Actionsequenzen, die die Freude an den Zerstörungsorgien erheblich trübt, da man nur ein viertel mitbekommt. Ohne diesen nervtötenden Faktor würde Supi im Rahmen seines Metierrs vielleicht sogar an der 4 Punkte Marke kratzen.
Wer weiß...
mit 3
mit 4
mit 4
mit 3
bewertet am 10.11.13 um 18:00
Haben mir die alten Chucky Filme noch auf Grund ihrem eher billigen Charme und parodistischen Charakters noch ausreichend gefallen, nimmt sich der neue Chucky mit seiner technischen Perfektion selbst etwas zu ernst und unterhält mich daher nur bedingt.
Richtige Spannung kommt nie auf, weil ich die Mörderpuppe halt noch nie für ein ernstzunehmendes Vollmitglied der Slashergilde halten konnte und für den Trashfoktor isser leider zu sehr aufgepimpt.
OK, ein, zwei Splatterscenen (ab16?), das übliche zehn kleine Negerlein Spiel und das obligatorische: 'Das war doch noch nicht das Ende' Spielchen.
Kann man mal über sich ergehen lassen, tut nicht weh, kitzelt aber auch nicht die Nerven...
Richtige Spannung kommt nie auf, weil ich die Mörderpuppe halt noch nie für ein ernstzunehmendes Vollmitglied der Slashergilde halten konnte und für den Trashfoktor isser leider zu sehr aufgepimpt.
OK, ein, zwei Splatterscenen (ab16?), das übliche zehn kleine Negerlein Spiel und das obligatorische: 'Das war doch noch nicht das Ende' Spielchen.
Kann man mal über sich ergehen lassen, tut nicht weh, kitzelt aber auch nicht die Nerven...
mit 2
mit 4
mit 4
mit 2
bewertet am 10.11.13 um 14:04
Wie man den Film auch bewerten und welche Einstellung man zu Tarantino wohl haben mag, aus filmhistorischer Sicht kann der krude Mix aus Gewalt und Philosophie nicht hoch genug geschätzt und nur als bahnbrechend bezeichnet werden.
Viele Komponenten, die heute zum Standardrepertoire eines jeden Independentregisseurs gehören, verdanken Tarantino und vor allem Pulp Fiction ihre Berechtigung.
Dazu gehören nicht nur der verschachtelte Erzählstil, der mit seinen Zeitsprüngen das bereits Gesehene immer wieder neu bewerten läßt und somit eine neue Spannungsvariante einführt, sondern auch die Fähigkeit, scheinbar alltägliche Konversation mit philosophischen Einwänden und entwappnender Ehrlichkeit zu unterfüttern, stilisiert den Small Talk erstmals zur Kunstform.
Dabei handelt es sich hier bei den ausgedehnten Konversationsstaffetten jedoch nur scheinbar um blangloses Verbalgeplänkel. Denn die Dialoge sind geschliffen wie Brillianten, von unnützen verbalen Ballast befreit und somit auf die Ebene von präzisen Wortkonstruktion runtergebrochen. Die so auf den Punkt gebrachten Dialoge erreichen damit die Qualität von Zitaten und setzten somit die Voraussetzungen, um sich bleibend im kollektiven Gedächtnis der Filmgemeinde zu verankern.
Die Akribie und Liebe zum Detail mit der Tarantino hierbei zu Werke geht ist zwar höchst bemerkenswert, aber nicht neu und macht den Film alleine noch nicht zu etwas besonderem.
Sein höchster Verdienst ist es vor allem, den Film konsequent aus der Sicht eines durchgeknallten aber filmtechnisch und -historisch äußerst visierten und hochbegabten Cineasten zu erzählen. Das heist, sich einer Sprache zu bedienen, die Filmliebhaber, wenn sie nicht an die Beschränkungen der Filmindustie mit ihren einhergehenden moralischen Kodexen gebunden sind, wählen würden, um ihren derben, mitunter kranken Phantasien freien Lauf zu lassen.
Darauf basierend hangelt sich der Film an abstrusen Einfällen wie dem Stechen der Adrenalinspritze ins pochende Herz, einer Jahrelang im Arsch versteckten Uhr, einem schwulen SadoMaso Studio hinter der Trennwand des Pfandleihers, und ähnlichen Skurrilitäten entlang. Genau die Dinge als, die das Filmpublikum mit einem ausgeprägten Faible für abseitigen Humor nur hinter vorgehaltener Hand und im Kreise Gleichgesinntener zu äußern, aber nie zu sehen hoffen wagte, werden bei Pulp Fiction feierlich zelebriert und haben das Tor für kaputte Typen und schräge Situationen in der Kinowelt sperrangelweit aufgestoßen.
Im Zuge der darauf folgenden Imitationswelle, auch besonders aus dem skandinavischen Raum, die nach Pulp Fiction dammbruchartig durch die Lichtspielhäuser brandete, fällt immer wieder auf, daß diese nicht dasselbe visuelle Gespür, daß subtile Textgefühl und daß filmtechnisches Wissen vorweisen können wie Tarantino.
Durch die direkten Vergleiche mit den keineswegs immer mißlungenen Nachahmern erscheint Pulp Fiction auf Grund seiner unerreichten Originalität somit in einem noch exponierterem Lichte.
Zum Erfolg seiner Filme trägt aber nicht nur Tarantino alleine die Verantwortung. Auch die so treffend agierenden Schauspieler, die ihre Rollen mit einer arktischen Coolness verkörpern, sind für den Erfolg des Filmes maßgeblich mitverantwortlich. Allen voran sind hier natürlich John Travolta und Samuell Jackson zu nennen
Cool ist dabei auch das Schlagwort, mit dem sich der Film am ehesten umschreiben läßt.
Aber nicht cool auf eine kalte abschreckende, sondern auf eine lustvolle, von Humor und Selbstverwirklichungsstreben getragene Art, die in den stilvollen Bildern LA's ihre Vollendung findet.
Zwar haben die Endlosdialoge im Lauf der Jahre zwangsläufig an Unterhaltungswert eingebüßt und die einst fulminanten Höhepunkte sind an einer Hand abzuzählen, dennoch hat der Film nichts von seiner Innovationskraft verloren und Samuell Jacksons emotional-cooler Selbstfindungstrip begeistert auch heute noch.
Allein schon für die Tatsache, daß nach dem 100Millionen Erfolg von Pulp Fiction vieles im Kino möglich war, was noch kurz vorher in den Bereich des Utopischen gehörte und daß es seit Pulp Fiction kein vergleichbaren Quantensprung mehr im Kino gegeben hat, ist Tarantino ein Platz im Walhalla an der Seite anderer großen Pioniere wie Alfred Hitchcock, Mickey Mouse und Uwe Boll sicher.
Viele Komponenten, die heute zum Standardrepertoire eines jeden Independentregisseurs gehören, verdanken Tarantino und vor allem Pulp Fiction ihre Berechtigung.
Dazu gehören nicht nur der verschachtelte Erzählstil, der mit seinen Zeitsprüngen das bereits Gesehene immer wieder neu bewerten läßt und somit eine neue Spannungsvariante einführt, sondern auch die Fähigkeit, scheinbar alltägliche Konversation mit philosophischen Einwänden und entwappnender Ehrlichkeit zu unterfüttern, stilisiert den Small Talk erstmals zur Kunstform.
Dabei handelt es sich hier bei den ausgedehnten Konversationsstaffetten jedoch nur scheinbar um blangloses Verbalgeplänkel. Denn die Dialoge sind geschliffen wie Brillianten, von unnützen verbalen Ballast befreit und somit auf die Ebene von präzisen Wortkonstruktion runtergebrochen. Die so auf den Punkt gebrachten Dialoge erreichen damit die Qualität von Zitaten und setzten somit die Voraussetzungen, um sich bleibend im kollektiven Gedächtnis der Filmgemeinde zu verankern.
Die Akribie und Liebe zum Detail mit der Tarantino hierbei zu Werke geht ist zwar höchst bemerkenswert, aber nicht neu und macht den Film alleine noch nicht zu etwas besonderem.
Sein höchster Verdienst ist es vor allem, den Film konsequent aus der Sicht eines durchgeknallten aber filmtechnisch und -historisch äußerst visierten und hochbegabten Cineasten zu erzählen. Das heist, sich einer Sprache zu bedienen, die Filmliebhaber, wenn sie nicht an die Beschränkungen der Filmindustie mit ihren einhergehenden moralischen Kodexen gebunden sind, wählen würden, um ihren derben, mitunter kranken Phantasien freien Lauf zu lassen.
Darauf basierend hangelt sich der Film an abstrusen Einfällen wie dem Stechen der Adrenalinspritze ins pochende Herz, einer Jahrelang im Arsch versteckten Uhr, einem schwulen SadoMaso Studio hinter der Trennwand des Pfandleihers, und ähnlichen Skurrilitäten entlang. Genau die Dinge als, die das Filmpublikum mit einem ausgeprägten Faible für abseitigen Humor nur hinter vorgehaltener Hand und im Kreise Gleichgesinntener zu äußern, aber nie zu sehen hoffen wagte, werden bei Pulp Fiction feierlich zelebriert und haben das Tor für kaputte Typen und schräge Situationen in der Kinowelt sperrangelweit aufgestoßen.
Im Zuge der darauf folgenden Imitationswelle, auch besonders aus dem skandinavischen Raum, die nach Pulp Fiction dammbruchartig durch die Lichtspielhäuser brandete, fällt immer wieder auf, daß diese nicht dasselbe visuelle Gespür, daß subtile Textgefühl und daß filmtechnisches Wissen vorweisen können wie Tarantino.
Durch die direkten Vergleiche mit den keineswegs immer mißlungenen Nachahmern erscheint Pulp Fiction auf Grund seiner unerreichten Originalität somit in einem noch exponierterem Lichte.
Zum Erfolg seiner Filme trägt aber nicht nur Tarantino alleine die Verantwortung. Auch die so treffend agierenden Schauspieler, die ihre Rollen mit einer arktischen Coolness verkörpern, sind für den Erfolg des Filmes maßgeblich mitverantwortlich. Allen voran sind hier natürlich John Travolta und Samuell Jackson zu nennen
Cool ist dabei auch das Schlagwort, mit dem sich der Film am ehesten umschreiben läßt.
Aber nicht cool auf eine kalte abschreckende, sondern auf eine lustvolle, von Humor und Selbstverwirklichungsstreben getragene Art, die in den stilvollen Bildern LA's ihre Vollendung findet.
Zwar haben die Endlosdialoge im Lauf der Jahre zwangsläufig an Unterhaltungswert eingebüßt und die einst fulminanten Höhepunkte sind an einer Hand abzuzählen, dennoch hat der Film nichts von seiner Innovationskraft verloren und Samuell Jacksons emotional-cooler Selbstfindungstrip begeistert auch heute noch.
Allein schon für die Tatsache, daß nach dem 100Millionen Erfolg von Pulp Fiction vieles im Kino möglich war, was noch kurz vorher in den Bereich des Utopischen gehörte und daß es seit Pulp Fiction kein vergleichbaren Quantensprung mehr im Kino gegeben hat, ist Tarantino ein Platz im Walhalla an der Seite anderer großen Pioniere wie Alfred Hitchcock, Mickey Mouse und Uwe Boll sicher.
mit 5
mit 5
mit 4
mit 4
bewertet am 10.11.13 um 13:48
Kubricks Visionärer Klassiker bleibt durch seine bis ins kleinste Detail vollendete architektonische Ästhetik sowie der Sensibilisierung des Bewustseins für das Unaussprechliche, bis heute ein unerreichter Meilenstein der Kinogeschichte.
Stringenter Minimalismus geht hier mit vollendeter Geometrie eine Symbiose ein, die Bilder von so schlichter Schönheit erzeugen, daß sie sich mitlerweile als legändere Ikonen der cinematographen Bildsprache etabliert haben.
Die "Handlung" wird dabei durch die nicht näher definierte Funktion eines plötzlich auftretenden Steinmonolithen durchlaufend von einem Unterstrom des Mysteriösem und Unerklärlichem getragen und mündet in einem kryptischen Bilderreigen, der sich ebenfalls einer finalen Interpretation entzieht, den Zuschauer jedoch auf eine Ebene jenseits des intellektuellen Verstehens, in die Bereiche des intuitiven Erahnens zu katapultierten vermag....
So einfach und klar die Formensprache, so komplex und kryptisch stellt sich im Gegensatz dazu die Handlung dar.
Im Groben geht es aber um die Bewußtwerdung des Menschen, bzw. die Evolution des Bewußtseins an sich.
In grauer Vorzeit lebten unsere behaarten Vorfahren mehr oder weniger einfach in Gruppen zusammen, die sich mit dem Verdauen von Kräutern, dem Bewachen der Wasserstelle und den Zwistigkeiten mit dem Nachbarstamm zufrieden gaben.
Als jedoch eines Morgens ein schwarzer Monolith im Gehege steht und die Primaten mit diesem in Kontakt treten, erwacht ihr Bewußtsein aus dem Dämmerschlaf von Nahrungsaufnahme und Fortpflanzung. Ein kreativer Funken blitzt auf, und die Primaten entdecken ihre Umwelt manipulativ zu gestalten: Ein alter Tierknochen wird als Waffe "zweckentfremdet". Die Gnade des Verstehens wird von Beginn an, typisch für diese Spezies, hauptsächlich in den Dienst der Machtausübung und Unterdrückung, der Unterstützung von Trieben und Instinkten, der Gier nach mehr und Selbsbehauptung, gestellt.
4 Millionen Jahre und 100.000 Kriege später, wir befinden uns im Jahr 2001, taucht erneut ein Monolith auf. Diesmal auf dem Erdtrabanten. Den Menschen ist augenblicklich klar, daß dieser dort nur von einer fremden Intelligenz deponiert worden sein konnte.
Da der Monolith aber keine Antworten auf die Fragen liefert, wer ihn dort hingestellt haben mag, stattdessen jedoch Radiosignale in Richtung Jupiter sendet, beschließt man, ein bemanntes Raumschiff, die Discovery, auf eine Aufklärungsmission dorthin zu senden.
An Bord der Discovery befinden sich außer den zwei aktiven Besatzungsmitgliedern Mike und Dave, noch 3 weitere Astronauten, die jedoch in Tiefschlaf versetzt wurden, sowie der Computer HAL 9000. Dieser perfekteste und technisch versierteste Computer der Welt, beobachtet und analysiert die Besatzung, gleich einem allsehendem Auge, durch Kameraobjektive in jedem Winkel des Raumschiffes.
Als die Crew jedoch beschließt HAL auf Grund einer erstmalig registrierten technischen Fehleinschätzung des Computers, im Notfall abzuschalten, sieht dieser das Raumschiff und die Mission in Gefahr und schaltet auf Gegenangriff.
HAL es schafft tatsächlich, Mike im Rahmen eines fingierten Reperaturmanövers ins All hinauszuschleudern. Dave, jedoch kann sich den Tötungsbemühungen des Computers entziehen und es gelingt ihm mit Mühe und Not, HAL abzuschalten und den Jupiter zu erreichen.
Dort schwebt erneut ein schwarzer Monolith inmitten den Weiten des Weltalls.
Als Dave den Monolithen ins Visier nimmt, wird er Zeuge mystischer Farb- und Formenexplosionen, die von dem Quader ausgehen. Diese symbolisieren so etwas wie die Schöpfung des Universums und stellen die Entstehung und Evolution der Planeten im Zeitraffer dar. Am Ende steht Dave's Raumkapsel in einer sterilen, weißen Wohnung, in der er, sichtlich vorgealtert, sich selber als alten Mann, als sterbenden und schließlich als Fötus sieht. Das Bewußtsein Dave's hat nach dem Offenbarungserlebnisses der Schöpfung unsere bekannten räumlichen und zeitlichen Dimension hinter sich gelassen.
Zum Schluß schwebt ein riesiges Embryo direkt neben der Erde durch das All. Dave wird als neues, kosmisches Wesen, wiedergeboren. Die Mysterien der Schöpfung der Planeten und der des Lebens werden als Gleichbedeutend und Ebenbürtig angesehen.
Die Phantasmagorie am Ende des Films läßt sich aber auf Grund des überwiegend visuellen Aspektes und der kryptischen Symbolsprache jedoch sicherlich nicht erschöpfend analysieren. Ich berufe mich daher auf das (nachträglich verfaßte) Buch 2001 von Co Autor Arthur C. Clark.
Eindeutig jedoch ist, daß der Film an dem Mysterium der Schöpfung, der Mensch- und Bewußtwerdung im speziellen, und des Lebens im allgemeinen, rührt. Es ist der gelungene Versuch, unter Mißachtung gewohnter Wahrnehmungs- und Denkprozesse, die Sensoren für das Wunder der Existenz zu öffnen und den Zuschauer so auf eine spirituelle Reise zu schicken, deren Wert sich allerdings ausschließlich nur an dem eigenem zutage gefördertem inneren Reichtum bemessen läßt. Für Befürworter vorgekauter cineastischer Kost gibt's hier nichts zu holen. Für diese Spezies gibt's nur ein paar sich lausende Affen, eine Walzer tanzende Raumstation, einen kaputten Computer, Weltraumdisco mit Lasershow, Frühstück bei Opa und ein Monsterbaby welches am Ende die Erde angreift. Und dann, grad wos so spannend wird ist Schluß. Gute Nacht Kevin und Chantal. Hoffentlich haben die Nachos geschmeckt!
Natürlich ist 2001 aber auch zum Großteil ein ästhetisches Manifest. Visuelle Exaktheit und der Einsatz klassischer, schwebender Themen genoß bei Kubrick höchste Priorität. So ist es sicher, entgegen anderen Behauptungen, kein Zufall, daß sich Kubrick als Untermalung seiner schwerelos im All tanzenden Raumstationen gerade für die Musik des Walzerkönigs Johann Strauss ausgesucht hat. Denn gerade beim Walzer soll das Tanzpaar ja gleich der Schwerelosigkeit über das Parkett schweben.
Obwohl mitlerweile 45 Jahre alt, wurde nach 2001 nie wieder ein Scince Fiction Film von annährender Seriösität gedreht. Kein anderer Scince Fiction Film hat sich je wieder so eng an die physikalische Realität gehalten. Kein anderer Scince Fiction Film hat so demonstrativ auf technisches Brimborioum und Alien Schnick Schnack verzichtet und sich so der raumfahrerischen Realität verschrieben.
Wenn man den Astronauten minutenlang bei ihren Weltraumspaziergängen zuschaut und außer ihrem gepreßten Atem nichts, aber auch rein garnichts hört, wird die Stille und die Leere des Weltraumes erst begreifbar. Was die einen also als maximale Langeweile betitteln, da sie einfach die betäubende Filmmusik oder den überraschenden Klingonenangriff vermissen, ist für die anderen stilistisches Stilmittel in Perfektion und somit höchster Genuß.
Somit ist 2001 so etwas wie ein Rohrschachklecks für Filmfreunde. Auf Grund der Priorität der Bilder und der unterlassenen Interpretation der selben, kann ein jeder nach seiner Fasson reininterpretieren und genießen, was er möchte. Wer da nichts hat, muß sich mit der Handlung begnügen und ist der Gelackmeierte. Um so reicher jedoch das philosophische und spirituelle Innenleben ausgestattet ist, um so mehr Eigenes findet man auch in den Bildern als Subtext wiedergespiegelt.
So dürfte auch der Entstehungszeitpunkt, 1968, nicht ganz unerheblich für das Renommee des Filmes gewesen sein. Denn zu einer Zeit, als eine halbe Generation selbst auf intergallaktischen (psychedelischen) Trip und Selbstfindungsreise war und daher das Intellektuelle Leben die wildesten Blüten trieb, war die kosmisch- esoterische aufgeladene Weltraumreise naturgegeben ein gefundenes Fressen und idealer Nährboden für die exotischsten Zeitgenossen und spinnerten Philosophien jeglicher Colleur.
Das Bild ist Top und so gerät das Ende erstmals zum verdienten Spektakel...
Stringenter Minimalismus geht hier mit vollendeter Geometrie eine Symbiose ein, die Bilder von so schlichter Schönheit erzeugen, daß sie sich mitlerweile als legändere Ikonen der cinematographen Bildsprache etabliert haben.
Die "Handlung" wird dabei durch die nicht näher definierte Funktion eines plötzlich auftretenden Steinmonolithen durchlaufend von einem Unterstrom des Mysteriösem und Unerklärlichem getragen und mündet in einem kryptischen Bilderreigen, der sich ebenfalls einer finalen Interpretation entzieht, den Zuschauer jedoch auf eine Ebene jenseits des intellektuellen Verstehens, in die Bereiche des intuitiven Erahnens zu katapultierten vermag....
So einfach und klar die Formensprache, so komplex und kryptisch stellt sich im Gegensatz dazu die Handlung dar.
Im Groben geht es aber um die Bewußtwerdung des Menschen, bzw. die Evolution des Bewußtseins an sich.
In grauer Vorzeit lebten unsere behaarten Vorfahren mehr oder weniger einfach in Gruppen zusammen, die sich mit dem Verdauen von Kräutern, dem Bewachen der Wasserstelle und den Zwistigkeiten mit dem Nachbarstamm zufrieden gaben.
Als jedoch eines Morgens ein schwarzer Monolith im Gehege steht und die Primaten mit diesem in Kontakt treten, erwacht ihr Bewußtsein aus dem Dämmerschlaf von Nahrungsaufnahme und Fortpflanzung. Ein kreativer Funken blitzt auf, und die Primaten entdecken ihre Umwelt manipulativ zu gestalten: Ein alter Tierknochen wird als Waffe "zweckentfremdet". Die Gnade des Verstehens wird von Beginn an, typisch für diese Spezies, hauptsächlich in den Dienst der Machtausübung und Unterdrückung, der Unterstützung von Trieben und Instinkten, der Gier nach mehr und Selbsbehauptung, gestellt.
4 Millionen Jahre und 100.000 Kriege später, wir befinden uns im Jahr 2001, taucht erneut ein Monolith auf. Diesmal auf dem Erdtrabanten. Den Menschen ist augenblicklich klar, daß dieser dort nur von einer fremden Intelligenz deponiert worden sein konnte.
Da der Monolith aber keine Antworten auf die Fragen liefert, wer ihn dort hingestellt haben mag, stattdessen jedoch Radiosignale in Richtung Jupiter sendet, beschließt man, ein bemanntes Raumschiff, die Discovery, auf eine Aufklärungsmission dorthin zu senden.
An Bord der Discovery befinden sich außer den zwei aktiven Besatzungsmitgliedern Mike und Dave, noch 3 weitere Astronauten, die jedoch in Tiefschlaf versetzt wurden, sowie der Computer HAL 9000. Dieser perfekteste und technisch versierteste Computer der Welt, beobachtet und analysiert die Besatzung, gleich einem allsehendem Auge, durch Kameraobjektive in jedem Winkel des Raumschiffes.
Als die Crew jedoch beschließt HAL auf Grund einer erstmalig registrierten technischen Fehleinschätzung des Computers, im Notfall abzuschalten, sieht dieser das Raumschiff und die Mission in Gefahr und schaltet auf Gegenangriff.
HAL es schafft tatsächlich, Mike im Rahmen eines fingierten Reperaturmanövers ins All hinauszuschleudern. Dave, jedoch kann sich den Tötungsbemühungen des Computers entziehen und es gelingt ihm mit Mühe und Not, HAL abzuschalten und den Jupiter zu erreichen.
Dort schwebt erneut ein schwarzer Monolith inmitten den Weiten des Weltalls.
Als Dave den Monolithen ins Visier nimmt, wird er Zeuge mystischer Farb- und Formenexplosionen, die von dem Quader ausgehen. Diese symbolisieren so etwas wie die Schöpfung des Universums und stellen die Entstehung und Evolution der Planeten im Zeitraffer dar. Am Ende steht Dave's Raumkapsel in einer sterilen, weißen Wohnung, in der er, sichtlich vorgealtert, sich selber als alten Mann, als sterbenden und schließlich als Fötus sieht. Das Bewußtsein Dave's hat nach dem Offenbarungserlebnisses der Schöpfung unsere bekannten räumlichen und zeitlichen Dimension hinter sich gelassen.
Zum Schluß schwebt ein riesiges Embryo direkt neben der Erde durch das All. Dave wird als neues, kosmisches Wesen, wiedergeboren. Die Mysterien der Schöpfung der Planeten und der des Lebens werden als Gleichbedeutend und Ebenbürtig angesehen.
Die Phantasmagorie am Ende des Films läßt sich aber auf Grund des überwiegend visuellen Aspektes und der kryptischen Symbolsprache jedoch sicherlich nicht erschöpfend analysieren. Ich berufe mich daher auf das (nachträglich verfaßte) Buch 2001 von Co Autor Arthur C. Clark.
Eindeutig jedoch ist, daß der Film an dem Mysterium der Schöpfung, der Mensch- und Bewußtwerdung im speziellen, und des Lebens im allgemeinen, rührt. Es ist der gelungene Versuch, unter Mißachtung gewohnter Wahrnehmungs- und Denkprozesse, die Sensoren für das Wunder der Existenz zu öffnen und den Zuschauer so auf eine spirituelle Reise zu schicken, deren Wert sich allerdings ausschließlich nur an dem eigenem zutage gefördertem inneren Reichtum bemessen läßt. Für Befürworter vorgekauter cineastischer Kost gibt's hier nichts zu holen. Für diese Spezies gibt's nur ein paar sich lausende Affen, eine Walzer tanzende Raumstation, einen kaputten Computer, Weltraumdisco mit Lasershow, Frühstück bei Opa und ein Monsterbaby welches am Ende die Erde angreift. Und dann, grad wos so spannend wird ist Schluß. Gute Nacht Kevin und Chantal. Hoffentlich haben die Nachos geschmeckt!
Natürlich ist 2001 aber auch zum Großteil ein ästhetisches Manifest. Visuelle Exaktheit und der Einsatz klassischer, schwebender Themen genoß bei Kubrick höchste Priorität. So ist es sicher, entgegen anderen Behauptungen, kein Zufall, daß sich Kubrick als Untermalung seiner schwerelos im All tanzenden Raumstationen gerade für die Musik des Walzerkönigs Johann Strauss ausgesucht hat. Denn gerade beim Walzer soll das Tanzpaar ja gleich der Schwerelosigkeit über das Parkett schweben.
Obwohl mitlerweile 45 Jahre alt, wurde nach 2001 nie wieder ein Scince Fiction Film von annährender Seriösität gedreht. Kein anderer Scince Fiction Film hat sich je wieder so eng an die physikalische Realität gehalten. Kein anderer Scince Fiction Film hat so demonstrativ auf technisches Brimborioum und Alien Schnick Schnack verzichtet und sich so der raumfahrerischen Realität verschrieben.
Wenn man den Astronauten minutenlang bei ihren Weltraumspaziergängen zuschaut und außer ihrem gepreßten Atem nichts, aber auch rein garnichts hört, wird die Stille und die Leere des Weltraumes erst begreifbar. Was die einen also als maximale Langeweile betitteln, da sie einfach die betäubende Filmmusik oder den überraschenden Klingonenangriff vermissen, ist für die anderen stilistisches Stilmittel in Perfektion und somit höchster Genuß.
Somit ist 2001 so etwas wie ein Rohrschachklecks für Filmfreunde. Auf Grund der Priorität der Bilder und der unterlassenen Interpretation der selben, kann ein jeder nach seiner Fasson reininterpretieren und genießen, was er möchte. Wer da nichts hat, muß sich mit der Handlung begnügen und ist der Gelackmeierte. Um so reicher jedoch das philosophische und spirituelle Innenleben ausgestattet ist, um so mehr Eigenes findet man auch in den Bildern als Subtext wiedergespiegelt.
So dürfte auch der Entstehungszeitpunkt, 1968, nicht ganz unerheblich für das Renommee des Filmes gewesen sein. Denn zu einer Zeit, als eine halbe Generation selbst auf intergallaktischen (psychedelischen) Trip und Selbstfindungsreise war und daher das Intellektuelle Leben die wildesten Blüten trieb, war die kosmisch- esoterische aufgeladene Weltraumreise naturgegeben ein gefundenes Fressen und idealer Nährboden für die exotischsten Zeitgenossen und spinnerten Philosophien jeglicher Colleur.
Das Bild ist Top und so gerät das Ende erstmals zum verdienten Spektakel...
mit 5
mit 5
mit 4
mit 4
bewertet am 05.11.13 um 12:17
Top Angebote
kleinhirn
GEPRÜFTES MITGLIED
FSK 18
Aktivität
Forenbeiträge0
Kommentare41
Blogbeiträge0
Clubposts0
Bewertungen509
Mein Avatar
Weitere Funktionen
(509)
(16)
Beste Bewertungen
kleinhirn hat die folgenden 4 Blu-rays am besten bewertet:
Letzte Bewertungen
Filme suchen nach
Mit dem Blu-ray Filmfinder können Sie Blu-rays nach vielen unterschiedlichen Kriterien suchen.
Die Filmbewertungen von kleinhirn wurde 341x besucht.