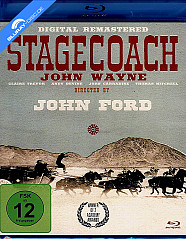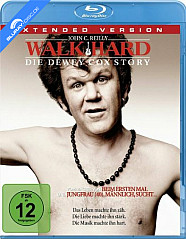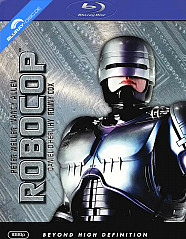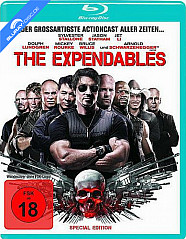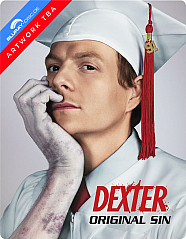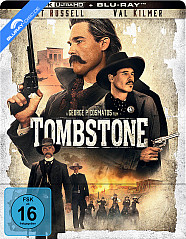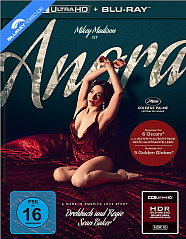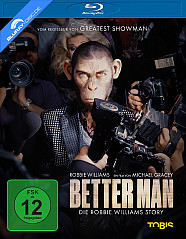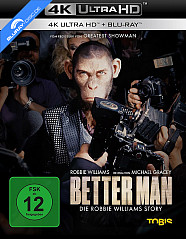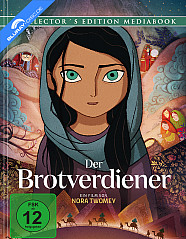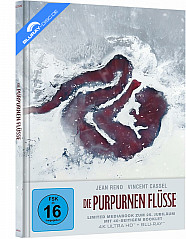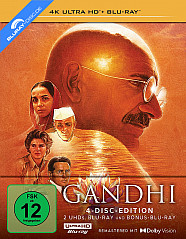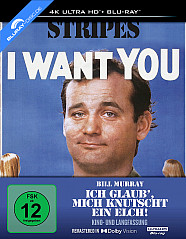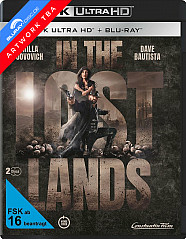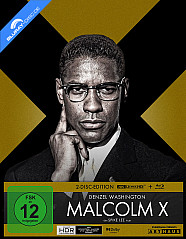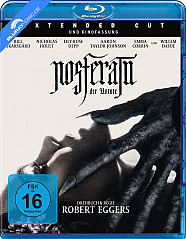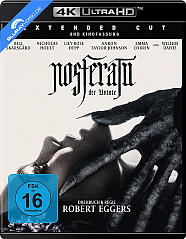Plaion Pictures verschiebt Blu-ray-Release von "Magnum: Die komplette Serie" auf den 30. Juni 2025"Rock 'n' Roll Ringo": Kirmes-Drama mit Martin Rohde ab 30.05. auf Blu-ray Disc"Ein Minecraft Film": Computerspielverfilmung mit Jason Momoa und Jack Black demnächst auf Blu-ray und 4K UHD - UPDATE 2Die bluray-disc.de Vorbestell- und Kaufcharts vom März 2025Erneut auf Blu-ray: "The Devil’s Rejects" und "3 from Hell" von Rob Zombie in Mediabook-EditionenItalo Cinema Collection: "Das Haus mit dem dunklen Keller - A Blade in the Dark" erscheint auf Ultra HD Blu-rayBald auf Blu-ray in Mediabooks: Die "Pulse"- und "Feast "-Horrorfilme von NSM Records - UPDATE 3Gewinnspiel: bluray-disc.de und Tobis Film verlosen "Better Man - Die Robbie Williams Story" auf Blu-ray, 4K UHD und DVDHeute neu auf Blu-ray Disc: "Mufasa", "Better Man - Die Robbie Williams Story", "Die purpurnen Flüsse" im 4K-Mediabook und mehrJede Menge tolle Preise gewinnen: Am 14. April startet der "bluray-disc.de Osterkalender 2025"
NEWSTICKER
Filmbewertungen von kleinhirn
Rundum gelungene Hommage an die Gründungsväter des Gruselgenres.
Tim Burton zieht hier alle Register seines Könnens, um einen Film aus den Hut zu zaubern, dessen Ausgewogenheit von Parodie, Humor, Grusel, Gefühl, Kuriosität und Design bis ins kleinste Detail überzeugen.
Viktors und sein Hund Sparky sind ein Herz und eine Seele. Als Sparky das zeitliche segnet, fällt ihm der Versuch seines neuen Physiklehrers (Krychnowsgki o.ä.) ein, der mit Hilfe einer Batterie einem toten Frosch noch einmal das Tanzbein schwingen ließ. Untröstlich traurig über den Verlust seines Hundes nutzt Viktor ein nahendes Gewitter aus, um das Experiment im Maßstab 1:10 zu wiederholen. Und siehe da, Sparky kehrt aus den ewigen Jagdgründen zurück und ist Viktor wieder ein treuer Gefährte.
Da ein Hund naturgemäß aber nunmal nicht gern den leben langen Tag im Körbchen verbringt, ist die Sensation allerdings schnell kein Geheimnis mehr. Auf den Erfolg neidisch und erpicht darauf, diesen Erfolg zu übertrumpfen, machen sich die Gören aus der Nachbarschaft daran, den Versuch für einen Wissenschaftspreis zu kopieren...
Burtons größter Verdienst dieses Schaulaufens klassischer Horrorfilmlegenden, ist wahrscheinlich, daß er sich nicht, wie so oft in letzter Zeit gesehen, dem Geschmack von Vorschulkindern anbiedert, um daß prädikat "Familientauglich" zu erhaschen, sondern konsequent bis zum Schluß seinem verschrobenen Stil treu bleibt und lieber auf zielsichere Pointen als auf kitschige Gefühle und harmlose Späße setzt.
Insgesamt sind Burtons Späße aber keine Schenkelklopfer, sonder besitzen eher feinfühligen und intelligenten Charakter. So wird man vieles nicht verstehen, wenn man nicht zumindest ein Vordiplom im Studium des klassischen Grusel- und Monsterfilms sein eigen nennen kann. Aber auch wenn sich nicht jede Parodie erschließt, so funktioniert Frankenweenie durch seine spleenigen Charaktere, seine emotionale Erzählstruktur, die jedoch nie ins sentimentale abgleitet und Burtons morbid, liebenswerter Welt, auch als eigenständiges Märchen, in dessen Sog man sich allzeit gut geborgen fühlt, da sich der Humor stets gegenüber dem Bösen durchzusetzen versteht.
So sei der Film allen nahegelegt, die subtile und intelligente Filmkost zu schätzen wissen, und sich auch Abseits des großen Radaus vorzüglich unterhalten lassen können.
Tim Burton zieht hier alle Register seines Könnens, um einen Film aus den Hut zu zaubern, dessen Ausgewogenheit von Parodie, Humor, Grusel, Gefühl, Kuriosität und Design bis ins kleinste Detail überzeugen.
Viktors und sein Hund Sparky sind ein Herz und eine Seele. Als Sparky das zeitliche segnet, fällt ihm der Versuch seines neuen Physiklehrers (Krychnowsgki o.ä.) ein, der mit Hilfe einer Batterie einem toten Frosch noch einmal das Tanzbein schwingen ließ. Untröstlich traurig über den Verlust seines Hundes nutzt Viktor ein nahendes Gewitter aus, um das Experiment im Maßstab 1:10 zu wiederholen. Und siehe da, Sparky kehrt aus den ewigen Jagdgründen zurück und ist Viktor wieder ein treuer Gefährte.
Da ein Hund naturgemäß aber nunmal nicht gern den leben langen Tag im Körbchen verbringt, ist die Sensation allerdings schnell kein Geheimnis mehr. Auf den Erfolg neidisch und erpicht darauf, diesen Erfolg zu übertrumpfen, machen sich die Gören aus der Nachbarschaft daran, den Versuch für einen Wissenschaftspreis zu kopieren...
Burtons größter Verdienst dieses Schaulaufens klassischer Horrorfilmlegenden, ist wahrscheinlich, daß er sich nicht, wie so oft in letzter Zeit gesehen, dem Geschmack von Vorschulkindern anbiedert, um daß prädikat "Familientauglich" zu erhaschen, sondern konsequent bis zum Schluß seinem verschrobenen Stil treu bleibt und lieber auf zielsichere Pointen als auf kitschige Gefühle und harmlose Späße setzt.
Insgesamt sind Burtons Späße aber keine Schenkelklopfer, sonder besitzen eher feinfühligen und intelligenten Charakter. So wird man vieles nicht verstehen, wenn man nicht zumindest ein Vordiplom im Studium des klassischen Grusel- und Monsterfilms sein eigen nennen kann. Aber auch wenn sich nicht jede Parodie erschließt, so funktioniert Frankenweenie durch seine spleenigen Charaktere, seine emotionale Erzählstruktur, die jedoch nie ins sentimentale abgleitet und Burtons morbid, liebenswerter Welt, auch als eigenständiges Märchen, in dessen Sog man sich allzeit gut geborgen fühlt, da sich der Humor stets gegenüber dem Bösen durchzusetzen versteht.
So sei der Film allen nahegelegt, die subtile und intelligente Filmkost zu schätzen wissen, und sich auch Abseits des großen Radaus vorzüglich unterhalten lassen können.
mit 5
mit 5
mit 4
mit 3
bewertet am 28.06.13 um 16:34
Relativ langweiliger Häuserkampf, bei dem Etage um Etage erobert werden muß.
Dabei wurde der Plott bewußt auf die Eindimensionalität der 80er Jahre Actionfilme runtergedrosselt, so daß selbst der mit Grenzdebilität geschlagene Filmconnosseur nicht um sein Recht auf hirnlose Gewaltinszenierung betrogen wird.
So hangelt sich der Plott denn auch nicht etwa an einem Starkstromkabel der Hochspannung entlang, sondern schleppt sich behäbig von einer Splatterscene zur nächsten. Durch das Fehlen der Komplexität in der Handlung kommt daher zügig so etwas wie Langeweile auf, die kurzfristig nur einmal durch stylische Zeitlupenaufnahmen und besagte Maskenbildnerischen Untaten etwas aufgelockert wird.
Am Ende bleibt festzuhalten, daß die alleinigen Zutaten des 80er Jahre Actiongenres, ohne den unabdingbaren Nostalgieflair, nur noch für ein dünnes Süppchen Kinounterhaltung reichen.
Dabei wurde der Plott bewußt auf die Eindimensionalität der 80er Jahre Actionfilme runtergedrosselt, so daß selbst der mit Grenzdebilität geschlagene Filmconnosseur nicht um sein Recht auf hirnlose Gewaltinszenierung betrogen wird.
So hangelt sich der Plott denn auch nicht etwa an einem Starkstromkabel der Hochspannung entlang, sondern schleppt sich behäbig von einer Splatterscene zur nächsten. Durch das Fehlen der Komplexität in der Handlung kommt daher zügig so etwas wie Langeweile auf, die kurzfristig nur einmal durch stylische Zeitlupenaufnahmen und besagte Maskenbildnerischen Untaten etwas aufgelockert wird.
Am Ende bleibt festzuhalten, daß die alleinigen Zutaten des 80er Jahre Actiongenres, ohne den unabdingbaren Nostalgieflair, nur noch für ein dünnes Süppchen Kinounterhaltung reichen.
mit 3
mit 4
mit 4
mit 2
bewertet am 19.05.13 um 11:47
Am Anfang nett und ideenreich aber unlustig, danach schnullig und ideenreich aber leider immer noch unlustig.
Leider ein Spagat, der mal wieder nicht funktioniert. Die eigentliche Würze, die Reminiszens an die 8 Pixel Generation kann man zwar gelungen betrachten, der Humor sowie die Kerngeschichte ist für diese Generation jedoch deutlich zu infantil geraten. Und die Kleinkinder verstehen den ganzen Quark sowieso nicht, sondern kriegen evtl. grad mal Appetit, sich nach dem Film den Magen mit Süßwaren zuzukleistern.
Leider ein Spagat, der mal wieder nicht funktioniert. Die eigentliche Würze, die Reminiszens an die 8 Pixel Generation kann man zwar gelungen betrachten, der Humor sowie die Kerngeschichte ist für diese Generation jedoch deutlich zu infantil geraten. Und die Kleinkinder verstehen den ganzen Quark sowieso nicht, sondern kriegen evtl. grad mal Appetit, sich nach dem Film den Magen mit Süßwaren zuzukleistern.
mit 3
mit 5
mit 4
mit 2
bewertet am 19.05.13 um 11:24
An und für sich plumper Western, der jedoch sauber inszeniert wurde und ein paar erwähnenswerte Elemente besitzt.
Da wäre zum ersten die immer wieder erwähnte Tatsache, daß John Wayne und John Ford hier zum ersten mal kollaboriert und somit einen historischen Akt begangen haben.
Aber auch die anderen Schauspieler lassen sich nicht lumpen und liefern eine ordentliche Leistung ab. Insgesamt kann die Dynamik, die sich zwischen den einzelnen unterschiedlichen Charakteren entwickelt, als das eigentliche Salz in der Suppe betrachtet werden.
Die Rahmenhandlung bietet da weitaus weniger Gesprächsstoff: eine Gruppe Reisender will von A nach B. Die Reise steht unter keinem guten Stern, da ein Überfall des Indianerhäuptlings Geronimos und seiner Genossen fortwährend zu befürchten ist. So spaltet sich die Gruppe in zwei Parteien, von denen die eine umkehren will, die andere aber weiterreisen möchte. Da dem einen oder anderen aber in den jeweiligen Orten Ungemach bevorsteht, kommt es zu heitzigen Wortgefechten und Anfeindungen unter den Reisenden. Bis aber eine Entscheidung fällt, muß sich der Duke erst noch verlieben, eine Jungfrau ein Kind gebären und ein versoffener Arzt auf den Pfad der Tugend gebracht werden.
Als das wirkt zwar reizend und um Dramatik bemüht, jedoch auch etwas konstruiert.
Aufgepeppelt wird dieser altbackene Altherrenreigen dann jedoch wieder durch die ein oder andere mitgenommene imposante Westernkulisse des Monument Valley, einige wirklich halsbrecherische Pferdestunts, sowie eine handvoll richtig stimmungsvoller S/W Aufnahmen, die sogar gehobenen künstlerischen Ansprüchen genüge leisten.
Wäre Stagecoach nicht mit diesen kleinen Juwelen gespickt, würde der Film wahrscheinlich einfach nur so am Rande der Wahrnehmung dahinplätschern. Daran kann auch das klischeehafte Ende, an dem sich John Wayne an den Mördern seines Vaters und Bruders rächt, und sich damit gleichzeitig seine Hände von falschen Anschuldigungen reinwäscht, nichts ändern.
Inwieweit Stagecoach jetzt also filmhistorische Bedeutung hat, kann ich ebenso wenig beurteilen, wie seine Inszenierung, Charakterauswahl, Einbeziehung der Naturkulissen, usw. stilprägend für das Genre waren.
Am reinen Schauwert gemessen, ist dies allerdings einfach nur ein typischer Western, der vieles richtig macht, aber einen nicht vom Hocker haut.
Das Bild ist altersentsprechend ganz ordentlich. Hin und wieder etwas viel Filmkorn und Unschärfe, aber das geht für einen Film von 1939 durchaus in Ordnung.
Eine positive Überraschung stellt der Ton dar, welcher sich durch Präzision und durchgehender Verständlichkeit, im Gegensatz zum englischen Original, auszeichnet.
Nur die ein oder andere Synchronstimme hätte ein weniger albern ausfallen dürfen.
Da wäre zum ersten die immer wieder erwähnte Tatsache, daß John Wayne und John Ford hier zum ersten mal kollaboriert und somit einen historischen Akt begangen haben.
Aber auch die anderen Schauspieler lassen sich nicht lumpen und liefern eine ordentliche Leistung ab. Insgesamt kann die Dynamik, die sich zwischen den einzelnen unterschiedlichen Charakteren entwickelt, als das eigentliche Salz in der Suppe betrachtet werden.
Die Rahmenhandlung bietet da weitaus weniger Gesprächsstoff: eine Gruppe Reisender will von A nach B. Die Reise steht unter keinem guten Stern, da ein Überfall des Indianerhäuptlings Geronimos und seiner Genossen fortwährend zu befürchten ist. So spaltet sich die Gruppe in zwei Parteien, von denen die eine umkehren will, die andere aber weiterreisen möchte. Da dem einen oder anderen aber in den jeweiligen Orten Ungemach bevorsteht, kommt es zu heitzigen Wortgefechten und Anfeindungen unter den Reisenden. Bis aber eine Entscheidung fällt, muß sich der Duke erst noch verlieben, eine Jungfrau ein Kind gebären und ein versoffener Arzt auf den Pfad der Tugend gebracht werden.
Als das wirkt zwar reizend und um Dramatik bemüht, jedoch auch etwas konstruiert.
Aufgepeppelt wird dieser altbackene Altherrenreigen dann jedoch wieder durch die ein oder andere mitgenommene imposante Westernkulisse des Monument Valley, einige wirklich halsbrecherische Pferdestunts, sowie eine handvoll richtig stimmungsvoller S/W Aufnahmen, die sogar gehobenen künstlerischen Ansprüchen genüge leisten.
Wäre Stagecoach nicht mit diesen kleinen Juwelen gespickt, würde der Film wahrscheinlich einfach nur so am Rande der Wahrnehmung dahinplätschern. Daran kann auch das klischeehafte Ende, an dem sich John Wayne an den Mördern seines Vaters und Bruders rächt, und sich damit gleichzeitig seine Hände von falschen Anschuldigungen reinwäscht, nichts ändern.
Inwieweit Stagecoach jetzt also filmhistorische Bedeutung hat, kann ich ebenso wenig beurteilen, wie seine Inszenierung, Charakterauswahl, Einbeziehung der Naturkulissen, usw. stilprägend für das Genre waren.
Am reinen Schauwert gemessen, ist dies allerdings einfach nur ein typischer Western, der vieles richtig macht, aber einen nicht vom Hocker haut.
Das Bild ist altersentsprechend ganz ordentlich. Hin und wieder etwas viel Filmkorn und Unschärfe, aber das geht für einen Film von 1939 durchaus in Ordnung.
Eine positive Überraschung stellt der Ton dar, welcher sich durch Präzision und durchgehender Verständlichkeit, im Gegensatz zum englischen Original, auszeichnet.
Nur die ein oder andere Synchronstimme hätte ein weniger albern ausfallen dürfen.
mit 3
mit 3
mit 4
mit 1
bewertet am 22.04.13 um 11:55
Mad Circus ist sicherlich der Celluloid gewordene Traum aller Cineasten und "fantastisches Filmfest" Freaks.
Selten hat sich in den letzten Jahren ein Film von solch einer Virtuosität den Weg auf die Leinwand, bzw. in die Wohnzimmer gebahnt. Mad Circus bedient mit seiner kruden Mixtur aus Gewalt, Politik, Groteske und Wahnsinn so viele Aspekte des Kunstkinos, ohne dabei den roten Faden zu verlieren, daß dem Film sicherlich etwas geniales anhaftet.
Dabei überzeugt nicht zuletzt die ständig gegebene Doppeldeutigkeit der Protagonisten, deren Kampf um die Liebe paradoxer, oder eben auch logischer Weise, in einem Inferno aus Gewalt und Irrsinn mündet. Denn hinter den Fassaden der Clownmasken verbergen sich nicht nur einfache Ottonormalverbraucher, sondern in erster Linie verkrüppelte Seelen und emotionale Opfer des Franco Regimes. Der Kampf für das eigene Ideal entfesselt dementsprechend die mühsam unterdrückten dunklen Seiten der Seele und offenbart, stellvertretend für die Grausamkeit des Franco Regimes, die Perversität von Machtmißbrauch und Krieg. So stehen die Personen stellvertretend für den politischen und sozialen Wahnsinn der Francodiktatur und dessen Nachwehen. Die individuelle Schlacht um die von beiden geliebte Artistin Natalia, steht also auch stellvertretend für die Schlacht der Bürger um das geliebte Spanien und dokumentieren die Selbstzerfleischung des Landes eindringlich.
Dabei fällt auch immer wieder auch die prägnant eingesetzte Symbolik ins Gewicht, die die Aussagen des Films unterstützt und ihn mit einer Bedeutung auflädt, die über den reinen Schauwert hinausweist. Exemplarisch sei hier nur das überdiemensionale Kreuz erwähnt, in dessen Schatten der Wahnsinn beherbergt ist.
Aber auch wenn Iglesias entfesselter Wahnsinn, rein künstlerisch betrachtet, sicherlich als genreübergreifendes Meisterwerk betrachtet werden kann, welches die Möglichkeiten des Films bis weit über die gewohnten (meist amerikanischen) Grenzen hinaus auslotet, so hat mich der kompromißlose Einsatz der Brutalität und die Antipoetische Inszenierung doch eher abgeschreckt.
Denn wie schon in Perdita Durango arbeitet der spanische Regisseur mit einer Gefühlskälte, die mich abstößt und einer Gewaltinszenierung, die nicht immer nur zweckdienlich ist, sondern schon pathologische Züge trägt.
Auf Grund der dunklen Flecken, welche die Brutalität von Mad Circus auf die Seele zeichnet und des positiven Lebensgefühles unterdrückenden Effektes, gibts daher nur zwei Punkte.
Künstlerisch: Volle Punktzahl.
Selten hat sich in den letzten Jahren ein Film von solch einer Virtuosität den Weg auf die Leinwand, bzw. in die Wohnzimmer gebahnt. Mad Circus bedient mit seiner kruden Mixtur aus Gewalt, Politik, Groteske und Wahnsinn so viele Aspekte des Kunstkinos, ohne dabei den roten Faden zu verlieren, daß dem Film sicherlich etwas geniales anhaftet.
Dabei überzeugt nicht zuletzt die ständig gegebene Doppeldeutigkeit der Protagonisten, deren Kampf um die Liebe paradoxer, oder eben auch logischer Weise, in einem Inferno aus Gewalt und Irrsinn mündet. Denn hinter den Fassaden der Clownmasken verbergen sich nicht nur einfache Ottonormalverbraucher, sondern in erster Linie verkrüppelte Seelen und emotionale Opfer des Franco Regimes. Der Kampf für das eigene Ideal entfesselt dementsprechend die mühsam unterdrückten dunklen Seiten der Seele und offenbart, stellvertretend für die Grausamkeit des Franco Regimes, die Perversität von Machtmißbrauch und Krieg. So stehen die Personen stellvertretend für den politischen und sozialen Wahnsinn der Francodiktatur und dessen Nachwehen. Die individuelle Schlacht um die von beiden geliebte Artistin Natalia, steht also auch stellvertretend für die Schlacht der Bürger um das geliebte Spanien und dokumentieren die Selbstzerfleischung des Landes eindringlich.
Dabei fällt auch immer wieder auch die prägnant eingesetzte Symbolik ins Gewicht, die die Aussagen des Films unterstützt und ihn mit einer Bedeutung auflädt, die über den reinen Schauwert hinausweist. Exemplarisch sei hier nur das überdiemensionale Kreuz erwähnt, in dessen Schatten der Wahnsinn beherbergt ist.
Aber auch wenn Iglesias entfesselter Wahnsinn, rein künstlerisch betrachtet, sicherlich als genreübergreifendes Meisterwerk betrachtet werden kann, welches die Möglichkeiten des Films bis weit über die gewohnten (meist amerikanischen) Grenzen hinaus auslotet, so hat mich der kompromißlose Einsatz der Brutalität und die Antipoetische Inszenierung doch eher abgeschreckt.
Denn wie schon in Perdita Durango arbeitet der spanische Regisseur mit einer Gefühlskälte, die mich abstößt und einer Gewaltinszenierung, die nicht immer nur zweckdienlich ist, sondern schon pathologische Züge trägt.
Auf Grund der dunklen Flecken, welche die Brutalität von Mad Circus auf die Seele zeichnet und des positiven Lebensgefühles unterdrückenden Effektes, gibts daher nur zwei Punkte.
Künstlerisch: Volle Punktzahl.
mit 2
mit 4
mit 3
mit 1
bewertet am 16.04.13 um 11:30
Walk Hard ist in meinen Augen so etwas wie der inoffizielle Nachfolger von Spinal Tap.
Im Gegensatz zu der Kultikone wird in Walk Hard jedoch, anstatt die Karriere einer gesamten Band, die eines einzelnen Musikers durch die wichtigsten Dekaden der amerikanischen Musikgeschichte begleitet.
25 Jahre nach seinem letzten Bühnenauftritt, zieht es Dwayne Cox noch einmal in die große Konzerthalle. Er möchte hier, inzwischen gereifte 71 Jahre alt, musikalisch ein Resumee seines bewegten Musikerlebens ziehen. Kurz vor seinem Auftritt jedoch hält er inne und durchläuft im Geiste nochmals die wichtigsten Stationen seiner Karriere...
Nach einigen prägenden traumatischen Kindheitserlebnissen zieht es den 12jährigen Dewey Cox hinaus ins weite Amerika, um das Land mit seiner Musik zu erobern.
Dabei geht seine Reise durch die schnulzig-rockigen 50er, über die durch Proteste und Drogen geprägten 60er, bis weit hinein in die unter dem Discofieber siechenden 70er Jahre.
Dewey erlebte dabei die Jahrzehnte stellvertretend für die Klischees seiner Zeit: Von der obligatorisch zufälligen Entdeckung durch Musikproduzenten in den 50ern, während er den eigentlichen Star des Auftritts vertritt, über den Aufstieg zur Musiklegende und Hippieikone, bis zu einigen Drogenentzügen, nach denen er schließlich auf dem Abstellgleis landet und seine gescheiterten Comebacks ihn dazu nötigen, sein Lebensunterhalt mit einer würdelosen Trashtalkshow zu bestreiten.
Walk Hard ist aber weitaus mehr, als bloße Musikgeschichte im Zeitraffertempo. In erster Linie ist es ganz großer Klamauk. Das es dabei eine ganze Menge flacher Jokes, running Gags die nur um ihrer selbst Willen zu existieren scheinen, humoristischer Rohrkrepierer und platte Zoten gibt, ist meiner Meinung nach angesichts der liebevollen Inszenierung und auch der doch vorhandenen Handvoll zündenden, anarchischen Gags, durchaus verzeihbar.
Angefangen bei den Kostümen, über die Auswahl der Musik und nicht zuletzt durch die profunden Kenntnisse der jeweiligen Musikären, gelingt so eine Verneigung und Parodie auf das Musikbuisiness gleichzeitig. Ebenso wird der jeweilige Zeitcolorit stimmig eingefangen, was einfach Laune macht und unterhält.
Dabei gewinnt der Film zusätzlich an Klasse, je mehr man in der Musikgeschichte und Rockdokumentationen (Walk the Line soll fast unabdingbare Voraussetzung sein) bewandert ist. Erst so laßen sich beispielsweise die Späße rund um Bob Dylan, seine oftmals kryptischen Texte, sowie die Black Panther Bewegung, richtig verstehen. Auch sind Englischkenntnisse nicht von Nachteil, um die oft ironischen Liedtexte zu verstehen.
So beibt unterm Strich festzuhalten, daß Walk Hard wohl zuallererst grober Unfug ist, welcher sich auch nicht scheut, Abstecher ins seichte Gefilde des Slapsticks zu unternehmen. Auf Grund seiner detailverliebten und mit reichlich Herzblut getränkten Inszenierung jedoch, schafft der Film eine angenehm warmherzige Aura, die jeden Musikliebhaber mit einem Hang zur Nostalgie begeistern dürfte.
P.S.: Die Extended Version läuft NICHT!!! automatisch ab. Diese muß erst im Menue unter Extras (z.T. auch sehenswert: die Fake Interviews) abgerufen werden!!!
Im Gegensatz zu der Kultikone wird in Walk Hard jedoch, anstatt die Karriere einer gesamten Band, die eines einzelnen Musikers durch die wichtigsten Dekaden der amerikanischen Musikgeschichte begleitet.
25 Jahre nach seinem letzten Bühnenauftritt, zieht es Dwayne Cox noch einmal in die große Konzerthalle. Er möchte hier, inzwischen gereifte 71 Jahre alt, musikalisch ein Resumee seines bewegten Musikerlebens ziehen. Kurz vor seinem Auftritt jedoch hält er inne und durchläuft im Geiste nochmals die wichtigsten Stationen seiner Karriere...
Nach einigen prägenden traumatischen Kindheitserlebnissen zieht es den 12jährigen Dewey Cox hinaus ins weite Amerika, um das Land mit seiner Musik zu erobern.
Dabei geht seine Reise durch die schnulzig-rockigen 50er, über die durch Proteste und Drogen geprägten 60er, bis weit hinein in die unter dem Discofieber siechenden 70er Jahre.
Dewey erlebte dabei die Jahrzehnte stellvertretend für die Klischees seiner Zeit: Von der obligatorisch zufälligen Entdeckung durch Musikproduzenten in den 50ern, während er den eigentlichen Star des Auftritts vertritt, über den Aufstieg zur Musiklegende und Hippieikone, bis zu einigen Drogenentzügen, nach denen er schließlich auf dem Abstellgleis landet und seine gescheiterten Comebacks ihn dazu nötigen, sein Lebensunterhalt mit einer würdelosen Trashtalkshow zu bestreiten.
Walk Hard ist aber weitaus mehr, als bloße Musikgeschichte im Zeitraffertempo. In erster Linie ist es ganz großer Klamauk. Das es dabei eine ganze Menge flacher Jokes, running Gags die nur um ihrer selbst Willen zu existieren scheinen, humoristischer Rohrkrepierer und platte Zoten gibt, ist meiner Meinung nach angesichts der liebevollen Inszenierung und auch der doch vorhandenen Handvoll zündenden, anarchischen Gags, durchaus verzeihbar.
Angefangen bei den Kostümen, über die Auswahl der Musik und nicht zuletzt durch die profunden Kenntnisse der jeweiligen Musikären, gelingt so eine Verneigung und Parodie auf das Musikbuisiness gleichzeitig. Ebenso wird der jeweilige Zeitcolorit stimmig eingefangen, was einfach Laune macht und unterhält.
Dabei gewinnt der Film zusätzlich an Klasse, je mehr man in der Musikgeschichte und Rockdokumentationen (Walk the Line soll fast unabdingbare Voraussetzung sein) bewandert ist. Erst so laßen sich beispielsweise die Späße rund um Bob Dylan, seine oftmals kryptischen Texte, sowie die Black Panther Bewegung, richtig verstehen. Auch sind Englischkenntnisse nicht von Nachteil, um die oft ironischen Liedtexte zu verstehen.
So beibt unterm Strich festzuhalten, daß Walk Hard wohl zuallererst grober Unfug ist, welcher sich auch nicht scheut, Abstecher ins seichte Gefilde des Slapsticks zu unternehmen. Auf Grund seiner detailverliebten und mit reichlich Herzblut getränkten Inszenierung jedoch, schafft der Film eine angenehm warmherzige Aura, die jeden Musikliebhaber mit einem Hang zur Nostalgie begeistern dürfte.
P.S.: Die Extended Version läuft NICHT!!! automatisch ab. Diese muß erst im Menue unter Extras (z.T. auch sehenswert: die Fake Interviews) abgerufen werden!!!
mit 5
mit 4
mit 4
mit 4
bewertet am 16.04.13 um 11:23
Neue Variation des allseits bekannten vom Saulus zum Paulus Themas.
Skrupelloser Jäger entdeckt in im tasmanischen Hinterland sein Herz. Zeigt Martin David (Dafoe) zu Beginn noch wenig Emotionen und erklärt sich ohne Wimperzucken dazu bereit, den als ausgestorben geltenden Tasmanischen Tiger zu killen, um ihm seine Gene zu entreißen und der Bioindustrie zuzuschachern, taut der Eisbrocken in der Aura der bezaubernden Herbergsmutter und ihrer zweier kleinen Kinder immer mehr auf. Die Mutter, eine alternative Umweltaktivistin, ist natürlich Solo, und nach dem Verschwinden des Ehemannes in der tasmanischen Wildniss, mit Sedidativa ruhiggestellt.
So sieht sich der Einzelgänger, wohl oder übel genötigt, sich um den desolaten Zustand seiner Herberge, sowie seiner Einwohner, zu kümmern. Zwischen den Exkursionen in der kargen und rauhen Landschaft des Hinterlandes, wird Martin so mehr und mehr in das Familiengeflecht der Aussteigerfamilie hineingezogen. Dies geschieht jedoch so behutsam und so scheu, daß es zu einer wirklichen Annährung zunächst nicht kommt. Zu stark ist Martins Charakterpanzer und zu loyal sein Arbeitsethos, als daß er eine Kehrtwende seines Lebensstiles im Handumdrehen bewerkstelligen könnte. Erst eine fatale Wendung der Geschehnisse am Ende des Filmes bringt Martin die erhoffte Läuterung. Doch da ist es bereits zu spät....
The Hunter ist kein großes Drama und auch kein atemberaubendes Naturspektakel. Vielmehr handelt es sich dabei um ein ruhig inszeniertes Stück Erzählkino. Es gibt hier keine große Eskalation der Geschehnisse oder dramatische Jagdscenen. Vielmehr wird völlig unaufgeregt dargestellt, wie Martin durch die Natur streift, Fallen legt und sie frustiert immer wieder kontrolliert. Sein symbiotisches, völlig sachlich unromantisches Verhältniss zur Natur steht hier im Vordergrund. Nicht die karge Schönheit der Umgebung fasziniert ihn. Es geht einzig und allein ums Überleben und Jagen.
Die Ruhe des semidokumentarischen Stils überträgt sich auch auf den Zuschauer. Auch wenn der Film nicht als Einschlafmittel geeignet ist, unterhält er jedoch nur bedingt. Daran ändern auch Sam Neill als chancenloser Nebenbuhler Martins, sowie eine wilde Horde Waldarbeiter, die aus Angst vor vermeidlichen Umweltaktivisten immer mal wieder in grimmigen Aktionismus verfallen, nichts.
Das trotz der vertanenen Gelegenheit, die Story durch etwas mehr Dynamik in den Geschehnissen oder spaktakulärere Naturbilder, auch auf Kosten des Authentizitismus, aufzumotzen, trotzdem noch unterhält, liegt vor allem in der geglückten Besetzung, die es durchgehend versteht, daß Interesse des Publikums zu fesseln. Neben William Dafoe, dem man ohne mit der Wimper zu zucken abnimmt, den Großteil seines Lebens neben Rambo im Busch verbracht zu haben, überzeugen vor allem die beiden Sprößlinge Lucys, die mit einer Natürlichkeit punkten, die weitab von einer entfesselten Hyperaktivität ala Richie Rich sind.
So ist The Hunter unterm Strich vielleicht ein geeignetes Medikament zur Entschleunigung des Alltages aber wegen des lethargischen Erzähltempos sicherlich das falsche Präperat, um einen gebrauchten Tag mit einem filmischen Highlight aufzupeppeln.
Skrupelloser Jäger entdeckt in im tasmanischen Hinterland sein Herz. Zeigt Martin David (Dafoe) zu Beginn noch wenig Emotionen und erklärt sich ohne Wimperzucken dazu bereit, den als ausgestorben geltenden Tasmanischen Tiger zu killen, um ihm seine Gene zu entreißen und der Bioindustrie zuzuschachern, taut der Eisbrocken in der Aura der bezaubernden Herbergsmutter und ihrer zweier kleinen Kinder immer mehr auf. Die Mutter, eine alternative Umweltaktivistin, ist natürlich Solo, und nach dem Verschwinden des Ehemannes in der tasmanischen Wildniss, mit Sedidativa ruhiggestellt.
So sieht sich der Einzelgänger, wohl oder übel genötigt, sich um den desolaten Zustand seiner Herberge, sowie seiner Einwohner, zu kümmern. Zwischen den Exkursionen in der kargen und rauhen Landschaft des Hinterlandes, wird Martin so mehr und mehr in das Familiengeflecht der Aussteigerfamilie hineingezogen. Dies geschieht jedoch so behutsam und so scheu, daß es zu einer wirklichen Annährung zunächst nicht kommt. Zu stark ist Martins Charakterpanzer und zu loyal sein Arbeitsethos, als daß er eine Kehrtwende seines Lebensstiles im Handumdrehen bewerkstelligen könnte. Erst eine fatale Wendung der Geschehnisse am Ende des Filmes bringt Martin die erhoffte Läuterung. Doch da ist es bereits zu spät....
The Hunter ist kein großes Drama und auch kein atemberaubendes Naturspektakel. Vielmehr handelt es sich dabei um ein ruhig inszeniertes Stück Erzählkino. Es gibt hier keine große Eskalation der Geschehnisse oder dramatische Jagdscenen. Vielmehr wird völlig unaufgeregt dargestellt, wie Martin durch die Natur streift, Fallen legt und sie frustiert immer wieder kontrolliert. Sein symbiotisches, völlig sachlich unromantisches Verhältniss zur Natur steht hier im Vordergrund. Nicht die karge Schönheit der Umgebung fasziniert ihn. Es geht einzig und allein ums Überleben und Jagen.
Die Ruhe des semidokumentarischen Stils überträgt sich auch auf den Zuschauer. Auch wenn der Film nicht als Einschlafmittel geeignet ist, unterhält er jedoch nur bedingt. Daran ändern auch Sam Neill als chancenloser Nebenbuhler Martins, sowie eine wilde Horde Waldarbeiter, die aus Angst vor vermeidlichen Umweltaktivisten immer mal wieder in grimmigen Aktionismus verfallen, nichts.
Das trotz der vertanenen Gelegenheit, die Story durch etwas mehr Dynamik in den Geschehnissen oder spaktakulärere Naturbilder, auch auf Kosten des Authentizitismus, aufzumotzen, trotzdem noch unterhält, liegt vor allem in der geglückten Besetzung, die es durchgehend versteht, daß Interesse des Publikums zu fesseln. Neben William Dafoe, dem man ohne mit der Wimper zu zucken abnimmt, den Großteil seines Lebens neben Rambo im Busch verbracht zu haben, überzeugen vor allem die beiden Sprößlinge Lucys, die mit einer Natürlichkeit punkten, die weitab von einer entfesselten Hyperaktivität ala Richie Rich sind.
So ist The Hunter unterm Strich vielleicht ein geeignetes Medikament zur Entschleunigung des Alltages aber wegen des lethargischen Erzähltempos sicherlich das falsche Präperat, um einen gebrauchten Tag mit einem filmischen Highlight aufzupeppeln.
mit 3
mit 4
mit 3
mit 3
bewertet am 14.04.13 um 13:26
Sicherlich entbehrt der Film nicht einer gewissen Poesie und kann mit Elementen des gothischen Gruselfilms, sowie mit einigen phantastischen Stilmitteln aufwarten.
Im Grunde genommen handelt es sich aber um eine klassische Märchenerzählung, die sich in der Struktur nicht grundlegend von den Märchen und Fabeln der Gebrüder Grimm unterscheidet.
Unterschiede lassen sich jedoch gelegentlich in der Ernsthaftigkeit der Inszenierung ausmachen.
Dort wo die Gebrüder Grimm noch den kindlichen Ton anschlagen, wird hier mehr eine erwachsenere Form der Konversation bevorzugt.
Weshalb sich aber Die Schöne und die Bestie als Klassiker unter den Märchenverfilmungen etabliert hat, bleibt einem nach Sichtung des Filmmaterials größtenteils schleierhaft. Vielleicht, weil ja ein großer Name (Cocteau) hinter dem Ganzen steckt und man meint, sich per se vor dem großen Talent verneigen zu müßen.
Vielleicht rührt aber auch der obligatorische Sieg der wahren Liebe und des Guten, sowie die finale Bestrafung des stereotypisch Bösen, das Herzilein des ein oder anderen Cineasten zu Tränen und versetzt ihn in das verlorene, paradiesische Traumreich der Kindheit zurück......?
Anders läßt sich diese cineastische Reputation aus heutiger Sicht wohl kaum erklären. Denn im Grunde genommen, ist die Inszenierung, nüchtern gesehen, als eher schlicht und hölzern zu benennen. Auch den vielgerühmten Charme von Der Schönen und der Bestie erreichen tschechische Märchenfilme der 60er und 70er ohne Mühe allemal.
Und das am Fließband....Und das in Farbe.....
Im Grunde genommen handelt es sich aber um eine klassische Märchenerzählung, die sich in der Struktur nicht grundlegend von den Märchen und Fabeln der Gebrüder Grimm unterscheidet.
Unterschiede lassen sich jedoch gelegentlich in der Ernsthaftigkeit der Inszenierung ausmachen.
Dort wo die Gebrüder Grimm noch den kindlichen Ton anschlagen, wird hier mehr eine erwachsenere Form der Konversation bevorzugt.
Weshalb sich aber Die Schöne und die Bestie als Klassiker unter den Märchenverfilmungen etabliert hat, bleibt einem nach Sichtung des Filmmaterials größtenteils schleierhaft. Vielleicht, weil ja ein großer Name (Cocteau) hinter dem Ganzen steckt und man meint, sich per se vor dem großen Talent verneigen zu müßen.
Vielleicht rührt aber auch der obligatorische Sieg der wahren Liebe und des Guten, sowie die finale Bestrafung des stereotypisch Bösen, das Herzilein des ein oder anderen Cineasten zu Tränen und versetzt ihn in das verlorene, paradiesische Traumreich der Kindheit zurück......?
Anders läßt sich diese cineastische Reputation aus heutiger Sicht wohl kaum erklären. Denn im Grunde genommen, ist die Inszenierung, nüchtern gesehen, als eher schlicht und hölzern zu benennen. Auch den vielgerühmten Charme von Der Schönen und der Bestie erreichen tschechische Märchenfilme der 60er und 70er ohne Mühe allemal.
Und das am Fließband....Und das in Farbe.....
mit 3
mit 3
mit 2
mit 3
bewertet am 13.04.13 um 11:07
Ja, so muß Actionkino der 80er Jahre aussehen.
Etwas schrottig in der Inszenierung, Gewaltexzesse bis hart an die Parodiegrenze, wenig Frauenzeugs und ein Plott, der direkt zur Sache kommt.
Das der Zahn der Zeit auch an dieser 80er Ikone genagt hat, läßt sich aber auch hier nicht ganz verleugnen und ist am ehesten an der plumpen Art der Rachestory und dem etwas holprigen Storyverlauf ausmachen. Trotzdem punktet Robocop auch heute noch mit einem solide besetzten Cast, der Paul Weller bei seiner gradlinieg und ohne psychologischen Schnickschnack ausgeführten Misson, Detroit von seinem Krebsgeschwür zu kurieren, wohlwollend oder sabotierend, zur Seite steht.
Schade nur, daß das Bild, besonders zum Filmbeginn, sehr zu wünschen übrig läßt und förmlich nach einer remasterten Neuauflage schreit.
Etwas schrottig in der Inszenierung, Gewaltexzesse bis hart an die Parodiegrenze, wenig Frauenzeugs und ein Plott, der direkt zur Sache kommt.
Das der Zahn der Zeit auch an dieser 80er Ikone genagt hat, läßt sich aber auch hier nicht ganz verleugnen und ist am ehesten an der plumpen Art der Rachestory und dem etwas holprigen Storyverlauf ausmachen. Trotzdem punktet Robocop auch heute noch mit einem solide besetzten Cast, der Paul Weller bei seiner gradlinieg und ohne psychologischen Schnickschnack ausgeführten Misson, Detroit von seinem Krebsgeschwür zu kurieren, wohlwollend oder sabotierend, zur Seite steht.
Schade nur, daß das Bild, besonders zum Filmbeginn, sehr zu wünschen übrig läßt und förmlich nach einer remasterten Neuauflage schreit.
mit 4
mit 3
mit 3
mit 1
bewertet am 30.03.13 um 14:31
Zeitgerechtes Update des Arnieklassikers in monumentalen Kulissen und postapokalyptischem Brachialdesign.
Zeitgerecht heißt aber hier nicht unbedingt konsequente Weiterentwicklung und Verfeinerung des subtilen Kernes der Geschichte, nämlich dem Vexierspiel zwischen Realität und Einbildung, sondern vielmehr die populäre Reduzierung auf die Sehgewohnheiten und Ansprüche des heutigen, meist jungen, Kinopublikums.
Die philosophische Gretchenfrage, ist unsere Welt überhaupt "Real" oder wird sie uns vom Bewußtsein bloß vorgegaukelt und werden "wir" bloß geträumt, tritt jetzt weit in den Hintergrund, um anderen Aspekten, zumeist denen der bloßen Unterhaltung, Platz zu machen.
So bietet die neue Version von Total Recall zwar keinerlei Berechtigung zur philosophischen Auseinandersetzung mit unserer Wahrnehmung (wer ist sich z.b. schon bewußt, daß sebst Licht, also Helligkeit, keineswegs von der Sonne, sondern vom Bewußtsein erzeugt wird?) an, oder ermutigt uns zu schwindelerregenden Gedankenspielen. Auf Grund seiner ausgefeilten Optik und Spezialeffekte, sowie der regengeschwängerten, düster-gedrückten Atmosphäre im Blade Runner Stil, unterhält das Update jedoch über weite Strecken.
Hat man erst einmal geschluckt, daß diese Neuverfilmung also kaum Tiefgang hat und daher ein wenig seelenlos daherkommt, läßt sich dieses gut 2 stündige Katz und Maus Spiel recht gut verkraften. Zum Ende hin geht dem Regisseur jedoch etwas die Puste aus und die Hatz mündet in einer Endlosballerei, die etwas mehr Ideenreichtum hätte vertragen können. Auch kann man dem Film indgesamt nur eine mäßig ausgeprägte Spannungskurve zugestehen, was wohl der Hauptgrund für eine Verweigerung höherer filmischer Ehren sein dürfte. So richtig gepackt und mitgeschliffen wird hier wohl kein aufrichtiger Zuschauer.
Da die Schauspieler ihre Rollen , soweit es ihnen in dieser Kulissenschlacht möglich ist, als eigenständige Charaktere interpretieren zu wissen und nicht nur als eindimensionale Abziehbilder fungieren, steht also auch von dieser Seite einem harmlosen Filmabend, gewürzt mit einer hömeopathischen Dosis Philosophie, nichts im Wege.
Zeitgerecht heißt aber hier nicht unbedingt konsequente Weiterentwicklung und Verfeinerung des subtilen Kernes der Geschichte, nämlich dem Vexierspiel zwischen Realität und Einbildung, sondern vielmehr die populäre Reduzierung auf die Sehgewohnheiten und Ansprüche des heutigen, meist jungen, Kinopublikums.
Die philosophische Gretchenfrage, ist unsere Welt überhaupt "Real" oder wird sie uns vom Bewußtsein bloß vorgegaukelt und werden "wir" bloß geträumt, tritt jetzt weit in den Hintergrund, um anderen Aspekten, zumeist denen der bloßen Unterhaltung, Platz zu machen.
So bietet die neue Version von Total Recall zwar keinerlei Berechtigung zur philosophischen Auseinandersetzung mit unserer Wahrnehmung (wer ist sich z.b. schon bewußt, daß sebst Licht, also Helligkeit, keineswegs von der Sonne, sondern vom Bewußtsein erzeugt wird?) an, oder ermutigt uns zu schwindelerregenden Gedankenspielen. Auf Grund seiner ausgefeilten Optik und Spezialeffekte, sowie der regengeschwängerten, düster-gedrückten Atmosphäre im Blade Runner Stil, unterhält das Update jedoch über weite Strecken.
Hat man erst einmal geschluckt, daß diese Neuverfilmung also kaum Tiefgang hat und daher ein wenig seelenlos daherkommt, läßt sich dieses gut 2 stündige Katz und Maus Spiel recht gut verkraften. Zum Ende hin geht dem Regisseur jedoch etwas die Puste aus und die Hatz mündet in einer Endlosballerei, die etwas mehr Ideenreichtum hätte vertragen können. Auch kann man dem Film indgesamt nur eine mäßig ausgeprägte Spannungskurve zugestehen, was wohl der Hauptgrund für eine Verweigerung höherer filmischer Ehren sein dürfte. So richtig gepackt und mitgeschliffen wird hier wohl kein aufrichtiger Zuschauer.
Da die Schauspieler ihre Rollen , soweit es ihnen in dieser Kulissenschlacht möglich ist, als eigenständige Charaktere interpretieren zu wissen und nicht nur als eindimensionale Abziehbilder fungieren, steht also auch von dieser Seite einem harmlosen Filmabend, gewürzt mit einer hömeopathischen Dosis Philosophie, nichts im Wege.
mit 3
mit 5
mit 4
mit 2
bewertet am 28.03.13 um 11:35
Netter Reanimationsversuch Stallones, die Tugenden des 80er Jahre Actionkinos vor der Versenkung in die Filmhistorischen Katakomben zu retten.
80er Jahre Action hieß vor allem: dünner Plott, Vendetta bis zum abwinken, Kawumm in 10facher Überdosis, ein Waffenarsenal, daß zu Lieferengpäßen im Kreml führte und ein Ehrebegriff, der den Lanzer Heftchen oder inbrünstigen Nationalhymnen entliehen zu sein schien.
So versucht auch The Expendables folgerichtig mit einer gradliniegen Story, die auf eine komplexe Konstellation von Personen oder komplizierte Verflechtung von Handlungssträngen weitestgehend verzichtet, zu punkten. Kommt es versehentlich doch einmal in Ansätzen zu seelischem Tiefgang, wie etwa Strathams Monolog über seine im Krieg verlorene Seele, beweist Stallone auf Grund der stereotypischen Plumpheit des Gesagten nur wieder einmal eindrucksvoll sein limitiertes Talent für dramatische Momente und feine Charakterzeichnung.
Kann man diese peinlichen Ausrutscher ins dramatische Fach aber noch leicht verkraften, sind sie doch Stallones Markenzeichen, fällt es aber umso schwerer, die unnötige Brutalität und den aggressiven Schnitt, bei dem Auge dem Geschehen kaum noch folgen kann, zu entschuldigen.
Wenn man sich schon für einen Actionfilm im Retrogewand entscheided und sich auf seine Grundlagen mit viel Handmade Action und Explosionsorgien besinnt, sollte man bein seinen Leisten bleiben und auf modernen Schnick Schnack verzichten, der die Liebhaber des 80er Jahre Kinos vergrault.
Dadurch, daß der Showdown in einer nicht mehr zu differenzierenden Baller- und Gewaltorgie mündet, dessen brutaler Schnitt nur noch wenig Differnzierung des Gesehenen erlaubt, wird das ambitionierte Vorhaben, eine totgeglaubte Ära des Actionfilms wiederzubeleben, leider endgültig zu Grabe getragen.
Vom grandiosen und vielbesungenen Cast sollte man sich allerdings auch nicht blenden lassen. Bis auf Stallone und Stratham besitzen alle anderen Mimen ausschließlich Statistenstatus. Lediglich ins Spiel gebracht um den einen oder anderen ultramegahammercoolen One- oder Twoliner von den Adrenalin oder Botox (Rourke) durchtränkten Lippen perlen zu lassen. Diese weisen zwar eine gewisse Spielart der Selbstironie auf, zünden aber nicht wirklich. Sie wirken um Effekt bemüht und daher sehr gewollt.
Auch vermag es Stallone nicht, den Cast zu einer homogenen Truppe mit zwischenmenschlicher Brisanz zusammenzuschweißen. Jeder versucht vielmehr seine knappbemessene Sendezeit wie ein pupertierender Wackelkandidat von DSDS, sich in bestmöglicher Pose zu präsentieren, um seiner ablaufenden Hollywoodära noch ein versöhnendes Visitenkärtchen zu hinterlassen.
Aber drauf gepfiffen. Eine griechische Tragödie hat hier niemand wirklich erwartet und es beruhigt immerhin auch ein wenig, daß es in dieser schnelllebigen Zeit Dinge gibt, die sich nicht verändern. Und sei es auch nur die Stallones begrenztes Talent zum Geschichten erzählen.
Aber welche Leistung soll man auch von einem Gehirn erwarten, welches in einem Körper gefangen ist, an dem sich die Adern außerhalb der Organe befinden und deßhalb unter chronischer Sauerstoffunterversorgung leiden muß?????
80er Jahre Action hieß vor allem: dünner Plott, Vendetta bis zum abwinken, Kawumm in 10facher Überdosis, ein Waffenarsenal, daß zu Lieferengpäßen im Kreml führte und ein Ehrebegriff, der den Lanzer Heftchen oder inbrünstigen Nationalhymnen entliehen zu sein schien.
So versucht auch The Expendables folgerichtig mit einer gradliniegen Story, die auf eine komplexe Konstellation von Personen oder komplizierte Verflechtung von Handlungssträngen weitestgehend verzichtet, zu punkten. Kommt es versehentlich doch einmal in Ansätzen zu seelischem Tiefgang, wie etwa Strathams Monolog über seine im Krieg verlorene Seele, beweist Stallone auf Grund der stereotypischen Plumpheit des Gesagten nur wieder einmal eindrucksvoll sein limitiertes Talent für dramatische Momente und feine Charakterzeichnung.
Kann man diese peinlichen Ausrutscher ins dramatische Fach aber noch leicht verkraften, sind sie doch Stallones Markenzeichen, fällt es aber umso schwerer, die unnötige Brutalität und den aggressiven Schnitt, bei dem Auge dem Geschehen kaum noch folgen kann, zu entschuldigen.
Wenn man sich schon für einen Actionfilm im Retrogewand entscheided und sich auf seine Grundlagen mit viel Handmade Action und Explosionsorgien besinnt, sollte man bein seinen Leisten bleiben und auf modernen Schnick Schnack verzichten, der die Liebhaber des 80er Jahre Kinos vergrault.
Dadurch, daß der Showdown in einer nicht mehr zu differenzierenden Baller- und Gewaltorgie mündet, dessen brutaler Schnitt nur noch wenig Differnzierung des Gesehenen erlaubt, wird das ambitionierte Vorhaben, eine totgeglaubte Ära des Actionfilms wiederzubeleben, leider endgültig zu Grabe getragen.
Vom grandiosen und vielbesungenen Cast sollte man sich allerdings auch nicht blenden lassen. Bis auf Stallone und Stratham besitzen alle anderen Mimen ausschließlich Statistenstatus. Lediglich ins Spiel gebracht um den einen oder anderen ultramegahammercoolen One- oder Twoliner von den Adrenalin oder Botox (Rourke) durchtränkten Lippen perlen zu lassen. Diese weisen zwar eine gewisse Spielart der Selbstironie auf, zünden aber nicht wirklich. Sie wirken um Effekt bemüht und daher sehr gewollt.
Auch vermag es Stallone nicht, den Cast zu einer homogenen Truppe mit zwischenmenschlicher Brisanz zusammenzuschweißen. Jeder versucht vielmehr seine knappbemessene Sendezeit wie ein pupertierender Wackelkandidat von DSDS, sich in bestmöglicher Pose zu präsentieren, um seiner ablaufenden Hollywoodära noch ein versöhnendes Visitenkärtchen zu hinterlassen.
Aber drauf gepfiffen. Eine griechische Tragödie hat hier niemand wirklich erwartet und es beruhigt immerhin auch ein wenig, daß es in dieser schnelllebigen Zeit Dinge gibt, die sich nicht verändern. Und sei es auch nur die Stallones begrenztes Talent zum Geschichten erzählen.
Aber welche Leistung soll man auch von einem Gehirn erwarten, welches in einem Körper gefangen ist, an dem sich die Adern außerhalb der Organe befinden und deßhalb unter chronischer Sauerstoffunterversorgung leiden muß?????
mit 3
mit 4
mit 4
mit 3
bewertet am 28.03.13 um 11:24
Leider ist immer weniger James Bond drin, wo James Bond drauf steht.
Leider weicht die unbekümmerte Naivität des Agenten einem zunehmend komplexeren und problembehafteten Charakter, der das Zuschauen weg von exotischer Unterhaltung hinüber in die aktuelle Wirklichkeit führt.
Statt Realitätsflucht wird jetzt die Konfrontation mit der Realität gesucht.
War ich zu Beginn von Skyfall noch ganz von Kopf bis Fuß auf 007 eingestellt, mußte ich im zunehmenden Verlauf feststellen, daß Bond nicht mehr der locker-flockige Sonntagnachmittagspaß ist, an den man sich im Lauf der Jahrzehnte gewöhnt und den man wie ein Stückchen Sahnetörtchen ins Herz geschloßen hatte.
Nach Batman, Iron Man, X-Man etc. hat nun also auch Bond-Man so etwas wie ein kleines Beginning spendiert bekommen. Zwar bleibt dem Zuschauer erspart, wie klein James zum ersten mal der Haushälterin unter den Rock schielt oder mit 9 Jahren den ersten nächtlichen Ruhestörer im Namen Ihrer Majestät kalt macht, dafür wohnen wir dem Edelagenten jedoch bei, wie er sich den Schatten seiner Kindheit stellen muß, die alle mit dem düsteren Anwesen Skyfall verknüpft sind.
Bis man dem großen Finale beiwohnt, in dem das Anwesen in einem Feuerball von der Landkarte radiert wird und Bond sich so seiner damit verbundenen Altlasten entledigen kann, muß sich der geneigte Zuschauer bis dahin das ein oder andere mal fragen, weßhalb sich der Regisseur nicht mal zur Abwechslung etwas mit der Bond Historie beschäftigt hat, sondern stattdessen zuviel Zeit mit dem Studium grichischer Dramen verbracht zu haben scheint.
Fast alle Atribute, die dazu beigetragen haben, das Franchise über die Jahre hinweg zu den Sternstunden der Kinounterhaltung zu machen, werden genüßlich demontiert, um dem Faible des Regisseures für bedeutungsschwangere, mit niederdrückender Schwere und morbiden Symbolismus aufgeladenen Stoffen gerecht zu werden.
Auch wenn Skyfall mit einer klassischen Verfolgungsjagd in gewohnter Bond Manier beginnt, wird mit dem alsbaldigen in Kauf nehmen von Bonds Tod durch M, die Bondtradition des leicht beschwingten Grundtenors zu Gunsten eines Abdriften in die Gefilde der schwarzen Serie, wo Gut und Schlecht nicht mehr sich ausschließende Polaritäten bilden, sondern meist unter ein und demselben Hut vereint sind, und die Protagonisten mit ihrem Schicksalen hadern, abgelöst.
Das mag im realitätsbezogenen Dramabereich ja alles noch seine Berechtigung haben, der Erfolg der Bond Reihe zeichnete sich aber immer durch einen unverwüstlichen, positiven Charme aus, sowie einem Helden, dessen Esprit des Frauenhelden und Weltenretters den Zuschauer immer mit einem angenehmen Gefühl aus den Lichtspielhäusern entlassen hat.
All diese elementaren Eigenschaften des Übermenschen Bond, mit all den damit verbundenen Übertreibungen, die nur das Kino bieten kann, weichen einer nüchternen Wirklichkeit, so als ob uns der Regisseur Sam Mendes bitten würde aufzuwachen: Hey Jungs, Bond war nur ein schöner Traum. Laßt Euch nicht weiter verschaukeln. War ja nett, jetzt guckt Euch aber mal die Wirklichkeit an!
Wenn nicht James Bond auf der Verpackung stehen würde, und der übergroße Nimbus von 50 Jahren Filmgeschichte über der ganzen Veranstaltung schweben würde, hätte dieser halbgare Action-Drama Mix wahrscheinlich eine Halbwertzeit von max. 3 Monaten. Zu wenig Action und zuviel Zwischenmenschliches füllen die 140 min. nämlich keinesfalls mit purer Spannung auf. Zwischenzeitlich keimt sogar mehrmals Langeweile auf, weil man der Meinung war, dem Film und den Charakteren mehr "Tiefe" geben, und deßhalb ein wenig Psychoanalyse betreiben zu müßen.
Na klar kann man nicht über ein halbes Jahrhundert immer die gleiche Leier präsentieren. Irgendwann darf ein Martini auch mal geschüttelt und nicht gerührt werden.
Sich dem Trend oberflächlicher Blockbuster mit inhaltlicher Komplexität entgegenzustemmen, ist ja an sich nichts verwerfliches, hat meiner Meinung nach aber halt im James Bond nichts zu suchen. Für mich soll James Bond immer der Augenzwinkernde, souveräne, stets gutgelaunte Frauenschwarm sein, der jeder 15 Jährige gerne wäre.
Die Kälte und der Zynismus dieses säkularisierungsgleichen Ernüchterungsprozeßes laßen einen ratlos und enttäuscht zurück, bergen aber auch die Hoffnung, daß James nach seiner Katharsis wie ein Phönix im nächsten Teil aufersteht und, befreit von den Trümmern der Vergangenheit, wieder zu seiner alten Laune zurückfindet.
Denn wenn diese Abwärtsspirale in immer dystopischere Welten und ihrer Bewohner nicht durchbrochen wird, spielt der 25. James Bond demnächst in einer postapokalyptischen Welt und er kämpft gegen den Terminator.
Die Produzenten mögen sich da zwar die Hände reiben, aber wirklich wollen kann dies doch niemand
Also zurück zu den Wurzeln. Denn Daniel Craig ist mit Sicherheit nicht die schlechteste Verkörperung der alten Bond Tugenden...
Leider weicht die unbekümmerte Naivität des Agenten einem zunehmend komplexeren und problembehafteten Charakter, der das Zuschauen weg von exotischer Unterhaltung hinüber in die aktuelle Wirklichkeit führt.
Statt Realitätsflucht wird jetzt die Konfrontation mit der Realität gesucht.
War ich zu Beginn von Skyfall noch ganz von Kopf bis Fuß auf 007 eingestellt, mußte ich im zunehmenden Verlauf feststellen, daß Bond nicht mehr der locker-flockige Sonntagnachmittagspaß ist, an den man sich im Lauf der Jahrzehnte gewöhnt und den man wie ein Stückchen Sahnetörtchen ins Herz geschloßen hatte.
Nach Batman, Iron Man, X-Man etc. hat nun also auch Bond-Man so etwas wie ein kleines Beginning spendiert bekommen. Zwar bleibt dem Zuschauer erspart, wie klein James zum ersten mal der Haushälterin unter den Rock schielt oder mit 9 Jahren den ersten nächtlichen Ruhestörer im Namen Ihrer Majestät kalt macht, dafür wohnen wir dem Edelagenten jedoch bei, wie er sich den Schatten seiner Kindheit stellen muß, die alle mit dem düsteren Anwesen Skyfall verknüpft sind.
Bis man dem großen Finale beiwohnt, in dem das Anwesen in einem Feuerball von der Landkarte radiert wird und Bond sich so seiner damit verbundenen Altlasten entledigen kann, muß sich der geneigte Zuschauer bis dahin das ein oder andere mal fragen, weßhalb sich der Regisseur nicht mal zur Abwechslung etwas mit der Bond Historie beschäftigt hat, sondern stattdessen zuviel Zeit mit dem Studium grichischer Dramen verbracht zu haben scheint.
Fast alle Atribute, die dazu beigetragen haben, das Franchise über die Jahre hinweg zu den Sternstunden der Kinounterhaltung zu machen, werden genüßlich demontiert, um dem Faible des Regisseures für bedeutungsschwangere, mit niederdrückender Schwere und morbiden Symbolismus aufgeladenen Stoffen gerecht zu werden.
Auch wenn Skyfall mit einer klassischen Verfolgungsjagd in gewohnter Bond Manier beginnt, wird mit dem alsbaldigen in Kauf nehmen von Bonds Tod durch M, die Bondtradition des leicht beschwingten Grundtenors zu Gunsten eines Abdriften in die Gefilde der schwarzen Serie, wo Gut und Schlecht nicht mehr sich ausschließende Polaritäten bilden, sondern meist unter ein und demselben Hut vereint sind, und die Protagonisten mit ihrem Schicksalen hadern, abgelöst.
Das mag im realitätsbezogenen Dramabereich ja alles noch seine Berechtigung haben, der Erfolg der Bond Reihe zeichnete sich aber immer durch einen unverwüstlichen, positiven Charme aus, sowie einem Helden, dessen Esprit des Frauenhelden und Weltenretters den Zuschauer immer mit einem angenehmen Gefühl aus den Lichtspielhäusern entlassen hat.
All diese elementaren Eigenschaften des Übermenschen Bond, mit all den damit verbundenen Übertreibungen, die nur das Kino bieten kann, weichen einer nüchternen Wirklichkeit, so als ob uns der Regisseur Sam Mendes bitten würde aufzuwachen: Hey Jungs, Bond war nur ein schöner Traum. Laßt Euch nicht weiter verschaukeln. War ja nett, jetzt guckt Euch aber mal die Wirklichkeit an!
Wenn nicht James Bond auf der Verpackung stehen würde, und der übergroße Nimbus von 50 Jahren Filmgeschichte über der ganzen Veranstaltung schweben würde, hätte dieser halbgare Action-Drama Mix wahrscheinlich eine Halbwertzeit von max. 3 Monaten. Zu wenig Action und zuviel Zwischenmenschliches füllen die 140 min. nämlich keinesfalls mit purer Spannung auf. Zwischenzeitlich keimt sogar mehrmals Langeweile auf, weil man der Meinung war, dem Film und den Charakteren mehr "Tiefe" geben, und deßhalb ein wenig Psychoanalyse betreiben zu müßen.
Na klar kann man nicht über ein halbes Jahrhundert immer die gleiche Leier präsentieren. Irgendwann darf ein Martini auch mal geschüttelt und nicht gerührt werden.
Sich dem Trend oberflächlicher Blockbuster mit inhaltlicher Komplexität entgegenzustemmen, ist ja an sich nichts verwerfliches, hat meiner Meinung nach aber halt im James Bond nichts zu suchen. Für mich soll James Bond immer der Augenzwinkernde, souveräne, stets gutgelaunte Frauenschwarm sein, der jeder 15 Jährige gerne wäre.
Die Kälte und der Zynismus dieses säkularisierungsgleichen Ernüchterungsprozeßes laßen einen ratlos und enttäuscht zurück, bergen aber auch die Hoffnung, daß James nach seiner Katharsis wie ein Phönix im nächsten Teil aufersteht und, befreit von den Trümmern der Vergangenheit, wieder zu seiner alten Laune zurückfindet.
Denn wenn diese Abwärtsspirale in immer dystopischere Welten und ihrer Bewohner nicht durchbrochen wird, spielt der 25. James Bond demnächst in einer postapokalyptischen Welt und er kämpft gegen den Terminator.
Die Produzenten mögen sich da zwar die Hände reiben, aber wirklich wollen kann dies doch niemand
Also zurück zu den Wurzeln. Denn Daniel Craig ist mit Sicherheit nicht die schlechteste Verkörperung der alten Bond Tugenden...
mit 3
mit 4
mit 3
mit 3
bewertet am 11.03.13 um 12:10
Typisches Drogendrama, daß trotz deutlich älterer Vorlage irgendwie im Fahrwasser von Braking Bad dümpelt, ohne jedoch dem Genre neue Akzente hinzuzufügen.
Gute Drogenmenschen werden durch böse Drogenmenschen gezwungen ihre Ethik zu verraten, um zu überleben.
Obwohl der Film gut unterhält, funktioniert die Polarität der lebensbejahenden südkalifornischen Atmosphäre mit ihren schönen Menschen, der positiven Grundstimmung aus freier Liebe, Dauerkiffen und professionellen Hippietum, und der brutalen Gegenwelt der mexikanischen Drogenkartellen nur bedingt. Der Wechsel in die jeweiligen emotionalen Gegenwelten erzeugt in diesem Fall kein Spannungsfeld, sondern ein Bruch der in Erzählstruktur, der sich nicht stimmig in den Rythmus des Filmes einfügt.
Unangenehm fällt auch der unausgegorene Mix aus Nerdtum, Weltenretter, Guerillakieger, Hippie und Geschäftsmännern, der den Protagonisten mehr Charaktereigenschaften zuschreibt, als in eine Person unterzubringen sind, auf. Mit solchen Eigenschaften überfrachtet, kann man sich eigentlich auch gleich direkt bei den Avangers bewerben. Bei realen Personen wird allerdings schon im Ansatz die Glaubwürdigkeit zerstört. Entweder, man entscheidet sich für ein "reales" Drama und bleibt bei Schusters Leisten, oder aber man erschafft einen Helden und spielt "Die Hard". Die Unentschloßenheit des Stiles aber verwirrt eher, als daß sie als geglücktes Crossover Experiment bezeichnet werden kann.
Auch nimmt man bei aller Brutalität der Kartells, Salma Hayek die Rolle des eiskalten, lenkenden Kopfes zu kaum ab. Hin und hergerissen zwischen Drogengeschäften und der Sehnsucht nach Gefühlen, wird sie ihrer Aufgabe nicht gerecht und schwebt so im schauspielerischen Niemandsland. Obwohl hübsch anzuschauen, wäre hier eine reifere Mime besser am Platz gewesen.
Durch die breite Fächerung und vermeintliche Komplexität, sowie dem Widerspruch zwischen Person und Rolle, verwässert der Film im Laufe zunehmend. Hier hätte eine klare Fokussierung auf die Befreiung der gemeinsamen Freundin (Blake Lively) gut getan. Die Verzettelung aber z.b. in die nerdgesteuerte Computerwelt, in der man mit 2 Mausklicks die gesamte Schöpfungsgeschichte umschreiben kann, nervt ein wenig und klaut den Film den Nimbus des Authentizismus.
So schlingert Savages 128 Min. zwischen Lifestyle Reportage, Liebesdrama, Psychogram und Actionfilm hin und her, ohne diese Komponenten jedoch durch eine einheitliche Grundstruktur oder durch einen glaubhaften Charakter zusammenzuschweißen.
Auch wegen dem Fehlen emotionaler oder geistiger Tiefen, fällt es dem Zuschauer schwer, tiefer in den Film einzudringen und ihn als in irgendeinem Belange als relevant einzustufen.
Positiv ist jedoch zu vernehmen, daß in Taylor Kitsch ein echter Schauspieler zu stecken scheint, was man ja nach John Carter nicht unbedingt vermuten konnte, und das Ende des Films, bei der sich die Biographien in durch Zeit und Raum wabernde Phantome auflösen und Lust auf die große weite Welt machen.
Gute Drogenmenschen werden durch böse Drogenmenschen gezwungen ihre Ethik zu verraten, um zu überleben.
Obwohl der Film gut unterhält, funktioniert die Polarität der lebensbejahenden südkalifornischen Atmosphäre mit ihren schönen Menschen, der positiven Grundstimmung aus freier Liebe, Dauerkiffen und professionellen Hippietum, und der brutalen Gegenwelt der mexikanischen Drogenkartellen nur bedingt. Der Wechsel in die jeweiligen emotionalen Gegenwelten erzeugt in diesem Fall kein Spannungsfeld, sondern ein Bruch der in Erzählstruktur, der sich nicht stimmig in den Rythmus des Filmes einfügt.
Unangenehm fällt auch der unausgegorene Mix aus Nerdtum, Weltenretter, Guerillakieger, Hippie und Geschäftsmännern, der den Protagonisten mehr Charaktereigenschaften zuschreibt, als in eine Person unterzubringen sind, auf. Mit solchen Eigenschaften überfrachtet, kann man sich eigentlich auch gleich direkt bei den Avangers bewerben. Bei realen Personen wird allerdings schon im Ansatz die Glaubwürdigkeit zerstört. Entweder, man entscheidet sich für ein "reales" Drama und bleibt bei Schusters Leisten, oder aber man erschafft einen Helden und spielt "Die Hard". Die Unentschloßenheit des Stiles aber verwirrt eher, als daß sie als geglücktes Crossover Experiment bezeichnet werden kann.
Auch nimmt man bei aller Brutalität der Kartells, Salma Hayek die Rolle des eiskalten, lenkenden Kopfes zu kaum ab. Hin und hergerissen zwischen Drogengeschäften und der Sehnsucht nach Gefühlen, wird sie ihrer Aufgabe nicht gerecht und schwebt so im schauspielerischen Niemandsland. Obwohl hübsch anzuschauen, wäre hier eine reifere Mime besser am Platz gewesen.
Durch die breite Fächerung und vermeintliche Komplexität, sowie dem Widerspruch zwischen Person und Rolle, verwässert der Film im Laufe zunehmend. Hier hätte eine klare Fokussierung auf die Befreiung der gemeinsamen Freundin (Blake Lively) gut getan. Die Verzettelung aber z.b. in die nerdgesteuerte Computerwelt, in der man mit 2 Mausklicks die gesamte Schöpfungsgeschichte umschreiben kann, nervt ein wenig und klaut den Film den Nimbus des Authentizismus.
So schlingert Savages 128 Min. zwischen Lifestyle Reportage, Liebesdrama, Psychogram und Actionfilm hin und her, ohne diese Komponenten jedoch durch eine einheitliche Grundstruktur oder durch einen glaubhaften Charakter zusammenzuschweißen.
Auch wegen dem Fehlen emotionaler oder geistiger Tiefen, fällt es dem Zuschauer schwer, tiefer in den Film einzudringen und ihn als in irgendeinem Belange als relevant einzustufen.
Positiv ist jedoch zu vernehmen, daß in Taylor Kitsch ein echter Schauspieler zu stecken scheint, was man ja nach John Carter nicht unbedingt vermuten konnte, und das Ende des Films, bei der sich die Biographien in durch Zeit und Raum wabernde Phantome auflösen und Lust auf die große weite Welt machen.
mit 3
mit 4
mit 4
mit 2
bewertet am 24.02.13 um 12:03
Roger Corman proudly presents: Star Crash
Oder doch eher Star Crap?
Denn was Regisseur Luigi Cozzi (Kotzi?) 1978 abgeleiefert hat, hat mit seriösem Filmschaffen einfach nichts mehr zu tun. Stattdessen werden eine luftig bekleidete Badenixe (C. Munro) und ihr Weltraumknappe kreuz und quer durch ein quitschbuntes Discouniversum gejagt, um selbiges vor dem Schrecken der Galaxie, dem dunklen Graf Zarth Arn, zu beschützen.
Dieser hat eine Monsterwaffe entwickelt, die so groß und so gefährlich ist, daß sie nur im inneren eines Planetenunter aufbewahrt werden kann.
Nachdem diese Waffe letzendlich eleminiert werde konnte, muß nur noch der Erzbösewicht auf seinem Raumschiff vernichtet werden.
Dies kann jedoch nur gelingen, indem man einen Angrif der 4. Dimension wagt: Den sogenannten Star Crash...
Was hier dem Zuschauer vorgesetzt wird, spottet jeder Beschreibung und macht jahrzehntelange Versuche, das Sci-Fi Genre als ernsthafte, wissenschaftliche Grundsätze ehrende Disziplin zu etablieren, auf einen Schlag zunichte.
In bester Freidenkermanier werden so ziemlich alle physikalische Grundsätze mit Pauken und Trompeten über Bord gejagt, nur um den Fortgang der Geschichte möglichst unkompliziert zu gestalten. Und wenns dann mal so gar nicht weitergeht, fällt dem Imperator halt eben nebenbei ein, er könne ja doch einfach die Zeit anhalten, um ihn und seine Gefährten aus dem größten Schlamassel zu manövrieren. Imperator wird man ja schließlich nicht einfach so. Da braucht's schon das gewiße Etwas.
Aber auch die Tricktechniker im Studio sind da nicht weniger kreativ: hält ein wackerer Kämpfer für die Gute Sache mal sein Lasergewehr nicht gerade in die Richtung, wo der Genosse Komparse seinen theaterreifen Abgang zur Belustigung des geneigten Publikums feilbietet, muß der Laserschuß den Gewehrlauf schon mal im 45 Grad Winkel verlassen, damits wieder hinhaut. Habs gesehen! Und auch die monumentalen Stop Motion Schlachten scheinen aus Kostengründen an die Bastellgruppe des Käthe Kollwitz Behindertenheims ausgegliedert worden zu sein. Die Qualität der Animationen ist nämlich hundserbärmlich und jede Sandmännchenfolge ist aufwendiger produziert worden.
Um aber wirklich jeden Vauxpas aufzuzählen, müßte man die Bewertung auf epische Dimension auswälzen, so umfangreich sind die Logiklöcher und so drittklassig sind die Raumschiffdesigns. Wobei das Drehbuch in maximal 20min., inkl. langer Kaffepause fertiggestellt sein dürfte und die Kleinteile für den Raumschiffbau beim gemütlichen Bummel durch den Baumarkt eher willkürlich in den Einkaufswagen der Special Effekt Experten, die tricktechnisch den Flash Gorden Filmen aus den 30er Jahren gehuldigt zu haben scheinen, gewandert sein dürften.
Aber man soll ja nicht unken. Star Crash macht genau deshalb einfach unglaublich Spaß und rangiert auf inoffiziellen Trashkultfilmen ganz weit oben! Wo bei qualitativ ähnlichen Machwerken, wie z.b. den Godzillafilmen, noch eine gewiße Selbstironie zugesprochen werden kann, nimmt sich Star Crash trotz aller desaströsen Zutaten tatsächlich noch ernst und kann daher nur als ein einziger gewaltiger Schiß in den Ofen bezeichnet werden.
Bei allem Unvermögen des gesamten Produktionsteams, muß man aber dennoch auf der andren Seite, auch einmal den Hut ziehen. Es braucht schon eine Menge Humor und Kreativität, um sich so einen Schrott überhaupt mal auszudenken. Denn wo findet man heute noch die Chuzpe, so non chalant sämtliche Niveaulevels zu unterschreiten und einen Specialeffektfilm zu machen, wenn man nicht weiß, wie man Effekte professionell produziert und ein Weltraumepos zu inszenieren, wenn man nicht das geringste Gefühl für Dialoge und Dramatik besitzt? Wo, wenn nicht bei Star Crash, dient als Himmel die Beleuchtungsanlage des örtlichen Discobetriebes, wenn nicht sogar des Nachtclubs? In welchem anderen Werken, außer denen Rosa von Praunheims, ist das Firnament sonst noch mit rosa Planeten behangen? Wo sonst dürfen weibliche Sklaven noch kürbisgroße, hochradioaktive Plutoniumkugeln mit eigener Muskelkraft in den Planetenreaktor befördern? Wo, bitteschön, gibt es sonst noch ein Drehbuch, daß so substanzlos ist, daß es sogar von schwarzen Löchern nicht erfaßt werden kann? Wo, wenn nicht in STAR CRASH?
Aber genau aus diesen Widersprüchen ergibt sich das unnachahmliche Trashgefühl: Obwohl alles von A bis Z hahnebüchen und himmelsschreiend ist, kämpft sich das Filmteam tapfer und wacker um Ernsthaftigkeit bemüht, bis zum Ende durch und gibt sich somit bis zum erlösenden Schluß den Anschein seriöser Arbeit. Augen zu und durch! Rettet, was zu retten ist! Und dann bloß weg hier...
Mann, was hat das zugucken Spaß gemacht
Danke Roger, Danke!
Oder doch eher Star Crap?
Denn was Regisseur Luigi Cozzi (Kotzi?) 1978 abgeleiefert hat, hat mit seriösem Filmschaffen einfach nichts mehr zu tun. Stattdessen werden eine luftig bekleidete Badenixe (C. Munro) und ihr Weltraumknappe kreuz und quer durch ein quitschbuntes Discouniversum gejagt, um selbiges vor dem Schrecken der Galaxie, dem dunklen Graf Zarth Arn, zu beschützen.
Dieser hat eine Monsterwaffe entwickelt, die so groß und so gefährlich ist, daß sie nur im inneren eines Planetenunter aufbewahrt werden kann.
Nachdem diese Waffe letzendlich eleminiert werde konnte, muß nur noch der Erzbösewicht auf seinem Raumschiff vernichtet werden.
Dies kann jedoch nur gelingen, indem man einen Angrif der 4. Dimension wagt: Den sogenannten Star Crash...
Was hier dem Zuschauer vorgesetzt wird, spottet jeder Beschreibung und macht jahrzehntelange Versuche, das Sci-Fi Genre als ernsthafte, wissenschaftliche Grundsätze ehrende Disziplin zu etablieren, auf einen Schlag zunichte.
In bester Freidenkermanier werden so ziemlich alle physikalische Grundsätze mit Pauken und Trompeten über Bord gejagt, nur um den Fortgang der Geschichte möglichst unkompliziert zu gestalten. Und wenns dann mal so gar nicht weitergeht, fällt dem Imperator halt eben nebenbei ein, er könne ja doch einfach die Zeit anhalten, um ihn und seine Gefährten aus dem größten Schlamassel zu manövrieren. Imperator wird man ja schließlich nicht einfach so. Da braucht's schon das gewiße Etwas.
Aber auch die Tricktechniker im Studio sind da nicht weniger kreativ: hält ein wackerer Kämpfer für die Gute Sache mal sein Lasergewehr nicht gerade in die Richtung, wo der Genosse Komparse seinen theaterreifen Abgang zur Belustigung des geneigten Publikums feilbietet, muß der Laserschuß den Gewehrlauf schon mal im 45 Grad Winkel verlassen, damits wieder hinhaut. Habs gesehen! Und auch die monumentalen Stop Motion Schlachten scheinen aus Kostengründen an die Bastellgruppe des Käthe Kollwitz Behindertenheims ausgegliedert worden zu sein. Die Qualität der Animationen ist nämlich hundserbärmlich und jede Sandmännchenfolge ist aufwendiger produziert worden.
Um aber wirklich jeden Vauxpas aufzuzählen, müßte man die Bewertung auf epische Dimension auswälzen, so umfangreich sind die Logiklöcher und so drittklassig sind die Raumschiffdesigns. Wobei das Drehbuch in maximal 20min., inkl. langer Kaffepause fertiggestellt sein dürfte und die Kleinteile für den Raumschiffbau beim gemütlichen Bummel durch den Baumarkt eher willkürlich in den Einkaufswagen der Special Effekt Experten, die tricktechnisch den Flash Gorden Filmen aus den 30er Jahren gehuldigt zu haben scheinen, gewandert sein dürften.
Aber man soll ja nicht unken. Star Crash macht genau deshalb einfach unglaublich Spaß und rangiert auf inoffiziellen Trashkultfilmen ganz weit oben! Wo bei qualitativ ähnlichen Machwerken, wie z.b. den Godzillafilmen, noch eine gewiße Selbstironie zugesprochen werden kann, nimmt sich Star Crash trotz aller desaströsen Zutaten tatsächlich noch ernst und kann daher nur als ein einziger gewaltiger Schiß in den Ofen bezeichnet werden.
Bei allem Unvermögen des gesamten Produktionsteams, muß man aber dennoch auf der andren Seite, auch einmal den Hut ziehen. Es braucht schon eine Menge Humor und Kreativität, um sich so einen Schrott überhaupt mal auszudenken. Denn wo findet man heute noch die Chuzpe, so non chalant sämtliche Niveaulevels zu unterschreiten und einen Specialeffektfilm zu machen, wenn man nicht weiß, wie man Effekte professionell produziert und ein Weltraumepos zu inszenieren, wenn man nicht das geringste Gefühl für Dialoge und Dramatik besitzt? Wo, wenn nicht bei Star Crash, dient als Himmel die Beleuchtungsanlage des örtlichen Discobetriebes, wenn nicht sogar des Nachtclubs? In welchem anderen Werken, außer denen Rosa von Praunheims, ist das Firnament sonst noch mit rosa Planeten behangen? Wo sonst dürfen weibliche Sklaven noch kürbisgroße, hochradioaktive Plutoniumkugeln mit eigener Muskelkraft in den Planetenreaktor befördern? Wo, bitteschön, gibt es sonst noch ein Drehbuch, daß so substanzlos ist, daß es sogar von schwarzen Löchern nicht erfaßt werden kann? Wo, wenn nicht in STAR CRASH?
Aber genau aus diesen Widersprüchen ergibt sich das unnachahmliche Trashgefühl: Obwohl alles von A bis Z hahnebüchen und himmelsschreiend ist, kämpft sich das Filmteam tapfer und wacker um Ernsthaftigkeit bemüht, bis zum Ende durch und gibt sich somit bis zum erlösenden Schluß den Anschein seriöser Arbeit. Augen zu und durch! Rettet, was zu retten ist! Und dann bloß weg hier...
Mann, was hat das zugucken Spaß gemacht
Danke Roger, Danke!
mit 4
mit 3
mit 2
mit 2
bewertet am 05.02.13 um 12:13
Routiniert, jedoch ohne nennenswerte Tief- oder Höhepunkte spulen Arnie und Belushie ihre Buddy Klischees ab.
Arnie, der wortkarge, unterkühlte Einzelkämpfer aus dem Ostblock und Belushie, der dauerquasselnde Repräsentant des freien Amerikas, müßen sich zusammenraufen, um einen entwichenen russischen Bösewicht in Chicago Dingfest zu machen.
Gradlinieg folgt Zote auf Ballerei und Ballerei auf Zote, bis am Ende alle Bösen tot sind und unsere beiden töften Polizisten ihre Sympathien füreinander entdecken.
Wie die meisten Arnie Filme aus der Zeit, haben sich der fade Plott und die mürben Gags nicht über die Jahre halten können und befinden sich auf den besten Weg, von der 80er Retroecke direkt in die dunklen Verliese des Filmmuseums durchgereicht zu werden, wo sie in Ruhe und Ehre verrotten und sich aus dem kollektiven filmhistorischen Gedächtnis verabschieden dürfen.
Das Bild ist absolut mies, kann mit der Restauration von Der City Hai zu keinem Zeitpunkt mithalten und trübt dadurch den Gesamteindruck durchgehend.
Arnie, der wortkarge, unterkühlte Einzelkämpfer aus dem Ostblock und Belushie, der dauerquasselnde Repräsentant des freien Amerikas, müßen sich zusammenraufen, um einen entwichenen russischen Bösewicht in Chicago Dingfest zu machen.
Gradlinieg folgt Zote auf Ballerei und Ballerei auf Zote, bis am Ende alle Bösen tot sind und unsere beiden töften Polizisten ihre Sympathien füreinander entdecken.
Wie die meisten Arnie Filme aus der Zeit, haben sich der fade Plott und die mürben Gags nicht über die Jahre halten können und befinden sich auf den besten Weg, von der 80er Retroecke direkt in die dunklen Verliese des Filmmuseums durchgereicht zu werden, wo sie in Ruhe und Ehre verrotten und sich aus dem kollektiven filmhistorischen Gedächtnis verabschieden dürfen.
Das Bild ist absolut mies, kann mit der Restauration von Der City Hai zu keinem Zeitpunkt mithalten und trübt dadurch den Gesamteindruck durchgehend.
mit 3
mit 2
mit 3
mit 2
bewertet am 23.01.13 um 11:10
Hat Ähnlichkeit mit "Exile on Main Street" von den Stones. Wahrlich nicht ihr bestes Album, enthält aber die Essenz.
Auch der City Hai kann sich nicht in die erste Liga der Arniewerke spielen, trumpft aber mit allem auf, was seine Actionfilme der 80er zu bieten hatten: plumpe Story (150kg Muskelmasse als unauffälliger Undercoveragent!??), übertriebene Gewaltscenenen und ein, zwei kantige Sprüche, unterschwellige Ironie, eine kleine Lovestorybeilage, Antiklamotten und Designsünden, und ein von konserativen Werten durchtränkter Protagonist aus der Steiermark, dessen bemitleidenswertes mimisches und gestisches Trauerspiel ihn unlängst zum Ehrenmitglied von Kraftwerk werden ließ.
Ales in allem also ein "klassischer" Arnie, der gemäßigt unterhält, jedoch ohne Duftmarken in die eine oder andere Richtung zu setzen.
Auch der City Hai kann sich nicht in die erste Liga der Arniewerke spielen, trumpft aber mit allem auf, was seine Actionfilme der 80er zu bieten hatten: plumpe Story (150kg Muskelmasse als unauffälliger Undercoveragent!??), übertriebene Gewaltscenenen und ein, zwei kantige Sprüche, unterschwellige Ironie, eine kleine Lovestorybeilage, Antiklamotten und Designsünden, und ein von konserativen Werten durchtränkter Protagonist aus der Steiermark, dessen bemitleidenswertes mimisches und gestisches Trauerspiel ihn unlängst zum Ehrenmitglied von Kraftwerk werden ließ.
Ales in allem also ein "klassischer" Arnie, der gemäßigt unterhält, jedoch ohne Duftmarken in die eine oder andere Richtung zu setzen.
mit 3
mit 4
mit 4
mit 2
bewertet am 23.01.13 um 10:46
Wie immer bei modernen Stop Motion Filmen: Hut ab vor dem schieren Detailreichtum und dem kunstvollen Produktionsdesign.
Leider ist das Resultat der unbändigen Bastelfreude jedoch das einzig wirklich zufriedenstellende bei Paranorman. Denn abgesehen von den Figuren, die so einfältige Gesichter haben wie billig animierte TV Produktionen , und denen jene liebenswürdige Schrulligkeit der Aardman Produktionen abgeht, fällt hier besonders das extrem niedrige Witzniveau nachteilig ins Gewicht. Zwar gibt es hin und wieder ein paar geistreiche Referenzen an das Horror- und Zombiegenre, sowie verstreut aufzufindene zündende Gags, insgesamt lahmt die Geschichte jedoch zu sehr an ihrer Harmloiskeit und (Klein)Kindgerechten Inszenierung.
Wenn man schon mit einer Zombieparodie in den Ring steigt, sollte sich auch der Humor alterstechnisch an das Publikum richten, daß legalerweise Zugang zu den umstrittenen Machwerken hat. So aber enttäuscht der Film durch nette Kinderreien und humoristischen Fehlzündungen auf fast ganzer Strecke. Der moralinsaure Schluß, bei dem auf fremdschämerische Art und Weise über Haß und Vergebung und die heilende Kraft der Liebe referiert wird, bildet somit leider auch den erzählerischen Tiefpunkt der Geschichte. Ich habe Sonderpädagogik und Bürgerkunde einfach nicht mehr nötig!
Somit hat auch hier mal wieder der Versuch, einen Film zu machen, der Groß und Klein, gleichermaßen erfreut, nicht gefruchtet. Die Kleinen werden die Parodien nicht verstehen, und den Großen ist der halbgare Budenzauber einfach zu lahm.
So überwiegt am Ende die Enttäuschung darüber, daß die Gelegenheit verpaßt wurde, dem durch schiefes und windiges Kulissendesign hervorragend vorbereiteten Rahmen, mit einer entsprechend gehaltvollen Geschichte und knauzigen Charakteren zu füllen.
Das Bild ist sauber, die Räumlichkeit ist gegeben. Aber wie bei den meisten Filmem, merkt man schon nach 20 min. gar nicht mehr, daß man 3D guckt, wenn nicht der ein oder andere Pop Out Effekt einen daran erinnern würde.
Leider ist das Resultat der unbändigen Bastelfreude jedoch das einzig wirklich zufriedenstellende bei Paranorman. Denn abgesehen von den Figuren, die so einfältige Gesichter haben wie billig animierte TV Produktionen , und denen jene liebenswürdige Schrulligkeit der Aardman Produktionen abgeht, fällt hier besonders das extrem niedrige Witzniveau nachteilig ins Gewicht. Zwar gibt es hin und wieder ein paar geistreiche Referenzen an das Horror- und Zombiegenre, sowie verstreut aufzufindene zündende Gags, insgesamt lahmt die Geschichte jedoch zu sehr an ihrer Harmloiskeit und (Klein)Kindgerechten Inszenierung.
Wenn man schon mit einer Zombieparodie in den Ring steigt, sollte sich auch der Humor alterstechnisch an das Publikum richten, daß legalerweise Zugang zu den umstrittenen Machwerken hat. So aber enttäuscht der Film durch nette Kinderreien und humoristischen Fehlzündungen auf fast ganzer Strecke. Der moralinsaure Schluß, bei dem auf fremdschämerische Art und Weise über Haß und Vergebung und die heilende Kraft der Liebe referiert wird, bildet somit leider auch den erzählerischen Tiefpunkt der Geschichte. Ich habe Sonderpädagogik und Bürgerkunde einfach nicht mehr nötig!
Somit hat auch hier mal wieder der Versuch, einen Film zu machen, der Groß und Klein, gleichermaßen erfreut, nicht gefruchtet. Die Kleinen werden die Parodien nicht verstehen, und den Großen ist der halbgare Budenzauber einfach zu lahm.
So überwiegt am Ende die Enttäuschung darüber, daß die Gelegenheit verpaßt wurde, dem durch schiefes und windiges Kulissendesign hervorragend vorbereiteten Rahmen, mit einer entsprechend gehaltvollen Geschichte und knauzigen Charakteren zu füllen.
Das Bild ist sauber, die Räumlichkeit ist gegeben. Aber wie bei den meisten Filmem, merkt man schon nach 20 min. gar nicht mehr, daß man 3D guckt, wenn nicht der ein oder andere Pop Out Effekt einen daran erinnern würde.
mit 3
mit 4
mit 4
mit 3
bewertet am 13.01.13 um 11:46
Altbewährtes Katz- und Mausspiel mit erstklassiger Besetzung.
Auch wenn die Heat das Räuber und Gendarmgenre zum x-ten male wiederkäut, hat Michael Mann hier etwas ganz besonderes geschaffen. Er begeht nicht den Fehler Scorseses, seine Akteure bis an die Grenze zur Parodie zum Overacting- und Improvisationsinferno zu hetzen, sondern setzt ganz auf die ernsthaften Facetten der Schauspielikonen De Niro und Pacino, und reduziert ihre Gesten auf das Wesentliche.
Hier wird passenderweise nicht im Tarantinostyle persifliert und gekalauert, sondern es geht von Beginn an ernst zu Sache. Todernst.
Ähnlich wie bei Leones "Lied vom Tod" umkreisen sich hier die Protagonisten wie zwei angestachelte Kampfhähne gegenseitig und mit äußerster Vorsicht umeinander und halten bis zum entscheidenden Moment lebensrettenden Sicherheitabstand.
Lediglich im zuge einer Beschattungsaktion kommt es in einem Kaffee zum kurzen persönlichen Kontakt, wo sich die beiden Einzelgänger vorsichtig beschnuppern und ihre unmißverständlichen Positionen gegenüber äußern können.
Trotz gegenseitiger Versicherung, den anderen im Ernstfall zu erschießen, spürt der Zuschauer aber sofort die Seelenverwandtschaft und den Respekt der beiden Alphamännchen füreinander. Ihre charakterliche Ähnlichkeit geht Hand in Hand mit der Loyalität gegenüber dem Beruf und der Professionalität ihrer Vorgehensweise. Ihre Charaktereigenschaften und Eignungen sind so ähnlich, daß sie ohne weiteres ihre Rollen tauschen könnten. Beide brauchen das Adrenalin und die Jagd.
Interessanterweise führt aber genau dieser Jagdinstinkt Pacino unbeirrbar immer wieder in die Einsamkeit und zum Scheitern seiner Beziehungen, während De Niro im Begriff ist, sein überlebenswichtiges Credo "Häng dein Herz an nichts, was du nicht in 30 sek. hinter dir lassen kannst", sowie seinen Jagdtrieb, für eine gerade begonnene Liebesaffäre aufzugeben.
Genau dieses Loslassen der Beziehung ist es letztendlich auch, daß Pacino den "Sieg" über de Niro beschert. Dieser findet durch das Festhalten an seiner Beziehung nur den Tod. "Sieg", hier gleichbedeutend mit Überleben in dieser Welt des Verbrechens, ist nur ohne Liebe denkbar, lautet nach 170min. schließlich das traurige Resümee dieses Films.
Aber nicht allein das Duell der beiden Schauspielgenies macht den Film sehenswert.
Auch die perfekt besetzten Nebenrollen der Gangster (John Voigt, Danny Trejo, etc...), sowie die ebenbürtige Ehefrau Pacinos, die liebenswerte Freundin de Niros sowie der aalglatte Geldwäscher Van Dyke (Fichtner) runden das Ensemble auf höchstem Niveau ab.
Nicht zu vergeßen und maßgeblich für den Erfolg des Films verantwortlich ist dabei der kompromißlose und harte Erzählstil Manns, der sich nicht mit Faxen wie endlosen Monologen vor der Hinrichtung abgibt, sondern unmittelbar, knallhart und eiskalt zur Sache kommt. Manns Dramaturgie läuft von Beginn an schnurstracks ohne eine überflüßige Scene oder ein zuviel gesprochenes Wort auf das unvermeindliche Finale zu. Diese inszenatorische Vorgehensweise bindet den Zuschauer maximal an den Film und gönnt ihm keinen Moment Ablenkung. Dies führt zu einer intensiven Verschmelzung mit der Geschichte.
Sogar selbst die Frauen, obwohl emanzipiert und selbstbewußt, erhalten kaum Gelegenheit ein charakterliches Eigenleben zu entwickeln, sondern haben sich storydienlich der Entwicklung der Psychogramme der beiden Protagonisten unterzuordnen.
Getragen wird dieser kalte Erzählstil, der wahrscheinlich reines Männerkino ist, von sphärischer und trancelastiger Elektronikmusik. Diese gibt die melancholische und entfremdet-vereinsamte Welt in der sich die Handlung bewegt, in stimmungsvollen Klangbögen wieder.
Da der Film nicht arm an Actionlastigen Sequencen und spannenden Passagen ist, verwundert das Ende jedoch ein wenig. Klar ist , daß Mann sich von allem überflüßigen Ballast trennen, und die Aufmerksamkeit ungeteilt auf das Duell zwischen Pacino und De Niro konzentrieren wollte. Auch wenn ein Showdown mit vielen Explosionen oder ein Abgang ala Scarface dem Film nicht angemessen gewesen wäre, hätte Heat ein etwas raffinierteres Ende, bei dem sich die beiden Parteien ein ebenbürtiges Gefecht liefern, sicherlich gut zu Gesicht gestanden. So endet der Film seinem Stil treu ergeben kühl, aber unspektakulär. Helden und Romantik gibts eben nur im Kino.
Das Bild ist saugut, der Ton ist OK, rappelt aber im englischen deutlich mehr.
Auch wenn die Heat das Räuber und Gendarmgenre zum x-ten male wiederkäut, hat Michael Mann hier etwas ganz besonderes geschaffen. Er begeht nicht den Fehler Scorseses, seine Akteure bis an die Grenze zur Parodie zum Overacting- und Improvisationsinferno zu hetzen, sondern setzt ganz auf die ernsthaften Facetten der Schauspielikonen De Niro und Pacino, und reduziert ihre Gesten auf das Wesentliche.
Hier wird passenderweise nicht im Tarantinostyle persifliert und gekalauert, sondern es geht von Beginn an ernst zu Sache. Todernst.
Ähnlich wie bei Leones "Lied vom Tod" umkreisen sich hier die Protagonisten wie zwei angestachelte Kampfhähne gegenseitig und mit äußerster Vorsicht umeinander und halten bis zum entscheidenden Moment lebensrettenden Sicherheitabstand.
Lediglich im zuge einer Beschattungsaktion kommt es in einem Kaffee zum kurzen persönlichen Kontakt, wo sich die beiden Einzelgänger vorsichtig beschnuppern und ihre unmißverständlichen Positionen gegenüber äußern können.
Trotz gegenseitiger Versicherung, den anderen im Ernstfall zu erschießen, spürt der Zuschauer aber sofort die Seelenverwandtschaft und den Respekt der beiden Alphamännchen füreinander. Ihre charakterliche Ähnlichkeit geht Hand in Hand mit der Loyalität gegenüber dem Beruf und der Professionalität ihrer Vorgehensweise. Ihre Charaktereigenschaften und Eignungen sind so ähnlich, daß sie ohne weiteres ihre Rollen tauschen könnten. Beide brauchen das Adrenalin und die Jagd.
Interessanterweise führt aber genau dieser Jagdinstinkt Pacino unbeirrbar immer wieder in die Einsamkeit und zum Scheitern seiner Beziehungen, während De Niro im Begriff ist, sein überlebenswichtiges Credo "Häng dein Herz an nichts, was du nicht in 30 sek. hinter dir lassen kannst", sowie seinen Jagdtrieb, für eine gerade begonnene Liebesaffäre aufzugeben.
Genau dieses Loslassen der Beziehung ist es letztendlich auch, daß Pacino den "Sieg" über de Niro beschert. Dieser findet durch das Festhalten an seiner Beziehung nur den Tod. "Sieg", hier gleichbedeutend mit Überleben in dieser Welt des Verbrechens, ist nur ohne Liebe denkbar, lautet nach 170min. schließlich das traurige Resümee dieses Films.
Aber nicht allein das Duell der beiden Schauspielgenies macht den Film sehenswert.
Auch die perfekt besetzten Nebenrollen der Gangster (John Voigt, Danny Trejo, etc...), sowie die ebenbürtige Ehefrau Pacinos, die liebenswerte Freundin de Niros sowie der aalglatte Geldwäscher Van Dyke (Fichtner) runden das Ensemble auf höchstem Niveau ab.
Nicht zu vergeßen und maßgeblich für den Erfolg des Films verantwortlich ist dabei der kompromißlose und harte Erzählstil Manns, der sich nicht mit Faxen wie endlosen Monologen vor der Hinrichtung abgibt, sondern unmittelbar, knallhart und eiskalt zur Sache kommt. Manns Dramaturgie läuft von Beginn an schnurstracks ohne eine überflüßige Scene oder ein zuviel gesprochenes Wort auf das unvermeindliche Finale zu. Diese inszenatorische Vorgehensweise bindet den Zuschauer maximal an den Film und gönnt ihm keinen Moment Ablenkung. Dies führt zu einer intensiven Verschmelzung mit der Geschichte.
Sogar selbst die Frauen, obwohl emanzipiert und selbstbewußt, erhalten kaum Gelegenheit ein charakterliches Eigenleben zu entwickeln, sondern haben sich storydienlich der Entwicklung der Psychogramme der beiden Protagonisten unterzuordnen.
Getragen wird dieser kalte Erzählstil, der wahrscheinlich reines Männerkino ist, von sphärischer und trancelastiger Elektronikmusik. Diese gibt die melancholische und entfremdet-vereinsamte Welt in der sich die Handlung bewegt, in stimmungsvollen Klangbögen wieder.
Da der Film nicht arm an Actionlastigen Sequencen und spannenden Passagen ist, verwundert das Ende jedoch ein wenig. Klar ist , daß Mann sich von allem überflüßigen Ballast trennen, und die Aufmerksamkeit ungeteilt auf das Duell zwischen Pacino und De Niro konzentrieren wollte. Auch wenn ein Showdown mit vielen Explosionen oder ein Abgang ala Scarface dem Film nicht angemessen gewesen wäre, hätte Heat ein etwas raffinierteres Ende, bei dem sich die beiden Parteien ein ebenbürtiges Gefecht liefern, sicherlich gut zu Gesicht gestanden. So endet der Film seinem Stil treu ergeben kühl, aber unspektakulär. Helden und Romantik gibts eben nur im Kino.
Das Bild ist saugut, der Ton ist OK, rappelt aber im englischen deutlich mehr.
mit 5
mit 4
mit 3
mit 3
bewertet am 08.01.13 um 17:14
Das war sie also mal wieder, die jahrzehntlich stattfindene Aliensichtung.
Leider muß ich feststellen, daß mir dieser Haufen Weltraumprolls, der mit seinen Primisprüchen kaum der Pupertät entklommen zu sein scheint, so gar nicht mehr zusagt.
Natürlich war die Inszenierung wegweisend für alle nachkommenden Generationen von Horrorschockern und die Dramaturgie wirkt nach wie vor perfekt getimt, dennoch ist der Unterhaltungsfaktor durch zahlreiche Spinnoffs, Fortsetzungen und Nachahmungen deutlich geschrumpft.
Was 1986 noch das Maß aller Dinge gewesen ist, wirkt heute, trotz allem Respektes für Cameron, der damals das Maximum an Nervenkitzel aus dem Franchise herausgepresst hat, abgenutzt und ausgeplündert. Denn mal ehrlich, wer denkt sich denn bei speichelsabbernden und doppelmäuligen schnappatmenden Weltraumungetümen nicht "oh nein, bitte nicht schon wieder" und senkt gähnend seine Augenlieder auf Halbmast?
So gesehen hat sich der Film selbst einen Stolperstein gesetzt, indem er auf viele Weisen so wegweisend und stilbildend war, daß vielen Regisseuren und Plagiatoren einfach nichts anderes mehr übrig blieb, als sich an diesem Meilenstein abzuarbeiten und damit durch 100faches kopieren, die ursprüngliche Wirkung zu verwässern.
So bleibt Aliens nach wie vor eine Ikone des Sci-Fi Films, sowie auf kongeniale Weise der Höhepunkt der Alien-Saga, kann jedoch seine einst schockierende Wirkung aus angeführten Gründen leider nicht mehr erzielen.
Das Bild ist von heutigen Standards weit entfernt und enttäuscht mit Grieseln und teils milchigem Belag.
Leider muß ich feststellen, daß mir dieser Haufen Weltraumprolls, der mit seinen Primisprüchen kaum der Pupertät entklommen zu sein scheint, so gar nicht mehr zusagt.
Natürlich war die Inszenierung wegweisend für alle nachkommenden Generationen von Horrorschockern und die Dramaturgie wirkt nach wie vor perfekt getimt, dennoch ist der Unterhaltungsfaktor durch zahlreiche Spinnoffs, Fortsetzungen und Nachahmungen deutlich geschrumpft.
Was 1986 noch das Maß aller Dinge gewesen ist, wirkt heute, trotz allem Respektes für Cameron, der damals das Maximum an Nervenkitzel aus dem Franchise herausgepresst hat, abgenutzt und ausgeplündert. Denn mal ehrlich, wer denkt sich denn bei speichelsabbernden und doppelmäuligen schnappatmenden Weltraumungetümen nicht "oh nein, bitte nicht schon wieder" und senkt gähnend seine Augenlieder auf Halbmast?
So gesehen hat sich der Film selbst einen Stolperstein gesetzt, indem er auf viele Weisen so wegweisend und stilbildend war, daß vielen Regisseuren und Plagiatoren einfach nichts anderes mehr übrig blieb, als sich an diesem Meilenstein abzuarbeiten und damit durch 100faches kopieren, die ursprüngliche Wirkung zu verwässern.
So bleibt Aliens nach wie vor eine Ikone des Sci-Fi Films, sowie auf kongeniale Weise der Höhepunkt der Alien-Saga, kann jedoch seine einst schockierende Wirkung aus angeführten Gründen leider nicht mehr erzielen.
Das Bild ist von heutigen Standards weit entfernt und enttäuscht mit Grieseln und teils milchigem Belag.
mit 3
mit 3
mit 3
mit 3
bewertet am 05.01.13 um 14:42
Der letzte Höhepunkt in Jacksons Schaffen.
in diesem Crossoveraus Abenteuer, Fantasyfilm und Romanze stimmt bis auf wenige Abstriche eigentlich Alles: Von der behutsamen Einführung der Charaktere im zum neuen Leben erweckten New York der 20er Jahre im Art Deko Design, dem leisen Humor, dem Eingeborenenstamm aus einer Mischung zwischen Tier, Zombie und Kannibale, dem jede Südseeromantik fremd ist, sowie die prähistorische Inselwildniss mit ihren überdimensionierten Dschungelkulissen.
Und nicht zuletzt überzeugen auch die Urzeitmonster durch die Bank weg.
Allerdings liegt hier jedoch einer der wenigen Kritikpunkte. Tricktechnisch gibt es zwar nichts zu bemängeln, da sich die Dinos nahtlos in in die Flora der Insel einfügen und allesamt detailverliebt und glaubwürdig animiert sind. Ihr Einsatz hätte jedoch auch etwas sparsamer ausfallen dürfen, da weniger ja bekannterweise manchmal mehr ist. So aber stolpern Joe Black & Co ständig von einem Dinonest ins nächste, nur um darauf wieder einem Monsteraurier vor die Fangzähne zu geraten.
Und auch King Kong scheint dieselbe Kacke an den Fersen zu haben, da ihm das gleiche Schicksal zuteil wird. Das wirkt auf der einen Seite natürlich spektakulär, da man alles aus dem Jurassic Park Thema rausgeholt hat was nur drin war, auf der anderen Seite eben genau deßhalb auf die Dauer Inflationär und ermüdend.
So kommt die eigentliche Geschichte ab der beginnenden Rettungsaktion nur zäh voran und wird immer wieder durch ungebetenen Widwechsel ausgebremst. Am nervigsten fällt das bei der Insekteninvasion ins Gewicht, wo Jackson eine Armada von Gliederfüßlern auf die Rettungstruppe einpraßeln läßt, die mehr seinem Vergnügen an Beastcreatures geschuldet ist, denn seinem Talent als Dramaturg. Dabei sind die Plagegeister noch am simpelsten von allen Kreaturen getrixt und die Flucht vor ihnen ist einfach nur albern und senkt das Niveau des Films kurzfristig.
Damit der Zuschauer aber nicht völlig vom CGI Gewitter erschlagen wird, sprengt Jackson immer wieder Scenen ein, in denen sich das Verhältniss von King Kong und Ann Darrow (Naomi Watts) zu entwickeln beginnt. Diese Scenen bilden den wohltuenden Ruhepol in dem atemlosen Schlachtengetümmel und bilden so etwas wie dessen Gegenstück. In diesen emotionalen Passagen, ohne die der Film wohl seelenlos wäre, beweist Peter Jackson seine Größe als Regisseur und Drehbuchschreiber. So abstrus es auch klingen mag, Jackson schafft es tatsächlich in wenigen aber ausgedehnten Scenen, eine tiefe und vertrauensvolle Verbindung zwischen Kong und Darrow reifen zu lassen, in der Ann Kong als Beschützer gewinnt und Kong in Ann jemand findet, der ihn unterhält und ihn aus seiner Einsamkeit befreit.
Diese Verbindung ist es dann auch, der dem Film seine eigentliche Dramatik verleiht und dessen tragisches Ende den Zuschauer emotional berührt.
Das dann der Ausbruch King Kongs aus dem Theater etwas blaß verläuft und man sich stattdessen mehr Hulk gewünscht hätte, fällt vor diesem Hintergrund ebenso wie die Tatsache, daß die Verfolgungsjagd in New York aus finanziellen Gründen stark gekürzt wurde und daher die Erwartungen an den Actionhöepunkt enttäuscht werden, weniger ins Gewicht. Das ausgedehnte Finale auf dem Empire State Building und King Kongs verzweifelter Kampf gegen die moderne Technik bilden einen Höhepunkt neuerer Erzählkunst und machen damit eine Neuverfilmung der Abenteuergeschichte von Edgar Wallace für alle Zukunft überflüßig.
in diesem Crossoveraus Abenteuer, Fantasyfilm und Romanze stimmt bis auf wenige Abstriche eigentlich Alles: Von der behutsamen Einführung der Charaktere im zum neuen Leben erweckten New York der 20er Jahre im Art Deko Design, dem leisen Humor, dem Eingeborenenstamm aus einer Mischung zwischen Tier, Zombie und Kannibale, dem jede Südseeromantik fremd ist, sowie die prähistorische Inselwildniss mit ihren überdimensionierten Dschungelkulissen.
Und nicht zuletzt überzeugen auch die Urzeitmonster durch die Bank weg.
Allerdings liegt hier jedoch einer der wenigen Kritikpunkte. Tricktechnisch gibt es zwar nichts zu bemängeln, da sich die Dinos nahtlos in in die Flora der Insel einfügen und allesamt detailverliebt und glaubwürdig animiert sind. Ihr Einsatz hätte jedoch auch etwas sparsamer ausfallen dürfen, da weniger ja bekannterweise manchmal mehr ist. So aber stolpern Joe Black & Co ständig von einem Dinonest ins nächste, nur um darauf wieder einem Monsteraurier vor die Fangzähne zu geraten.
Und auch King Kong scheint dieselbe Kacke an den Fersen zu haben, da ihm das gleiche Schicksal zuteil wird. Das wirkt auf der einen Seite natürlich spektakulär, da man alles aus dem Jurassic Park Thema rausgeholt hat was nur drin war, auf der anderen Seite eben genau deßhalb auf die Dauer Inflationär und ermüdend.
So kommt die eigentliche Geschichte ab der beginnenden Rettungsaktion nur zäh voran und wird immer wieder durch ungebetenen Widwechsel ausgebremst. Am nervigsten fällt das bei der Insekteninvasion ins Gewicht, wo Jackson eine Armada von Gliederfüßlern auf die Rettungstruppe einpraßeln läßt, die mehr seinem Vergnügen an Beastcreatures geschuldet ist, denn seinem Talent als Dramaturg. Dabei sind die Plagegeister noch am simpelsten von allen Kreaturen getrixt und die Flucht vor ihnen ist einfach nur albern und senkt das Niveau des Films kurzfristig.
Damit der Zuschauer aber nicht völlig vom CGI Gewitter erschlagen wird, sprengt Jackson immer wieder Scenen ein, in denen sich das Verhältniss von King Kong und Ann Darrow (Naomi Watts) zu entwickeln beginnt. Diese Scenen bilden den wohltuenden Ruhepol in dem atemlosen Schlachtengetümmel und bilden so etwas wie dessen Gegenstück. In diesen emotionalen Passagen, ohne die der Film wohl seelenlos wäre, beweist Peter Jackson seine Größe als Regisseur und Drehbuchschreiber. So abstrus es auch klingen mag, Jackson schafft es tatsächlich in wenigen aber ausgedehnten Scenen, eine tiefe und vertrauensvolle Verbindung zwischen Kong und Darrow reifen zu lassen, in der Ann Kong als Beschützer gewinnt und Kong in Ann jemand findet, der ihn unterhält und ihn aus seiner Einsamkeit befreit.
Diese Verbindung ist es dann auch, der dem Film seine eigentliche Dramatik verleiht und dessen tragisches Ende den Zuschauer emotional berührt.
Das dann der Ausbruch King Kongs aus dem Theater etwas blaß verläuft und man sich stattdessen mehr Hulk gewünscht hätte, fällt vor diesem Hintergrund ebenso wie die Tatsache, daß die Verfolgungsjagd in New York aus finanziellen Gründen stark gekürzt wurde und daher die Erwartungen an den Actionhöepunkt enttäuscht werden, weniger ins Gewicht. Das ausgedehnte Finale auf dem Empire State Building und King Kongs verzweifelter Kampf gegen die moderne Technik bilden einen Höhepunkt neuerer Erzählkunst und machen damit eine Neuverfilmung der Abenteuergeschichte von Edgar Wallace für alle Zukunft überflüßig.
mit 4
mit 5
mit 4
mit 2
bewertet am 03.01.13 um 17:47
Verstörende Version Orson Welles von Kafkas Paranoiaklassiker "Der Prozess", der mit seinen in harten schwarz/weiß Kontrasten selbst so hoch gelobte Werke wie "Der dritte Mann" alt aussehen läßt.
Unsanft wird Joeph K. (A. Perkins) eines Morgens aus seinem Schlaf geweckt. Drei Polizeibeamte teilen ihm seinen Arrest mit. Er wisse schon wieso, brauche sich nicht dumm zu stellen und mehr Informationen könne ihm nur der Polizeiinspektor geben. Die Verhandlung werde bald stattfinden, er brauche nicht zu leugnen und es sehe nicht gut für ihn aus, da einige seiner Arbeitskollegen alles bezeugen können.
So vor den Kopf gestoßen macht sich Joseph auf den Weg in die Welt, um bei der Polizei, der Justiz, den Anwälten oder einfach nur bei seinen Mitbürgern zu erfahren, wessen er bezichtigt wird. Je tiefer er jedoch in den Dschungel des Rechtssystems eindringt, desto abstrakter, irrationaler und ominöser wird sein Fall. Die Menschen in seiner Umgebung, bedienen sich einer vieldeutigen und daher nichtssagenden kryptisch-fragmentalen Ausdrucksform, reden in vagen Andeutungen und bedienen sich dabei einer Logik, die mit dem alltäglichen Vernunftgebrauch nur noch die kleinstnötige Schnittmenge besitzt. Gefangen in dieser albtraumhaften Welt kämpft Joseph gegen die Mühlen und die Übermacht dieses abstrusen Systems an, um der sich immer enger um seinen Hals zuziehenden Schlinge zu entkommen.
Da sich die Rechtslogik jedoch dem gesunden Menschenverstand entzieht und die wirklichen Entscheidungsträger okkult und anonym bleiben, ist dies eine Sysyphusarbeit mit geringer Aussicht auf Erfolg.
So befremdlich die Menschen in Joseph K's Welt aber auch wirken, so durchdrungen sind sie von blinder Loyalität und Pflichtbewußtsein gegenüber dem Rechtsgetriebe des Staates und seiner Repräsentanten. Unbedingter Gehorsam wird hier kritischer Prüfung der Machtmechanismen vorgezogen.
Erst einmal unter die Mühlsteine der Justiz geraten und mit kriminellem Phlegma behaftet, wendet sich die Welt von Joseph ab und das Vorurteil ersetzt den Schuldspruch. In diesem wahnsinnigen System, in dem scheinbar nur die, Abnormen und vor diffuser Angst selbstverleugnerischen Menschen überleben können, und das sich gegen Joseph verschworen zu haben scheint, findet er keine Antwort auf seine Fragen nach dem Anklagegrund. Selbst sein Anwalt, Albert Hastler (Orson Welles), redet dekadent in seinem mächtigen und Schutz vor der Welt gebietenden Barockbett liegend, nur in juristisch vagen Orakeln. Einzig und allein Hastler's Sekretärin Leni (Romi Schneider), von schuldbehafteten Klienten erotisch angezogen, scheint sich etwas für Joseph zu interessieren und beginnt mit ihm eine kleine Liason. Ansonsten kreist jeder Mitbürger politisch korrekt in seinem eigenen Universum, um ja nicht in die Fänge der Justiz zu geraten. All das treibt Joseph schließlich in eine quälende menschliche Isolation und Ohmacht gegenüber einen unsichtbaren Gegner, der sich wohlmöglich auch einfach nur zwischen den Paragraphen versteckt, die ein Entkommen aus den Klauen des Rechtssystems unmöglich werden lassen.
So surreal das Verhalten der Menschen aus Kafkas Prozess auch ist, so sind ihnen die Kulissen nicht minder ebenbürtig. Kalte Plattenbauästhetik wechselt hier spielerisch mit Barokker Pracht und dem Design jenes Zeitalters, daß der Dampf und Stahl erschuf. Zwischengelagert werden auch immer wieder Sets von Zerfall und morbider Schönheit. Also genau wie das Verhalten der Menschen, folgt die Architektur des Films keiner erkennbaren Ordnung und offenbart dadurch die Zerfahrenheit des wirkenden Geistes. Dennoch ist dieses Design der eigentliche Clou des Films. So gut die Schauspieler es auch verstehen, Kafkas klaustrophische Atmosphäre umzusetzen, ohne die kunstvoll ausgeleuchteten Sets, die mit ihren kräftigen Schatten und schwarz/weiß Kontrasten eine expressionistische Scheinwelt erschaffen, wäre der Film nur halb so sehenswert.
Welles galt als Meister der Lichtgestaltung und verlangte seinen Kameramännern immer wieder ab, bereits vorhandenes zu übertrumpfen. So lief auch sein französischer Kameramann Edmund Richard zu Höchstform auf und erschuf Kompositionen von Licht- und Schattenspielen, die schlichtweg einfach nur faszinieren und atemberaubend ästhetisch sind.
Abgesehen von den Überzeugenden visuellen und schauspielerischen Darbietungen, bleibt natürlich noch die Frage, was es sich mit Kafkas "Prozess" an sich auf sich hat.
Den Begriff kafkaesk gibt es nicht umsonst. Er bezeichnet eine von Angst, Unsicherheit und Paranoia gefärbte Stimmung oder Situation, die rational nicht oder nur intuitiv zu erfassen ist und der eine quälende Ohnmacht, meist gegenüber anonymen Mächten gegenüber, zu eigen ist.
Genau darum geht es auch in dem Prozess. Das albtraumartige ausgeliefert sein, an eine Macht oder Welt, die man nicht versteht und gegen man nichts ausrichten kann. Die innere Qual die daraus entsteht, etwas intellektuel nicht überschauen zu können und die inneren Mechanismen nicht zu begreifen. So ist man nicht mehr Kontrolleur seines Lebens, sondern wird zum Kontrolliertern. Der damit verbundene Verlust der Autonomie führt zur Auslöschung des Gefühls der Freiheit und somit zwangsläufig zu der seelischen Beklemmung Kafkas Protagonisten.
Einige Leute gehen auch davon aus, daß sich Kafka in seinem "Prozess" von gesellschaftlich herangetragener Schuld entlasten wollte. Das jüdische Leben verlangte damals von seinen männlichen Mitgliedern die Rolle des "echten Menschen" auszufüllen. Konkret bedeutete dies, eine Frau zu heiraten, Kinder zu kriegen und für diese zu sorgen. Der kränkliche Franz Kafka fühlte sich dazu nicht in der Lage und wohl so einem gesellschaftlichen Generalverdacht ausgeliefert. Ähnlich wie in seinem Buch, mußte ihm im wirklichen Leben niemand sagen, weßhalb er sich schuldig zu fühlen hatte. Er wisse es ja ganz sicher "intuitiv".
Ob es jetzt wirklich aber ein tiefenpsychologischer Befreiungsschlag werden sollte oder ob es um die allgemeinschuld des Menschen geht, nicht der zu sein, der man sein möchte oder nicht das zu tun, was man sollte, sei jetzt mal dahingestellt. Fest steht, daß Kafkas Werk, ebenso wie Welles Film mit Symbolen überfrachtet ist, die je nach Lust und Laune künstlerisch bis psychologisch in alle Himmelsrichtungen gedeutet werden können, von dem eigentlichen Genuß dieser Meisterwerke aber bloß ablenken.
Das Bild weist nur minimale Spuren von Filmkorn auf, wirkt insgesamt sehr sauber und deatailreich. Die effektvollen schwarz/weiß Kontraste werden präzise dargestellt.
Der Ton ist insgesamt sauber und frei von rauschen, jedoch oft undeutlich, so daß geraten wird, deutsche Untertitel mitlaufen zu lassen.
Unsanft wird Joeph K. (A. Perkins) eines Morgens aus seinem Schlaf geweckt. Drei Polizeibeamte teilen ihm seinen Arrest mit. Er wisse schon wieso, brauche sich nicht dumm zu stellen und mehr Informationen könne ihm nur der Polizeiinspektor geben. Die Verhandlung werde bald stattfinden, er brauche nicht zu leugnen und es sehe nicht gut für ihn aus, da einige seiner Arbeitskollegen alles bezeugen können.
So vor den Kopf gestoßen macht sich Joseph auf den Weg in die Welt, um bei der Polizei, der Justiz, den Anwälten oder einfach nur bei seinen Mitbürgern zu erfahren, wessen er bezichtigt wird. Je tiefer er jedoch in den Dschungel des Rechtssystems eindringt, desto abstrakter, irrationaler und ominöser wird sein Fall. Die Menschen in seiner Umgebung, bedienen sich einer vieldeutigen und daher nichtssagenden kryptisch-fragmentalen Ausdrucksform, reden in vagen Andeutungen und bedienen sich dabei einer Logik, die mit dem alltäglichen Vernunftgebrauch nur noch die kleinstnötige Schnittmenge besitzt. Gefangen in dieser albtraumhaften Welt kämpft Joseph gegen die Mühlen und die Übermacht dieses abstrusen Systems an, um der sich immer enger um seinen Hals zuziehenden Schlinge zu entkommen.
Da sich die Rechtslogik jedoch dem gesunden Menschenverstand entzieht und die wirklichen Entscheidungsträger okkult und anonym bleiben, ist dies eine Sysyphusarbeit mit geringer Aussicht auf Erfolg.
So befremdlich die Menschen in Joseph K's Welt aber auch wirken, so durchdrungen sind sie von blinder Loyalität und Pflichtbewußtsein gegenüber dem Rechtsgetriebe des Staates und seiner Repräsentanten. Unbedingter Gehorsam wird hier kritischer Prüfung der Machtmechanismen vorgezogen.
Erst einmal unter die Mühlsteine der Justiz geraten und mit kriminellem Phlegma behaftet, wendet sich die Welt von Joseph ab und das Vorurteil ersetzt den Schuldspruch. In diesem wahnsinnigen System, in dem scheinbar nur die, Abnormen und vor diffuser Angst selbstverleugnerischen Menschen überleben können, und das sich gegen Joseph verschworen zu haben scheint, findet er keine Antwort auf seine Fragen nach dem Anklagegrund. Selbst sein Anwalt, Albert Hastler (Orson Welles), redet dekadent in seinem mächtigen und Schutz vor der Welt gebietenden Barockbett liegend, nur in juristisch vagen Orakeln. Einzig und allein Hastler's Sekretärin Leni (Romi Schneider), von schuldbehafteten Klienten erotisch angezogen, scheint sich etwas für Joseph zu interessieren und beginnt mit ihm eine kleine Liason. Ansonsten kreist jeder Mitbürger politisch korrekt in seinem eigenen Universum, um ja nicht in die Fänge der Justiz zu geraten. All das treibt Joseph schließlich in eine quälende menschliche Isolation und Ohmacht gegenüber einen unsichtbaren Gegner, der sich wohlmöglich auch einfach nur zwischen den Paragraphen versteckt, die ein Entkommen aus den Klauen des Rechtssystems unmöglich werden lassen.
So surreal das Verhalten der Menschen aus Kafkas Prozess auch ist, so sind ihnen die Kulissen nicht minder ebenbürtig. Kalte Plattenbauästhetik wechselt hier spielerisch mit Barokker Pracht und dem Design jenes Zeitalters, daß der Dampf und Stahl erschuf. Zwischengelagert werden auch immer wieder Sets von Zerfall und morbider Schönheit. Also genau wie das Verhalten der Menschen, folgt die Architektur des Films keiner erkennbaren Ordnung und offenbart dadurch die Zerfahrenheit des wirkenden Geistes. Dennoch ist dieses Design der eigentliche Clou des Films. So gut die Schauspieler es auch verstehen, Kafkas klaustrophische Atmosphäre umzusetzen, ohne die kunstvoll ausgeleuchteten Sets, die mit ihren kräftigen Schatten und schwarz/weiß Kontrasten eine expressionistische Scheinwelt erschaffen, wäre der Film nur halb so sehenswert.
Welles galt als Meister der Lichtgestaltung und verlangte seinen Kameramännern immer wieder ab, bereits vorhandenes zu übertrumpfen. So lief auch sein französischer Kameramann Edmund Richard zu Höchstform auf und erschuf Kompositionen von Licht- und Schattenspielen, die schlichtweg einfach nur faszinieren und atemberaubend ästhetisch sind.
Abgesehen von den Überzeugenden visuellen und schauspielerischen Darbietungen, bleibt natürlich noch die Frage, was es sich mit Kafkas "Prozess" an sich auf sich hat.
Den Begriff kafkaesk gibt es nicht umsonst. Er bezeichnet eine von Angst, Unsicherheit und Paranoia gefärbte Stimmung oder Situation, die rational nicht oder nur intuitiv zu erfassen ist und der eine quälende Ohnmacht, meist gegenüber anonymen Mächten gegenüber, zu eigen ist.
Genau darum geht es auch in dem Prozess. Das albtraumartige ausgeliefert sein, an eine Macht oder Welt, die man nicht versteht und gegen man nichts ausrichten kann. Die innere Qual die daraus entsteht, etwas intellektuel nicht überschauen zu können und die inneren Mechanismen nicht zu begreifen. So ist man nicht mehr Kontrolleur seines Lebens, sondern wird zum Kontrolliertern. Der damit verbundene Verlust der Autonomie führt zur Auslöschung des Gefühls der Freiheit und somit zwangsläufig zu der seelischen Beklemmung Kafkas Protagonisten.
Einige Leute gehen auch davon aus, daß sich Kafka in seinem "Prozess" von gesellschaftlich herangetragener Schuld entlasten wollte. Das jüdische Leben verlangte damals von seinen männlichen Mitgliedern die Rolle des "echten Menschen" auszufüllen. Konkret bedeutete dies, eine Frau zu heiraten, Kinder zu kriegen und für diese zu sorgen. Der kränkliche Franz Kafka fühlte sich dazu nicht in der Lage und wohl so einem gesellschaftlichen Generalverdacht ausgeliefert. Ähnlich wie in seinem Buch, mußte ihm im wirklichen Leben niemand sagen, weßhalb er sich schuldig zu fühlen hatte. Er wisse es ja ganz sicher "intuitiv".
Ob es jetzt wirklich aber ein tiefenpsychologischer Befreiungsschlag werden sollte oder ob es um die allgemeinschuld des Menschen geht, nicht der zu sein, der man sein möchte oder nicht das zu tun, was man sollte, sei jetzt mal dahingestellt. Fest steht, daß Kafkas Werk, ebenso wie Welles Film mit Symbolen überfrachtet ist, die je nach Lust und Laune künstlerisch bis psychologisch in alle Himmelsrichtungen gedeutet werden können, von dem eigentlichen Genuß dieser Meisterwerke aber bloß ablenken.
Das Bild weist nur minimale Spuren von Filmkorn auf, wirkt insgesamt sehr sauber und deatailreich. Die effektvollen schwarz/weiß Kontraste werden präzise dargestellt.
Der Ton ist insgesamt sauber und frei von rauschen, jedoch oft undeutlich, so daß geraten wird, deutsche Untertitel mitlaufen zu lassen.
mit 5
mit 4
mit 2
mit 4
bewertet am 02.01.13 um 14:52
Wahrscheinlich der "erwachsenste" Film von Miyazaki.
Mit einer Kombination aus Mittelalter, Zukunft, etwas Herrr der Ringe (Feuerdämon aus der alten Welt=Balrog) und ein bißchen Der phantastische Planet, wird ein vielschichtiges Epos über das Verhältniss von Mensch und Natur geschaffen.
In dieser von Mythos und Mystik durchdrungenen Welt imponieren vor allen die phantastisch gestalteten Kulissen im Aquarelldesign. Im Gegensatz dazu stehen immer wieder eingeflochtenen Elementen und musikalischen Einlagen im Kinderstil. Da huldigt Miyazaki noch etwas seiner Heidi Ära.
Ton ist OK. Bild ist OK, hat nur manchesmal etwas grieseln und könnte ein bißchen kräftiger sein.
Mit einer Kombination aus Mittelalter, Zukunft, etwas Herrr der Ringe (Feuerdämon aus der alten Welt=Balrog) und ein bißchen Der phantastische Planet, wird ein vielschichtiges Epos über das Verhältniss von Mensch und Natur geschaffen.
In dieser von Mythos und Mystik durchdrungenen Welt imponieren vor allen die phantastisch gestalteten Kulissen im Aquarelldesign. Im Gegensatz dazu stehen immer wieder eingeflochtenen Elementen und musikalischen Einlagen im Kinderstil. Da huldigt Miyazaki noch etwas seiner Heidi Ära.
Ton ist OK. Bild ist OK, hat nur manchesmal etwas grieseln und könnte ein bißchen kräftiger sein.
mit 4
mit 4
mit 4
mit 2
bewertet am 02.01.13 um 14:26
Dieser Film fängt da an, wo die Schlacht von Verdun aufhört.
Nach ca. 10 Min. weiß man als mündiger Zuschauer genau, wo der Haas langläuft.
Dann hat man a) die Möglichkeit abzuschalten, oder b), die Möglichkeit weiterzugucken.
Falls man sich für a) entscheidet: Respekt vor denjenigen, die sich der Abstumpfungsspirale entziehen.
Wer sich aber für b) entscheidet, sollte seine moralischen Bedenken und sein Feingefühl für 90 min. im Keller vergraben. Denn was folgt, ist Ultra Brutale vom Feinsten. Und das im Minutentakt.
Die Spannung spielt dabei, ebenso wie die Handlung, zugunsten der expliziten Gewaltdarstellung, nur eine Untergeordnete Rolle:
Ein Sondereinsatzkommando soll ein von einer Drogenbande besetztes Haus stürmen. Dabei muß sich das Einsatzkommando Etage um Etage, sprich Level um Level hart erkämpfen. Im Laufe der "Ermittlungen", die im Fiasko zu enden drohen, stellt sich heraus, daß der Einsatzleiter der Polizei seine Truppen bloß mißbraucht hat, um eine persönliche Rechnung mit dem Drogenboß zu begleichen...
Auch wenn die Handlung sicherlich etwas dünn ist, kommt zu keinem Zeitpunkt Langeweile auf. Der Film gönnt sich keine Anlaufzeit und kommt gleich zur Sache.
Von Beginn an gibt es ein Morden und Schlagen, daß schon nicht mehr als Kampf angesehen werden kann, sondern als ein nicht enden wollendes Schlachtfest bezeichnet werden muß. Da wird geschoßen und gestochen, geprügelt, gemeuchelt und auf Metzgergesellenart filetiert daß die Spiegelneuronen der Zuschauer unter Schwerstarbeit zu stöhnen beginnen, während das Blut in Kaskaden die Treppen runter fließt und die gegnerischen Knochen auf unheilverkündende Art und Weise neu sortiert werden.
Ähnlich wie in Peter Jacksons Braindead gerät man dabei zwangsläufig in einen Art Blutrausch, der das Gesehene nachträglich nur schwer differenzieren läßt, so daß sich eine genauere Scenenanalyse auf Grund des dominierenden allgemeinen Rauschgefühls eigentlich verbietet.
Das Set ist sehr einfach und schmuddelig, dennoch kann man es keinesfalls als billig oder unpassend bezeichnen, da es die heruntergekommene Atmosphäre des Drogenmillieus authentisch wiederspiegelt und so passend als bauliches Biotop funktioniert, in welcher die verrotteten Seelen prächtig gedeihen können.
Die zahlreichen Martial Arts Scenen sind trotz ihrer kaum zu überbietenden Brutalität von höchster akrobatischer Qualität und legen die Meßlatte für zukünftige Produktionen wieder ein paar Zoll nach oben. Eigentlich sind sie aber nur noch durch herumfliegende Gedärme zu toppen, wobei man dann aber schon eher im Bereich des Zombiefilms wäre. So bleibt im Nachhinein das zweischneidige Vergnügen, einer Demonstration höchst faszinierender Köperbeherrschung ebenso beigewohnt zu haben, wie einem mitunter hart zu ertagendem Gemetzel jenseits des Feel Good Faktors.
Auf jeden Fall sehenswert: Die Knetgummikurzversion des Films auf den Extras!!!
Nach ca. 10 Min. weiß man als mündiger Zuschauer genau, wo der Haas langläuft.
Dann hat man a) die Möglichkeit abzuschalten, oder b), die Möglichkeit weiterzugucken.
Falls man sich für a) entscheidet: Respekt vor denjenigen, die sich der Abstumpfungsspirale entziehen.
Wer sich aber für b) entscheidet, sollte seine moralischen Bedenken und sein Feingefühl für 90 min. im Keller vergraben. Denn was folgt, ist Ultra Brutale vom Feinsten. Und das im Minutentakt.
Die Spannung spielt dabei, ebenso wie die Handlung, zugunsten der expliziten Gewaltdarstellung, nur eine Untergeordnete Rolle:
Ein Sondereinsatzkommando soll ein von einer Drogenbande besetztes Haus stürmen. Dabei muß sich das Einsatzkommando Etage um Etage, sprich Level um Level hart erkämpfen. Im Laufe der "Ermittlungen", die im Fiasko zu enden drohen, stellt sich heraus, daß der Einsatzleiter der Polizei seine Truppen bloß mißbraucht hat, um eine persönliche Rechnung mit dem Drogenboß zu begleichen...
Auch wenn die Handlung sicherlich etwas dünn ist, kommt zu keinem Zeitpunkt Langeweile auf. Der Film gönnt sich keine Anlaufzeit und kommt gleich zur Sache.
Von Beginn an gibt es ein Morden und Schlagen, daß schon nicht mehr als Kampf angesehen werden kann, sondern als ein nicht enden wollendes Schlachtfest bezeichnet werden muß. Da wird geschoßen und gestochen, geprügelt, gemeuchelt und auf Metzgergesellenart filetiert daß die Spiegelneuronen der Zuschauer unter Schwerstarbeit zu stöhnen beginnen, während das Blut in Kaskaden die Treppen runter fließt und die gegnerischen Knochen auf unheilverkündende Art und Weise neu sortiert werden.
Ähnlich wie in Peter Jacksons Braindead gerät man dabei zwangsläufig in einen Art Blutrausch, der das Gesehene nachträglich nur schwer differenzieren läßt, so daß sich eine genauere Scenenanalyse auf Grund des dominierenden allgemeinen Rauschgefühls eigentlich verbietet.
Das Set ist sehr einfach und schmuddelig, dennoch kann man es keinesfalls als billig oder unpassend bezeichnen, da es die heruntergekommene Atmosphäre des Drogenmillieus authentisch wiederspiegelt und so passend als bauliches Biotop funktioniert, in welcher die verrotteten Seelen prächtig gedeihen können.
Die zahlreichen Martial Arts Scenen sind trotz ihrer kaum zu überbietenden Brutalität von höchster akrobatischer Qualität und legen die Meßlatte für zukünftige Produktionen wieder ein paar Zoll nach oben. Eigentlich sind sie aber nur noch durch herumfliegende Gedärme zu toppen, wobei man dann aber schon eher im Bereich des Zombiefilms wäre. So bleibt im Nachhinein das zweischneidige Vergnügen, einer Demonstration höchst faszinierender Köperbeherrschung ebenso beigewohnt zu haben, wie einem mitunter hart zu ertagendem Gemetzel jenseits des Feel Good Faktors.
Auf jeden Fall sehenswert: Die Knetgummikurzversion des Films auf den Extras!!!
mit 3
mit 3
mit 3
mit 2
bewertet am 02.01.13 um 14:24
Solider Psychothriller in präpsychotischem Ambiente, der stilistisch tief in den 80ern verwurzelt ist.
Auf der großen Kinoleinwand läuft der Psychoschocker "The Mummy". Die wahnsinnige The Mummy hypnotisiert ihren Sohn, damit dieser ihr frische menschliche Augen für ihre Sammlung stibitzen kann.
Währenddessen hat sich ein offenbar psychisch labiler Kinogänger den Streifen einige male zu oft angeschaut und nimmt das Kinopublikum als Geißeln, um sich selbst ihrer Augen zu bemächtigen.
Auch wenn die Handlung nicht sonderlich spannend ist, ist sie doch grundsolide inszeniert und nahezu perfekt durchsynchronisiert. Die eigentliche "reale" Handlung gerät dabei gegenüber der fiktiven "The Mummy" Geschichte ins hintertrefen. Zelda Rubinstein als kleine quaddelige, dominante und geisteskranke Übermutter überträgt ihren Wahnsinn von der Leinwand direkt auf den Zuschauer und verstört so das Publikum mit ihren Hypnosespirenzchen nachhaltig.
Die eigentliche Geißelnahmegeschichte erinnert dann ein bißchen an Giallo und Brian de Palma, mit einem Schuß Paranoia. Wirkliche Beklemmung kommt bei dem finalen Amoklauf in Salamitaktik jedoch nicht auf, auch wenn die Vermischung der realen und der fiktiven Erzählebene als geglückt bezeichnet werden kann. Daher aus heutiger Sicht nur 3 Punkte.
Das Bild weist einige Schwächen und Verschmutzungen auf, muß aber als grundsolide restauriert betrachtet werden.
Auf das geplante Remake in 3D darf man gespannt sein....
Auf der großen Kinoleinwand läuft der Psychoschocker "The Mummy". Die wahnsinnige The Mummy hypnotisiert ihren Sohn, damit dieser ihr frische menschliche Augen für ihre Sammlung stibitzen kann.
Währenddessen hat sich ein offenbar psychisch labiler Kinogänger den Streifen einige male zu oft angeschaut und nimmt das Kinopublikum als Geißeln, um sich selbst ihrer Augen zu bemächtigen.
Auch wenn die Handlung nicht sonderlich spannend ist, ist sie doch grundsolide inszeniert und nahezu perfekt durchsynchronisiert. Die eigentliche "reale" Handlung gerät dabei gegenüber der fiktiven "The Mummy" Geschichte ins hintertrefen. Zelda Rubinstein als kleine quaddelige, dominante und geisteskranke Übermutter überträgt ihren Wahnsinn von der Leinwand direkt auf den Zuschauer und verstört so das Publikum mit ihren Hypnosespirenzchen nachhaltig.
Die eigentliche Geißelnahmegeschichte erinnert dann ein bißchen an Giallo und Brian de Palma, mit einem Schuß Paranoia. Wirkliche Beklemmung kommt bei dem finalen Amoklauf in Salamitaktik jedoch nicht auf, auch wenn die Vermischung der realen und der fiktiven Erzählebene als geglückt bezeichnet werden kann. Daher aus heutiger Sicht nur 3 Punkte.
Das Bild weist einige Schwächen und Verschmutzungen auf, muß aber als grundsolide restauriert betrachtet werden.
Auf das geplante Remake in 3D darf man gespannt sein....
mit 3
mit 3
mit 3
mit 2
bewertet am 28.12.12 um 11:48
Marcel Carne's 1938 verfilmter Roman des 11 Jahre zuvor erschienen Buches von Pierre MacOrlan, gehört zu den markanten Wendepunkten der Filmgeschichte.
Nie zuvor war ein Filmuniversum so vollgepackt mit gebrochenen Existenzen und verzweifelten Menschen, deren Illusionen vom Glück schon lange zerbrochen sind.
Hafen im Nebel zeichnet ein in Nebelschwaden und naße Pflastersteine getauchtes, düsteres Bild der unteren Gesellschaftschichten, daß nur durch Zynismus, Alkohol und gedankliche Flucht in die Vergangenheit zu ertragen ist. Ein Entkommen dieser bedrückenden Umstände ist nur durch Selbstmord oder Ausreißen in fremde Länder auf einem der im Hafen von Le Havre vor Anker liegenden Ozeanriesen möglich.
In diesem seelenlosen Küstenort taucht eines Nachts der Soldat Jean (Gabin) auf. Zermürbt und angewiedert vom Töten, ist er aus der Kolonialarmee getürmt. Der Hafen von Le Havre scheint ihm eine Perspektive zu eröffnen: Mit dem Schiff in ein fernes Land zu fahren, um ein neues Leben zu beginnen.
In Le Havre angekommen wird Jean vom Kleinkriminellen und Trunkenbold Aimos aufgeschnappt, der ihn mit zu einer abgelegenen Absteige am Hafenrand schleppt. Dort tummeln sich der Wirt Panama, so genannt weil er oft von seiner vor 20 Jahren durchgeführten Reise durch den Suezkanal, der den Höhepunkt seines Lebens bildete, schwärmt, und ein desillusionierter depressiver Künstler, der sich permanent selbst bemitleidet, weil er nur noch das verborgen traurige hinter den Dingen sehen kann.
Panama läuft noch immer im Tropenanzug rum, um sich so des höchsten erlebten Glücksmomentes immer wieder zu vergegenwärtigen und verweist stolz auf ein billiges Flaschenschiffsouvenir dieser Reise.
In einer Nebenkammer, in der Jean eine kleine Mahlzeit zu sich nimmt, befindet sich aber noch etwas, was so gar nicht in diese morbide Welt hineinpaßt: Die wunderschöne Nelly (Michele Morgan). Von eigenen schlechten Frauenerfahrungen angetrieben, wettert er hemmungslos gegen die Verlogenheit der Liebe und verdächtigt die 17 jährige Nelly auch sofort der Prostitution.
Dennoch kommen sich die beiden näher und fühlen sich schnell zueinander hingezogen. Und was nicht mehr für möglich gehalten wurde, wird Wirklichkeit: Die beiden verlieben sich ineinander und erhaschen inmitten einer Welt der Verzweiflung für einige Augenblicke Momente des Glücks.
Doch ist Le Havre nicht Hollywood und ein Happy End ist in dieser Tristesse nicht vorgesehen.
Auf einer kleinen Kirmes, die an sich den ausgelassen Höhepunkt ihrer noch jungen Liebe darstellen soll, begegnen sie dem verzogenen möchtegerne Al Capone Lucien. Lucien, zuvor am Hafen von Jean in seine Schranken verwiesen, als er seine Finger nicht von Nelly lassen wollte, gerät hier erneut an Jean, als er diesem auf dem Autoscooter aus lauter Jux und Angeberei den Hut vom Schädel schlägt. Jean's Reaktion folgt prompt: Wieder demütigt er Lucien und erteilt ihm eine Portion Ohrfeigen. Doch diesmal sind außer seinen Freunden auch noch seine Freundin anwesend. Als diese über Luciens blamables Auftreten lacht, sieht Lucien rot. Jean muß sterben, damit er seine Ehre wiederfindet.
So nimmt das Schicksal in Le Havre nicht einmal auf ein frisch verliebtes Paar Rücksicht.
Als Jean, der schon auf einem Ozeandampfer nach Übersee eingeschifft hat, noch einmal von Liebeskummer und Abschiedsschmerz getrieben wird und Nelly (die Nachreisen möchte) auf Wiedersehen sagen möchte, wird er von ihrem Ziehvater Zabel (Michel Simon) angegriffen. Dieser hat schon einmal einen Freund Nellys aus Eifersucht getötet und fällt auch sofort über Jean her, als er erfährt, daß Nelly von seinem Mord an Maurice weiß und ihn für Jean verlassen möchte. Das Einzige zu verlieren, was etwas Licht in sein Leben gebracht hat, verkraftet er nicht.
Jean jedoch, deutlich jünger und Zabel körperlich überlegen, kann den Angreifer ausschalten. Als die Wege zu einer hoffnungsvollen Zukunft freigelegt zu sein scheinen, taucht plötzlich, wie aus dem Nichts, der gedemütigte Ganove Lucien auf....
Mit seiner depressiven Grundstimmung, den gebrochenen Charakteren und dem pessimistischen Weltbild, welches das Glück immer in die Vergangenheit oder in die Hände der Anderen projeziert, nahm Marcel Carne schon viele Stilelemente der Schwarzen Serie vorweg.
Unter vielen Geburtsschwierigkeiten leidend, dem Produzenten war der Film viel zu düster und daher nicht kassenträchtig genug, konnte er jedoch durch die massive Fürsprache Jean Gabins, dem größten französischen Filmstar jener Zeit, realisiert werden.
Das der Film jedoch sofort einschlug wie eine Bombe und fast sämtliche Filmpreise einheimste, hatte so aber sicherlich niemand erwartet.
Doch hatte Hafen im Nebel scheinbar die von Tod und Angst geprägte Vorkriegsstimmung der Franzosen exakt auf den Punkt getroffen.
Weil der Film aber nicht nur historisch interessant ist, sondern auch heute noch mit seinem dysphorischen Stimmungsbild, den bravourösen Schauspielern und beklemmenden s/w Aufnahmen überzeugen kann, hat er das Prädikat Klassiker, also ein Film, den die Moden und Launen des Zeitgeistes nichts anhaben konnten, redlich verdient.
Was heute noch genauso bleibt wie damals, ist ein nach wie vor fesselnder Blick in die seelischen Abgründe verzweifelter Menschen und ein düster trauriges Manifest der Hoffnungslosigkeit, an deren athmosphärisch karg morbiden Bildsprache der vom Expessionismus geprägte Kameramann Eugen Schüfftan erheblichen Anteil hat.
Interessant ist auch, daß viele Bilder und Scenen, ähnlich wie die des depressiven Malers in Panama's Kneipe, eine doppelte Bedeutung zu haben scheinen.
So steht z.b. das bei einem Feuergefecht Panama's zerschossene Flaschenschiff symbolisch für seine zerplatzten und nun in Scherben liegende Träume.
Der durchsichtige Plastikregenmantel Nellys, in dem sie zum ersten mal auf Jean trifft, symbolisiert die ätherische, unstoffliche Eigenschaft der Liebe, sowie deren gläserne Zerbrechlichkeit.
Auch das Jean seine Soldatentracht gegen den Anzug des Malers, nach dessem Selbstmord, austauscht, brandmarkt ihn bereits als vom Tod gezeichneten und begleiteten.
Das stärkste und wohl auch am meisten imitierte Bild, mit nahezu ikonenhafter Bewunderung verehrt, stellt jedoch Jean und Nelly dar, wie sie sich hinter einem Fenster, getrennt durch den den Mittelbalken, gegenüber stehen. Hier gibt das Schicksal bereits erste Hinweise darauf, daß die beiden nicht zusammenfinden werden...
Das Bild ist altersbedingt sehr weich und mitunter auch etwas unscharf, was aber durchaus gewollt sein kann, da es den nebligen Look des Films unterstreicht. So darf man denn auch keine pepperonischarfes Material erwarten, der Klassikerfreund wird aber mit einem ordentlich restaurierten Bild belohnt, bei dem die Beibehaltung der Originalausleuchtung mit seinen harten s/w Kontrasten, Vorrang vor HD Feeling hat.
Der Ton ist mitunter etwas nuschelig und leise, mit etwas Manipulation am Lautstärkenregler, läßt sich dieses Problem aber denkbar einfach und nachhaltig beheben.
Nie zuvor war ein Filmuniversum so vollgepackt mit gebrochenen Existenzen und verzweifelten Menschen, deren Illusionen vom Glück schon lange zerbrochen sind.
Hafen im Nebel zeichnet ein in Nebelschwaden und naße Pflastersteine getauchtes, düsteres Bild der unteren Gesellschaftschichten, daß nur durch Zynismus, Alkohol und gedankliche Flucht in die Vergangenheit zu ertragen ist. Ein Entkommen dieser bedrückenden Umstände ist nur durch Selbstmord oder Ausreißen in fremde Länder auf einem der im Hafen von Le Havre vor Anker liegenden Ozeanriesen möglich.
In diesem seelenlosen Küstenort taucht eines Nachts der Soldat Jean (Gabin) auf. Zermürbt und angewiedert vom Töten, ist er aus der Kolonialarmee getürmt. Der Hafen von Le Havre scheint ihm eine Perspektive zu eröffnen: Mit dem Schiff in ein fernes Land zu fahren, um ein neues Leben zu beginnen.
In Le Havre angekommen wird Jean vom Kleinkriminellen und Trunkenbold Aimos aufgeschnappt, der ihn mit zu einer abgelegenen Absteige am Hafenrand schleppt. Dort tummeln sich der Wirt Panama, so genannt weil er oft von seiner vor 20 Jahren durchgeführten Reise durch den Suezkanal, der den Höhepunkt seines Lebens bildete, schwärmt, und ein desillusionierter depressiver Künstler, der sich permanent selbst bemitleidet, weil er nur noch das verborgen traurige hinter den Dingen sehen kann.
Panama läuft noch immer im Tropenanzug rum, um sich so des höchsten erlebten Glücksmomentes immer wieder zu vergegenwärtigen und verweist stolz auf ein billiges Flaschenschiffsouvenir dieser Reise.
In einer Nebenkammer, in der Jean eine kleine Mahlzeit zu sich nimmt, befindet sich aber noch etwas, was so gar nicht in diese morbide Welt hineinpaßt: Die wunderschöne Nelly (Michele Morgan). Von eigenen schlechten Frauenerfahrungen angetrieben, wettert er hemmungslos gegen die Verlogenheit der Liebe und verdächtigt die 17 jährige Nelly auch sofort der Prostitution.
Dennoch kommen sich die beiden näher und fühlen sich schnell zueinander hingezogen. Und was nicht mehr für möglich gehalten wurde, wird Wirklichkeit: Die beiden verlieben sich ineinander und erhaschen inmitten einer Welt der Verzweiflung für einige Augenblicke Momente des Glücks.
Doch ist Le Havre nicht Hollywood und ein Happy End ist in dieser Tristesse nicht vorgesehen.
Auf einer kleinen Kirmes, die an sich den ausgelassen Höhepunkt ihrer noch jungen Liebe darstellen soll, begegnen sie dem verzogenen möchtegerne Al Capone Lucien. Lucien, zuvor am Hafen von Jean in seine Schranken verwiesen, als er seine Finger nicht von Nelly lassen wollte, gerät hier erneut an Jean, als er diesem auf dem Autoscooter aus lauter Jux und Angeberei den Hut vom Schädel schlägt. Jean's Reaktion folgt prompt: Wieder demütigt er Lucien und erteilt ihm eine Portion Ohrfeigen. Doch diesmal sind außer seinen Freunden auch noch seine Freundin anwesend. Als diese über Luciens blamables Auftreten lacht, sieht Lucien rot. Jean muß sterben, damit er seine Ehre wiederfindet.
So nimmt das Schicksal in Le Havre nicht einmal auf ein frisch verliebtes Paar Rücksicht.
Als Jean, der schon auf einem Ozeandampfer nach Übersee eingeschifft hat, noch einmal von Liebeskummer und Abschiedsschmerz getrieben wird und Nelly (die Nachreisen möchte) auf Wiedersehen sagen möchte, wird er von ihrem Ziehvater Zabel (Michel Simon) angegriffen. Dieser hat schon einmal einen Freund Nellys aus Eifersucht getötet und fällt auch sofort über Jean her, als er erfährt, daß Nelly von seinem Mord an Maurice weiß und ihn für Jean verlassen möchte. Das Einzige zu verlieren, was etwas Licht in sein Leben gebracht hat, verkraftet er nicht.
Jean jedoch, deutlich jünger und Zabel körperlich überlegen, kann den Angreifer ausschalten. Als die Wege zu einer hoffnungsvollen Zukunft freigelegt zu sein scheinen, taucht plötzlich, wie aus dem Nichts, der gedemütigte Ganove Lucien auf....
Mit seiner depressiven Grundstimmung, den gebrochenen Charakteren und dem pessimistischen Weltbild, welches das Glück immer in die Vergangenheit oder in die Hände der Anderen projeziert, nahm Marcel Carne schon viele Stilelemente der Schwarzen Serie vorweg.
Unter vielen Geburtsschwierigkeiten leidend, dem Produzenten war der Film viel zu düster und daher nicht kassenträchtig genug, konnte er jedoch durch die massive Fürsprache Jean Gabins, dem größten französischen Filmstar jener Zeit, realisiert werden.
Das der Film jedoch sofort einschlug wie eine Bombe und fast sämtliche Filmpreise einheimste, hatte so aber sicherlich niemand erwartet.
Doch hatte Hafen im Nebel scheinbar die von Tod und Angst geprägte Vorkriegsstimmung der Franzosen exakt auf den Punkt getroffen.
Weil der Film aber nicht nur historisch interessant ist, sondern auch heute noch mit seinem dysphorischen Stimmungsbild, den bravourösen Schauspielern und beklemmenden s/w Aufnahmen überzeugen kann, hat er das Prädikat Klassiker, also ein Film, den die Moden und Launen des Zeitgeistes nichts anhaben konnten, redlich verdient.
Was heute noch genauso bleibt wie damals, ist ein nach wie vor fesselnder Blick in die seelischen Abgründe verzweifelter Menschen und ein düster trauriges Manifest der Hoffnungslosigkeit, an deren athmosphärisch karg morbiden Bildsprache der vom Expessionismus geprägte Kameramann Eugen Schüfftan erheblichen Anteil hat.
Interessant ist auch, daß viele Bilder und Scenen, ähnlich wie die des depressiven Malers in Panama's Kneipe, eine doppelte Bedeutung zu haben scheinen.
So steht z.b. das bei einem Feuergefecht Panama's zerschossene Flaschenschiff symbolisch für seine zerplatzten und nun in Scherben liegende Träume.
Der durchsichtige Plastikregenmantel Nellys, in dem sie zum ersten mal auf Jean trifft, symbolisiert die ätherische, unstoffliche Eigenschaft der Liebe, sowie deren gläserne Zerbrechlichkeit.
Auch das Jean seine Soldatentracht gegen den Anzug des Malers, nach dessem Selbstmord, austauscht, brandmarkt ihn bereits als vom Tod gezeichneten und begleiteten.
Das stärkste und wohl auch am meisten imitierte Bild, mit nahezu ikonenhafter Bewunderung verehrt, stellt jedoch Jean und Nelly dar, wie sie sich hinter einem Fenster, getrennt durch den den Mittelbalken, gegenüber stehen. Hier gibt das Schicksal bereits erste Hinweise darauf, daß die beiden nicht zusammenfinden werden...
Das Bild ist altersbedingt sehr weich und mitunter auch etwas unscharf, was aber durchaus gewollt sein kann, da es den nebligen Look des Films unterstreicht. So darf man denn auch keine pepperonischarfes Material erwarten, der Klassikerfreund wird aber mit einem ordentlich restaurierten Bild belohnt, bei dem die Beibehaltung der Originalausleuchtung mit seinen harten s/w Kontrasten, Vorrang vor HD Feeling hat.
Der Ton ist mitunter etwas nuschelig und leise, mit etwas Manipulation am Lautstärkenregler, läßt sich dieses Problem aber denkbar einfach und nachhaltig beheben.
mit 4
mit 3
mit 3
mit 3
bewertet am 25.12.12 um 12:15
Top Angebote
kleinhirn
GEPRÜFTES MITGLIED
FSK 18
Aktivität
Forenbeiträge0
Kommentare41
Blogbeiträge0
Clubposts0
Bewertungen509
Mein Avatar
Weitere Funktionen
(509)
(16)
Beste Bewertungen
kleinhirn hat die folgenden 4 Blu-rays am besten bewertet:
Letzte Bewertungen
Filme suchen nach
Mit dem Blu-ray Filmfinder können Sie Blu-rays nach vielen unterschiedlichen Kriterien suchen.
Die Filmbewertungen von kleinhirn wurde 341x besucht.