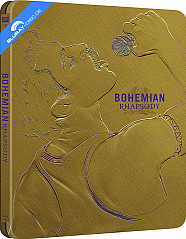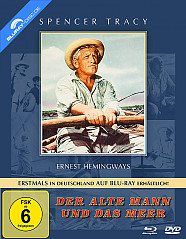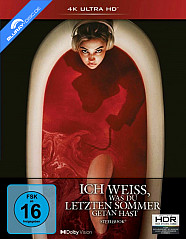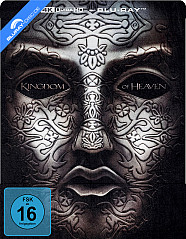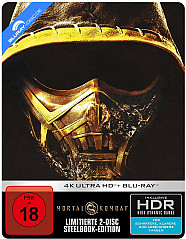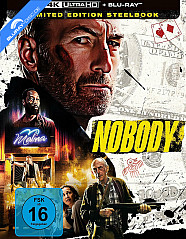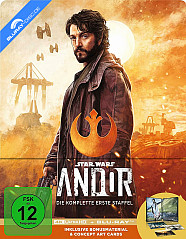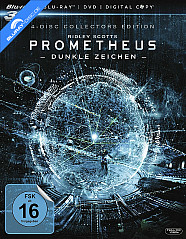Oscar-nominierter Western "Silverado" bald auch in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray im Steelbook erhältlich - UPDATEPreisfehler? - Filmneuheit "Warfare" auf Ultra HD Blu-ray für nur 17,19€Demnächst im Vertrieb von Crunchyroll: Mehrere Anime-Serien und Filme auf Blu-ray Disc"Young Hearts": Coming-of-Age-Drama erscheint am 30. Oktober 2025 auf Blu-rayBiopic-Drama über Antonia Brico: "Die Dirigentin" ab 17. Oktober 2025 auf Blu-ray DiscUPHE: Alle Blu-ray und Ultra HD Blu-ray Neuerscheinungen im Oktober 2025 auf einen Blick
NEWSTICKER
Filmbewertungen von plo
Marie Colvin ist Kriegsberichterstatterin. Nicht nur irgendeine Kriegsberichterstatterin, sondern wohl die bekannteste und berühmteste, was nicht nur daran liegt, dass sie die einzige mit Augenklappe ist. Seit dem Golfkrieg ist sie überall da, wo Kriege toben und Menschen, vor allem unschuldige Zivilisten sterben; immer ganz vorne an der Front und selten nur da, wo sie offiziell sein darf. Jeder dieser Kriege scheint schlimmer zu sein als der vorherige, aber im Schlimmsten involviert zu sein steht ihr erst noch bevor, als sie 2012 nach Homs reist..
Der Dokumentarfilmer Matthew Heinemann hat der wie eingangs erwähnt wohl bekanntesten und berühmtesten Kriegsberichterstatterinnen unserer Zeit ein Denkmal gesetzt, zeigt Colvin jedoch nicht als Bilderbuch-Heldin, wie sie wohl die Amerikaner während des 2. Weltkrieges inszeniert hätten.
Heinemanns Colvin ist eine Getriebene, die; wie sie selbst sagt, ´es hasse, in Kriegsgebieten zu sein, aber sie müsse es mit eigenen Augen sehen´. Es war ihr stärkstes Bedürfnis, bei der oft bewusst ahnungslosen und weg ignorierenden Menschheit den Finger in die Wunde zu legen und mit Wort und Bild ganz dicht drauf zu halten bei all dem Leid, das den Unschuldigen und Schutzlosesten widerfährt.
Colvin war so „privilegiert“ (wenn man das in diesem Zusammenhang so sagen darf), sich aufgrund ihres Rufes auch mit den widerlichsten Diktatoren treffen und sie interviewen zu können; der Mut der Frau ist erstaunlich: niemand sonst wohl hätte Muammar al Ghaddafi solche Fragen stellen und solche Aussagen treffen können.
Das Erlebte ließ Colvin nie los, verfolgte sie nicht nur in Träumen und ließ sich durch ihre Alkoholsucht erst recht nicht verdrängen. Schließlich kam 2012, was beinahe schon vorbestimmt war: bei einem Einsatz wurde Colvin im Artilleriefeuer in der syrischen Stadt Homs getötet.
Der Regisseur lässt den Zuschauer nicht nur an Einsätzen live und in Farbe teilhaben: so spürt man die Einschläge der Geschosse in unmittelbarer Nähe regelrecht mit. Auch die posttraumatische Belastungsstörung Colvins erleidet der Zuschauer mit, wenn Colvin die Bilder im Kopf verfolgen und sie selbst stark betrunken nur kurz loslassen.
Rosamund Pike spielt sich die Seele aus dem Leib, ist sehr eindringlich und gleichzeitig doch irgendwie angenehm unaufdringlich und authentisch. Hinzu kommt, dass Pike der echten Colvin recht ähnlich sieht.
Das Bild ist hervorragend. Es gibt kaum etwas zu bemängeln; die Parameter wie Schärfe, Kontrast und Schwarzwert sind top. Man hätte vermuten können, dass das Bild farblich verfremdet sein könnte, um die Atmosphäre zu verstärken: nix da, alles nahezu perfekt, ohne Korn, ohne Farbfilter, ohne Weichzeichner.
Der deutsche Sound liegt in DTS HD MA vor, der Sound ist ebenfalls hervorragend. Kurz nach dem Beginn ist man mittendrin im ersten Feuergefecht: die Schüsse peitschen hochdynamisch durchs Wohnzimmer, Einschläge und Abschüsse sind genau lokalisierbar; und der Bass grummelt perfekt abgestimmt dazu.
Extras habe ich wie üblich nicht angesehen. Ich vergebe 3 Balken. Die Scheibe hat ein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: „A Private War“ ist ein sehr authentisches und berührendes Biopic der wohl berühmtesten Kriegsberichterstatterinnen. Der Film setzt aber auch allen anderen Kriegsjournalisten ein Denkmal, die Tag für Tag in Krisengebieten ihr Leben riskieren, um die Weltbevölkerung hautnah am Unmöglichen teilhaben zu lassen. Die muss halt auch hin- und nicht wegsehen.
Der Dokumentarfilmer Matthew Heinemann hat der wie eingangs erwähnt wohl bekanntesten und berühmtesten Kriegsberichterstatterinnen unserer Zeit ein Denkmal gesetzt, zeigt Colvin jedoch nicht als Bilderbuch-Heldin, wie sie wohl die Amerikaner während des 2. Weltkrieges inszeniert hätten.
Heinemanns Colvin ist eine Getriebene, die; wie sie selbst sagt, ´es hasse, in Kriegsgebieten zu sein, aber sie müsse es mit eigenen Augen sehen´. Es war ihr stärkstes Bedürfnis, bei der oft bewusst ahnungslosen und weg ignorierenden Menschheit den Finger in die Wunde zu legen und mit Wort und Bild ganz dicht drauf zu halten bei all dem Leid, das den Unschuldigen und Schutzlosesten widerfährt.
Colvin war so „privilegiert“ (wenn man das in diesem Zusammenhang so sagen darf), sich aufgrund ihres Rufes auch mit den widerlichsten Diktatoren treffen und sie interviewen zu können; der Mut der Frau ist erstaunlich: niemand sonst wohl hätte Muammar al Ghaddafi solche Fragen stellen und solche Aussagen treffen können.
Das Erlebte ließ Colvin nie los, verfolgte sie nicht nur in Träumen und ließ sich durch ihre Alkoholsucht erst recht nicht verdrängen. Schließlich kam 2012, was beinahe schon vorbestimmt war: bei einem Einsatz wurde Colvin im Artilleriefeuer in der syrischen Stadt Homs getötet.
Der Regisseur lässt den Zuschauer nicht nur an Einsätzen live und in Farbe teilhaben: so spürt man die Einschläge der Geschosse in unmittelbarer Nähe regelrecht mit. Auch die posttraumatische Belastungsstörung Colvins erleidet der Zuschauer mit, wenn Colvin die Bilder im Kopf verfolgen und sie selbst stark betrunken nur kurz loslassen.
Rosamund Pike spielt sich die Seele aus dem Leib, ist sehr eindringlich und gleichzeitig doch irgendwie angenehm unaufdringlich und authentisch. Hinzu kommt, dass Pike der echten Colvin recht ähnlich sieht.
Das Bild ist hervorragend. Es gibt kaum etwas zu bemängeln; die Parameter wie Schärfe, Kontrast und Schwarzwert sind top. Man hätte vermuten können, dass das Bild farblich verfremdet sein könnte, um die Atmosphäre zu verstärken: nix da, alles nahezu perfekt, ohne Korn, ohne Farbfilter, ohne Weichzeichner.
Der deutsche Sound liegt in DTS HD MA vor, der Sound ist ebenfalls hervorragend. Kurz nach dem Beginn ist man mittendrin im ersten Feuergefecht: die Schüsse peitschen hochdynamisch durchs Wohnzimmer, Einschläge und Abschüsse sind genau lokalisierbar; und der Bass grummelt perfekt abgestimmt dazu.
Extras habe ich wie üblich nicht angesehen. Ich vergebe 3 Balken. Die Scheibe hat ein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: „A Private War“ ist ein sehr authentisches und berührendes Biopic der wohl berühmtesten Kriegsberichterstatterinnen. Der Film setzt aber auch allen anderen Kriegsjournalisten ein Denkmal, die Tag für Tag in Krisengebieten ihr Leben riskieren, um die Weltbevölkerung hautnah am Unmöglichen teilhaben zu lassen. Die muss halt auch hin- und nicht wegsehen.
mit 5
mit 5
mit 5
mit 3
bewertet am 20.04.19 um 11:24
Neulich, in L. A.: ausgerechnet in und um die Skid Row herum, einem der übelsten Viertel des Großstadt-Molochs, ist die Kriminalitätsrate gesunken. Warum? Nun, seit einigen Monaten merzt eine gar nicht mal so Fremde die Gang rund um den Drogen-Boss Garcia gnadenlos aus. Gar nicht mal so fremd ist die Frau, weil sie anhand verschiedener Spuren zweifelsfrei als Riley North identifiziert wird, und Riley hatte vor 5 Jahren Kontakt zur Polizei, als ihr Ehemann und ihre kleine Tochter von Garcias Gang getötet wurden. Die Täter wurden damals von der Justiz frei gesprochen, von Riley jedoch nicht..
Pierre Morel hat mal wieder einen Actioner inszeniert, nachdem der Franzose die Filmwelt mit dem beinahe schon zum Klassiker der Revenge-Thriller avancierten „96 Hours“ begeisterte. Aber bereits vorher hatte Morel mit „Ghetto Gangz“ einen Achtungserfolg zu verzeichnen, und auch „The Gunman“ fand ich besser als so mancher Kritiker. Lediglich „From Paris with Love“ fand ich seinerzeit nicht restlos gelungen.
Das Negative vorweg: „Peppermint“ (man muss den Film kennen, um zum Titel einen Bezug herstellen zu können) ist ein relativ banaler Revenge-Actioner von der Stange.
Nun zum Positiven: „Peppermint“ ist ein relativ banaler Revenge-Actioner von der Stange, denn der Film hält sich an die gängigen Genre-Klischees, wie man sie in Filmen wie „Ein Mann sieht rot“ mit Charles Bronson oder Bruce Willis in so ziemlich jedem Selbstjustiz-/Rachethriller zu sehen bekommt. Es entsteht weder eine Variation, schon gar keine Innovation und „Peppermint“ wandelt somit aus ausgetretenen, weil sicheren Pfaden. Das allerdings macht der Film so gut, dass man über die gesamte Laufzeit gut unterhalten wird und keine Langeweile aufkommt.
Irgendwie ist es immer wieder erstaunlich, wie die Menschen unnötigen Ballast wie Ethik abwerfen und andere Menschen bejubeln, die die Justiz in die eigenen Hände nehmen und nicht nur die Täter, sondern alle, die irgendwie damit zu tun haben auf grausamste Weise töten. Das lässt schon tief in die menschliche Seele blicken.
Aber zurück zum Film: wie gesagt macht der Streifen in seiner Schlichtheit fast alles richtig und nur wenig falsch; und Jennifer Garner darf mit vollem Körper- und noch mehr Waffeneinsatz (schade, dass nicht gezeigt wird, wo und wie sie ihre Ausbildung erfahren hat) alle niedermachen, die sich ihr in den Weg stellen.
Da ist auch die Crux und Schwachstelle des Films: wenigstens ein paar Minuten (und definitiv mehr als ein kurzer Youtube-Schnipsel) hätten es schon sein dürfen, um Garners Wandel von der fürsorglichen Mutter zur Kampfmaschine, die auch bei den Special Forces gut aufgehoben gewesen wäre glaubhaft zu schildern.
Das Bild ist sehr gut. Es gibt kaum etwas zu bemängeln; die Parameter wie Schärfe, Kontrast und Schwarzwert sind top. Die Schärfe lässt in der tiefe allerdings sichtbar nach, und mit der Plastizität ist es auch nicht so weit her. Dennoch: für 5 Balken reicht es.
Der deutsche Sound liegt in DTS HD MA vor. Der Sound ist recht ordentlich, aber beileibe nicht perfekt,. Dazu ist der Track deutlich zu leise abgemischt, das spricht für eine wenig dynamische Abmischung. Dreht man entsprechend höher, ballert und rumort es natürlich schon. Andere Abmischungen kriegen das jedoch ohne Lautstärkeanhebung hin.
Extras habe ich wie üblich nicht angesehen; besonders viele scheinen es allerdings nicht zu sein. Ich vergebe 2 Balken. Die Scheibe hat ein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: Irgendwo (ich glaube bei Filmstarts) hatte ich eine Kritik gelesen, wo „Peppermint“ nicht besonders gut wegkam. Jetzt, nach dem Sehen, kann ich das nur zu einem geringen Teil bestätigen. Wer einen Revenge-Thriller ansehen will, weiß schließlich worauf er sich einlässt, denn die Filme ähneln sich genau genommen allesamt sehr. Insofern macht „Angel of Vengeance“ so ziemlich alles richtig. Mission accomplished; Monsieur Morel.
Pierre Morel hat mal wieder einen Actioner inszeniert, nachdem der Franzose die Filmwelt mit dem beinahe schon zum Klassiker der Revenge-Thriller avancierten „96 Hours“ begeisterte. Aber bereits vorher hatte Morel mit „Ghetto Gangz“ einen Achtungserfolg zu verzeichnen, und auch „The Gunman“ fand ich besser als so mancher Kritiker. Lediglich „From Paris with Love“ fand ich seinerzeit nicht restlos gelungen.
Das Negative vorweg: „Peppermint“ (man muss den Film kennen, um zum Titel einen Bezug herstellen zu können) ist ein relativ banaler Revenge-Actioner von der Stange.
Nun zum Positiven: „Peppermint“ ist ein relativ banaler Revenge-Actioner von der Stange, denn der Film hält sich an die gängigen Genre-Klischees, wie man sie in Filmen wie „Ein Mann sieht rot“ mit Charles Bronson oder Bruce Willis in so ziemlich jedem Selbstjustiz-/Rachethriller zu sehen bekommt. Es entsteht weder eine Variation, schon gar keine Innovation und „Peppermint“ wandelt somit aus ausgetretenen, weil sicheren Pfaden. Das allerdings macht der Film so gut, dass man über die gesamte Laufzeit gut unterhalten wird und keine Langeweile aufkommt.
Irgendwie ist es immer wieder erstaunlich, wie die Menschen unnötigen Ballast wie Ethik abwerfen und andere Menschen bejubeln, die die Justiz in die eigenen Hände nehmen und nicht nur die Täter, sondern alle, die irgendwie damit zu tun haben auf grausamste Weise töten. Das lässt schon tief in die menschliche Seele blicken.
Aber zurück zum Film: wie gesagt macht der Streifen in seiner Schlichtheit fast alles richtig und nur wenig falsch; und Jennifer Garner darf mit vollem Körper- und noch mehr Waffeneinsatz (schade, dass nicht gezeigt wird, wo und wie sie ihre Ausbildung erfahren hat) alle niedermachen, die sich ihr in den Weg stellen.
Da ist auch die Crux und Schwachstelle des Films: wenigstens ein paar Minuten (und definitiv mehr als ein kurzer Youtube-Schnipsel) hätten es schon sein dürfen, um Garners Wandel von der fürsorglichen Mutter zur Kampfmaschine, die auch bei den Special Forces gut aufgehoben gewesen wäre glaubhaft zu schildern.
Das Bild ist sehr gut. Es gibt kaum etwas zu bemängeln; die Parameter wie Schärfe, Kontrast und Schwarzwert sind top. Die Schärfe lässt in der tiefe allerdings sichtbar nach, und mit der Plastizität ist es auch nicht so weit her. Dennoch: für 5 Balken reicht es.
Der deutsche Sound liegt in DTS HD MA vor. Der Sound ist recht ordentlich, aber beileibe nicht perfekt,. Dazu ist der Track deutlich zu leise abgemischt, das spricht für eine wenig dynamische Abmischung. Dreht man entsprechend höher, ballert und rumort es natürlich schon. Andere Abmischungen kriegen das jedoch ohne Lautstärkeanhebung hin.
Extras habe ich wie üblich nicht angesehen; besonders viele scheinen es allerdings nicht zu sein. Ich vergebe 2 Balken. Die Scheibe hat ein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: Irgendwo (ich glaube bei Filmstarts) hatte ich eine Kritik gelesen, wo „Peppermint“ nicht besonders gut wegkam. Jetzt, nach dem Sehen, kann ich das nur zu einem geringen Teil bestätigen. Wer einen Revenge-Thriller ansehen will, weiß schließlich worauf er sich einlässt, denn die Filme ähneln sich genau genommen allesamt sehr. Insofern macht „Angel of Vengeance“ so ziemlich alles richtig. Mission accomplished; Monsieur Morel.
mit 4
mit 5
mit 4
mit 2
bewertet am 17.04.19 um 16:32
Irgendwo, an einem von Norwegens Fjorden: bei dem Hotelier-Ehepaar Morten und Nina taucht unangekündigt die mindestens etwas strange Andrea auf. Die Frau ist (angeblich) Journalistin, hat ein in dieser Gegend wohl schwer zu bekommendes Messer mit einer 25 cm langen Klinge als Multifunktionswerkzeug in der Handtasche und will das Paar für ein Reisemagazin interviewen sowie einen größeren Artikel verfassen. Wie das Messer in der Handtasche schon andeutet, ist der Artikel allerdings nicht der einzige Grund, warum Andrea bei Morten und Nina aufgetaucht ist..
Hach, was war die Thematik vielversprechend, und Thriller aus dem hohen Norden sind für meinen Geschmack meistens recht gelungen. Atmosphärisch ist „Rache“ durchaus, und dazu kommen noch die oft spektakulären Aufnahmen rund um den Fjord. Der Film krankt jedoch an allerlei Logikfehlern, die den Genuss doch recht deutlich schmälern.
Von Anfang an ist klar: Andrea ist besonders auf Morten nicht gut zu sprechen (das Messer...), später erfährt man auch warum. Zu Beginn jedoch hätten die meisten Menschen die seltsame Frau entweder a) gar nicht erst ´reingelassen, b) gleich wieder ´rausgeschmissen oder c) im Hotelzimmer eingesperrt und die Polizei gerufen. Stattdessen wird die Dame fast schon in die Familie aufgenommen, kriegt schon mal das Baby anvertraut und kann so in aller Ruhe ihren perfiden Plan ausführen.
Der ganze Ort wird durch eine einzelne Person meistens nur mit einem Smartphone bewaffnet manipuliert und nur ein einziger merkt, dass alles mit der Ankunft einer Fremden begann.. Die Ortsansässigen scheinen allesamt nicht die hellsten Kerzen am Christbaum zu sein.
Hinzu kommt, dass „Revenge“ nicht gerade straff inszeniert ist (eher das Gegenteil) und erst zum Ende hin etwas Fahrt aufnimmt, wo ohnehin das Kind schon im Brunnen ist.
Das Bild ist gut, mehr nicht. In „Rache“ wird recht oft, wenn auch dezent, mit Farbfiltern gearbeitet, so dass die meisten anderen Einstellungen eher bläulich-gräulich wirken. Hat natürlich hauch mit der relativ schattigen Naturkulisse im Fjord zu tun. Alles in allem ist das Bild nicht wirklich schlecht, aber eben auch nicht wirklich gut.
Der deutsche Sound liegt in DTS HD MA vor. Der Sound ist recht ordentlich und wartet ab und an mit verblüffend genau ortbaren Effekten auf. Basseinsatz kommt kein einziges Mal vor, und Dynamik kaum öfter. Der Film wird von Dialogen dominiert, da ist nix mit Soundeffekten.
Extras habe ich wie üblich nicht angesehen; ich vergebe den Mittelwert. Die Scheibe hat ein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: Schade. Von skandinavischen Thrillern erwarte ich mir von vorne herein viel, und in aller Regel werde ich auch nicht enttäuscht. Auch von „Rache“ hatte ich mir viel erwartet, sprachen doch Story und Location eine deutliche Sprache. Denkste: Atmosphäre erzeugt „Rache“ zwar, Spannung schon weniger; hinzu kommen die seltsamen und nicht nachvollziehbaren Handlungen aller Beteiligten. Muss man nicht gesehen haben.
Hach, was war die Thematik vielversprechend, und Thriller aus dem hohen Norden sind für meinen Geschmack meistens recht gelungen. Atmosphärisch ist „Rache“ durchaus, und dazu kommen noch die oft spektakulären Aufnahmen rund um den Fjord. Der Film krankt jedoch an allerlei Logikfehlern, die den Genuss doch recht deutlich schmälern.
Von Anfang an ist klar: Andrea ist besonders auf Morten nicht gut zu sprechen (das Messer...), später erfährt man auch warum. Zu Beginn jedoch hätten die meisten Menschen die seltsame Frau entweder a) gar nicht erst ´reingelassen, b) gleich wieder ´rausgeschmissen oder c) im Hotelzimmer eingesperrt und die Polizei gerufen. Stattdessen wird die Dame fast schon in die Familie aufgenommen, kriegt schon mal das Baby anvertraut und kann so in aller Ruhe ihren perfiden Plan ausführen.
Der ganze Ort wird durch eine einzelne Person meistens nur mit einem Smartphone bewaffnet manipuliert und nur ein einziger merkt, dass alles mit der Ankunft einer Fremden begann.. Die Ortsansässigen scheinen allesamt nicht die hellsten Kerzen am Christbaum zu sein.
Hinzu kommt, dass „Revenge“ nicht gerade straff inszeniert ist (eher das Gegenteil) und erst zum Ende hin etwas Fahrt aufnimmt, wo ohnehin das Kind schon im Brunnen ist.
Das Bild ist gut, mehr nicht. In „Rache“ wird recht oft, wenn auch dezent, mit Farbfiltern gearbeitet, so dass die meisten anderen Einstellungen eher bläulich-gräulich wirken. Hat natürlich hauch mit der relativ schattigen Naturkulisse im Fjord zu tun. Alles in allem ist das Bild nicht wirklich schlecht, aber eben auch nicht wirklich gut.
Der deutsche Sound liegt in DTS HD MA vor. Der Sound ist recht ordentlich und wartet ab und an mit verblüffend genau ortbaren Effekten auf. Basseinsatz kommt kein einziges Mal vor, und Dynamik kaum öfter. Der Film wird von Dialogen dominiert, da ist nix mit Soundeffekten.
Extras habe ich wie üblich nicht angesehen; ich vergebe den Mittelwert. Die Scheibe hat ein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: Schade. Von skandinavischen Thrillern erwarte ich mir von vorne herein viel, und in aller Regel werde ich auch nicht enttäuscht. Auch von „Rache“ hatte ich mir viel erwartet, sprachen doch Story und Location eine deutliche Sprache. Denkste: Atmosphäre erzeugt „Rache“ zwar, Spannung schon weniger; hinzu kommen die seltsamen und nicht nachvollziehbaren Handlungen aller Beteiligten. Muss man nicht gesehen haben.
mit 3
mit 4
mit 4
mit 3
bewertet am 17.04.19 um 13:04
Sam ist nicht nur Bodyguard, sondern der erste (englische) weibliche Bodyguard. Nach einem belastenden Einsatz irgendwo im Mittleren Osten bekommt sie einen weiteren, vermeintlich leichteren Auftrag, den sie eher widerwillig annimmt: sie soll die Alleinerbin eines börsennotierten Konzerns beschützen, da ihr Vater, der Konzernchef, jüngst verstarb. Die Stiefmutter ist eher mürrisch und unfroh ob der Tatsache, dass das Stieftöchterlein alleine alles erbt; ganz besonders aufgrund der Tatsache, dass durch die Erbschaft der Tochter gerade jetzt ein milliardenschwerer Deal um Land zu platzen droht und dann die Aktien einknicken könnten. Sam soll die Tochter namens Zoe auf einem abgelegenen Luxus-Anwesen mit hochentwickelten Sicherheitssystemen irgendwo in Marokko bewachen, doch plötzlich werden sie angegriffen: Zoe soll entführt werden. Und nun ratet mal, wer das alles in die Wege geleitet hat..
„Close“ basiert wohl auf Erfahrungen der ersten britischen Leibwächterin Jacquie Davis, die auch als Beraterin mitwirkte.
„Close“ beginnt super: beim Einstieg wird in einer packenden Actionszene gezeigt, wie gut die Frau taktisch ausgebildet ist, und wie sie in einer lebensbedrohlichen Situation kühlen Kopf behält und die Lage meistert.
Insgesamt hält „Close“ gut die Waage zwischen Actionsequenzen und ruhigeren Phasen, in denen Noomi Rapaces Figur ihre Gefühlswelt ob des Erlebten preisgibt: Sam betreibt exzessiv Sport, qualmt wie ein Schlot und ist dem einen oder anderen Schluck zum Vergessen nicht abgeneigt. Und dennoch sind die Ausschläge des Spannungs-Oszilloskops zu gering: der Wellengang der Amplituden zwischen Action und langsameren Passagen ist einfach zu niedrig, und so mäandert „Close“ ein wenig unetschlossen zwischen Drama und Action hin und her. „Close“ ist letztendlich ein relativ gewöhnlicher Thriller um einen Bodyguard, nur dass der Bodyguard eben eine Frau ist. Nebenbei krankt „Close“ ein wenig an der Tatsache, dass neben der eigentlichen Story um die Flucht von Protegée und Bodyguard immer wieder zu sehr auf die Firmen- und Börsengeschichte fokussiert wird. Das nimmt nicht selten an den falschen Stellen Drive heraus, hemmt ab und an den Erzählfluss und macht den Film mitunter etwas zäh.
Das Bild ist gut, mehr nicht. In „Close“ wird recht oft, wenn auch dezent, mit Farbfiltern gearbeitet, so dass die Anfangssequenz in der Wüste erdig-bräunlich und gelblich verfremdet wurde, während die meisten anderen Einstellungen eher bläulich-gräulich wirken. Mit dem Schwarzwert steht es auch nicht zum Besten. Alles in allem ist das Bild nicht wirklich schlecht, aber eben auch nicht wirklich gut.
Der deutsche Sound liegt in DTS HD MA vor. Wie das Bild ist der Sound deutlich davon entfernt, top zu sein. Das (Action-) Geschehen wirkt mitunter etwas frontlastig. Bass und Dynamik gehen zwar in Ordnung, aber die Surroundkulisse und die direktionalen Effekte hätten durchaus etwas mehr auf die Surrounds und die Backsurrounds gemischt werden dürfen.
Extras habe ich wie üblich nicht angesehen; ich vergebe den Mittelwert. Die Scheibe hat ein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: allzu viel hatte ich mir von „Close“ nicht versprochen, da die Thematik nichts neues verhieß und ein Plot um eine Schutzbefohlene, die mit ihrem Bodyguard flüchtet nicht gerade innovativ wirkte. Dennoch versprach „Close“, ein actionreicher Thriller zu sein, und Noomi Rapace sehe ich eigentlich gern. „Close“ ist jedoch ein Thriller von der Stange, wie man sie aus dem Genre haufenweise kennt; und nicht mal ein wirklich guter. Muss man nicht gesehen haben. Das hat aber rein gar nix mit dem Releasepreis zu tun..
„Close“ basiert wohl auf Erfahrungen der ersten britischen Leibwächterin Jacquie Davis, die auch als Beraterin mitwirkte.
„Close“ beginnt super: beim Einstieg wird in einer packenden Actionszene gezeigt, wie gut die Frau taktisch ausgebildet ist, und wie sie in einer lebensbedrohlichen Situation kühlen Kopf behält und die Lage meistert.
Insgesamt hält „Close“ gut die Waage zwischen Actionsequenzen und ruhigeren Phasen, in denen Noomi Rapaces Figur ihre Gefühlswelt ob des Erlebten preisgibt: Sam betreibt exzessiv Sport, qualmt wie ein Schlot und ist dem einen oder anderen Schluck zum Vergessen nicht abgeneigt. Und dennoch sind die Ausschläge des Spannungs-Oszilloskops zu gering: der Wellengang der Amplituden zwischen Action und langsameren Passagen ist einfach zu niedrig, und so mäandert „Close“ ein wenig unetschlossen zwischen Drama und Action hin und her. „Close“ ist letztendlich ein relativ gewöhnlicher Thriller um einen Bodyguard, nur dass der Bodyguard eben eine Frau ist. Nebenbei krankt „Close“ ein wenig an der Tatsache, dass neben der eigentlichen Story um die Flucht von Protegée und Bodyguard immer wieder zu sehr auf die Firmen- und Börsengeschichte fokussiert wird. Das nimmt nicht selten an den falschen Stellen Drive heraus, hemmt ab und an den Erzählfluss und macht den Film mitunter etwas zäh.
Das Bild ist gut, mehr nicht. In „Close“ wird recht oft, wenn auch dezent, mit Farbfiltern gearbeitet, so dass die Anfangssequenz in der Wüste erdig-bräunlich und gelblich verfremdet wurde, während die meisten anderen Einstellungen eher bläulich-gräulich wirken. Mit dem Schwarzwert steht es auch nicht zum Besten. Alles in allem ist das Bild nicht wirklich schlecht, aber eben auch nicht wirklich gut.
Der deutsche Sound liegt in DTS HD MA vor. Wie das Bild ist der Sound deutlich davon entfernt, top zu sein. Das (Action-) Geschehen wirkt mitunter etwas frontlastig. Bass und Dynamik gehen zwar in Ordnung, aber die Surroundkulisse und die direktionalen Effekte hätten durchaus etwas mehr auf die Surrounds und die Backsurrounds gemischt werden dürfen.
Extras habe ich wie üblich nicht angesehen; ich vergebe den Mittelwert. Die Scheibe hat ein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: allzu viel hatte ich mir von „Close“ nicht versprochen, da die Thematik nichts neues verhieß und ein Plot um eine Schutzbefohlene, die mit ihrem Bodyguard flüchtet nicht gerade innovativ wirkte. Dennoch versprach „Close“, ein actionreicher Thriller zu sein, und Noomi Rapace sehe ich eigentlich gern. „Close“ ist jedoch ein Thriller von der Stange, wie man sie aus dem Genre haufenweise kennt; und nicht mal ein wirklich guter. Muss man nicht gesehen haben. Das hat aber rein gar nix mit dem Releasepreis zu tun..
mit 3
mit 4
mit 4
mit 3
bewertet am 14.04.19 um 11:38
Irgendwann, in der Zukunft: autonomes Fahren mit Elektro-Autos ist die Regel, selbständiges Fahren mit Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor die absolute Ausnahme. Der angenehm ewig gestrige Schrauber Grey bringt eine der Ausnahmen, einen Camaro (mit sehr geilem Sound, by the way..), zu dem mindestens etwas seltsamen Software-Guru Eron, der ihm dabei einen Blick in die noch zukünftigere Zukunft gewährt: Eron stellt Grey den Super-Chip STEM vor, der (Zitat) „alles kann. Alles ist möglich.“ Auf dem Nachhauseweg im absolut todsicher autonom gesteuerten Elektro-Auto geschieht das eigentlich unmögliche: das System verliert die Kontrolle über das Auto; dieses baut einen spektakulären Unfall. Als wäre das nicht schlimm genug werden die beiden auch noch überfallen. Ergebnis und Siegerehrung: Greys Frau Asha wird getötet, er selbst in die Querschnittslähmung geschossen. Wieder auf den Beinen (sprich: im Rollstuhl) unterbreitet Eron Grey einen Vorschlag: mit dem implantierten STEM könnte Grey wieder die Kontrolle über seinen Körper erlangen. Und so kommt es auch, allerdings nutzt Grey STEM nicht nur dafür...
„Upgrade“ wurde im Voraus vielerorts recht bejubelt, und jetzt nach der Sichtung kann ich den Jubel nachvollziehen und durchaus bestätigen.
„Upgrade“ ist in einer hochtechnisierten Zukunft angesiedelt: jede Tätigkeit und Kleinigkeit im täglichen Leben wird mit Computern erledigt und abgearbeitet, die mit Sprach- und Gestensteuerung versehen sind und gewissermaßen allesamt über eine hochentwickelte künstliche Intelligenz verfügen. In diesem Szenario wirkt der Mechaniker Grey per se schon wie ein Fremdkörper, und die unterschiedlichen Weltsichten prallen bei der Übergabe des Oldtimers sehr deutlich aufeinander. Ausgerechnet ihm (leider erkennt man da und vorher überdeutlich den Storytwist, der dadurch eigentlich schon keiner mehr ist) bietet der Software-Visionär an, ihm einen revolutionären Chip einzupflanzen, der die unterbrochene Reizleitung übernehmen würde. Grey jedoch, seines Lebensinhaltes beraubt, begibt sich auf einen gnadenlosen Rachefeldzug, zu dem ihn der Super-Chip geradezu manipuliert.
Wenn man es genau nimmt, ist „Upgrade“ bis dahin nichts neues, ähnliche Stories hat man z. B. in „RoboCop“ schon öfter mal auf der Mattscheibe gesehen. Als Grey STEM jedoch die Führung überlässt, wandelt sich der Film zu einem ziemlich brutalen Actioner, der verblüffende und genial anzusehende Kampfchoreographien aufweist. Dabei wird auf den Einsatz von Wackelkameras verzichtet, und man kann die Fights „in aller Ruhe“ genießen.
Das Besondere und witzig-satirische dabei ist, dass der eigentlich friedliche Grey so ganz und gar nicht damit einverstanden ist, was der rational-emotionslose Chip durch seinen Körper mit seinen Gegnern so alles anrichtet und nach den brutalen Kills schuldbewusst und verzweifelt entsprechende Dialoge mit STEM hält. In dieser Hinsicht ähnelt „Upgrade“ durchaus ein wenig „Venom“, wie auch der Hauptdarsteller Tom Hardy ziemlich ähnlich sieht. Allerdings ist „Upgrade“ der bessere „Venom“. Der deutlich bessere sogar.
Insgesamt betrachtet bietet „Upgrade“ eine an sich gewöhnliche, banale Rachestory; präsentiert diese jedoch als erfrischend innovative Variation. Hinzu kommen die ungewöhnlichen, tollen Schauwerte, die „Upgrade“ bietet: besonders die Architektur ist außergewöhnlich, und manche Einstellungen sind kleine optische Kunstwerke. Das fängt schon mit dem Intro an und setzt sich beim Unfall und manchen Kampf-Choreos fort.
Das Bild ist toll. Schärfe, Tiefenschärfe, Kontrast und Schwarzwert sind sehr gut; auch die Plastizität ist toll. Nur in ein, zwei Szenen wirkt das Gesehen minimal unscharf. Trotz der Tatsache, dass nahezu alle Szenen bei Nacht oder im Halbdunklen spielen sind alle Details perfekt herausgebildet. Das Bild wirkt trotz verschiedener Stilmittel weitestgehend natürlich.
Der Sound wird von meinem Receiver mit Dolby Digital EX reproduziert. Der Track ist über fast jeden Zweifel erhaben. „Upgrade“ hat Bass und Dynamik satt, die Surroundkulisse ist stets sehr gut vernehmbar, und auch direktionale Effekte sind sehr gut ortbar. Insgesamt betrachtet ein nicht perfekter, aber sehr guter Track.
Extras habe ich wie üblich nicht angesehen; ich vergebe den Mittelwert. Die Scheibe hat ein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: Normalerweise bin ich von vorne herein eher etwas skeptisch, wenn ein Film über den grünen Klee gelobt wird. „Upgrade“ jedoch hat das Lob redlich verdient: der Film ist trotz des früh preisgegebenen Twists spannend, hervorragend choreographiert und teils verblüffend brutal. „Upgrade“ ist mir eine uneingeschränkte Empfehlung für Action- und Science Fiction-Fans wert. Geiler Film, zwar kein Action-Brett, aber ein Film mit Bretter-Actionszenen gewissermaßen.
„Upgrade“ wurde im Voraus vielerorts recht bejubelt, und jetzt nach der Sichtung kann ich den Jubel nachvollziehen und durchaus bestätigen.
„Upgrade“ ist in einer hochtechnisierten Zukunft angesiedelt: jede Tätigkeit und Kleinigkeit im täglichen Leben wird mit Computern erledigt und abgearbeitet, die mit Sprach- und Gestensteuerung versehen sind und gewissermaßen allesamt über eine hochentwickelte künstliche Intelligenz verfügen. In diesem Szenario wirkt der Mechaniker Grey per se schon wie ein Fremdkörper, und die unterschiedlichen Weltsichten prallen bei der Übergabe des Oldtimers sehr deutlich aufeinander. Ausgerechnet ihm (leider erkennt man da und vorher überdeutlich den Storytwist, der dadurch eigentlich schon keiner mehr ist) bietet der Software-Visionär an, ihm einen revolutionären Chip einzupflanzen, der die unterbrochene Reizleitung übernehmen würde. Grey jedoch, seines Lebensinhaltes beraubt, begibt sich auf einen gnadenlosen Rachefeldzug, zu dem ihn der Super-Chip geradezu manipuliert.
Wenn man es genau nimmt, ist „Upgrade“ bis dahin nichts neues, ähnliche Stories hat man z. B. in „RoboCop“ schon öfter mal auf der Mattscheibe gesehen. Als Grey STEM jedoch die Führung überlässt, wandelt sich der Film zu einem ziemlich brutalen Actioner, der verblüffende und genial anzusehende Kampfchoreographien aufweist. Dabei wird auf den Einsatz von Wackelkameras verzichtet, und man kann die Fights „in aller Ruhe“ genießen.
Das Besondere und witzig-satirische dabei ist, dass der eigentlich friedliche Grey so ganz und gar nicht damit einverstanden ist, was der rational-emotionslose Chip durch seinen Körper mit seinen Gegnern so alles anrichtet und nach den brutalen Kills schuldbewusst und verzweifelt entsprechende Dialoge mit STEM hält. In dieser Hinsicht ähnelt „Upgrade“ durchaus ein wenig „Venom“, wie auch der Hauptdarsteller Tom Hardy ziemlich ähnlich sieht. Allerdings ist „Upgrade“ der bessere „Venom“. Der deutlich bessere sogar.
Insgesamt betrachtet bietet „Upgrade“ eine an sich gewöhnliche, banale Rachestory; präsentiert diese jedoch als erfrischend innovative Variation. Hinzu kommen die ungewöhnlichen, tollen Schauwerte, die „Upgrade“ bietet: besonders die Architektur ist außergewöhnlich, und manche Einstellungen sind kleine optische Kunstwerke. Das fängt schon mit dem Intro an und setzt sich beim Unfall und manchen Kampf-Choreos fort.
Das Bild ist toll. Schärfe, Tiefenschärfe, Kontrast und Schwarzwert sind sehr gut; auch die Plastizität ist toll. Nur in ein, zwei Szenen wirkt das Gesehen minimal unscharf. Trotz der Tatsache, dass nahezu alle Szenen bei Nacht oder im Halbdunklen spielen sind alle Details perfekt herausgebildet. Das Bild wirkt trotz verschiedener Stilmittel weitestgehend natürlich.
Der Sound wird von meinem Receiver mit Dolby Digital EX reproduziert. Der Track ist über fast jeden Zweifel erhaben. „Upgrade“ hat Bass und Dynamik satt, die Surroundkulisse ist stets sehr gut vernehmbar, und auch direktionale Effekte sind sehr gut ortbar. Insgesamt betrachtet ein nicht perfekter, aber sehr guter Track.
Extras habe ich wie üblich nicht angesehen; ich vergebe den Mittelwert. Die Scheibe hat ein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: Normalerweise bin ich von vorne herein eher etwas skeptisch, wenn ein Film über den grünen Klee gelobt wird. „Upgrade“ jedoch hat das Lob redlich verdient: der Film ist trotz des früh preisgegebenen Twists spannend, hervorragend choreographiert und teils verblüffend brutal. „Upgrade“ ist mir eine uneingeschränkte Empfehlung für Action- und Science Fiction-Fans wert. Geiler Film, zwar kein Action-Brett, aber ein Film mit Bretter-Actionszenen gewissermaßen.
mit 5
mit 5
mit 5
mit 3
bewertet am 13.04.19 um 13:30
Juni 1944, D-Day: im Rahmen der Operation „Overlord“, der alliierten Invasion an der Küste der Normandie, springt die 101st Airborne Division hinter den feindlichen Linien ab. Einige der wenigen, die den Erdboden lebend erreichen haben den Auftrag, eine deutsche Funkstation in der Kirche eines kleinen Dorfes zu vernichten, von der aus das feindliche Flak-Feuer koordiniert wird. Als die kleine Gruppe mit Hilfe einer Bewohnerin in das Dorf gesickert ist und ihren Auftrag im Haus der jungen Frau vorbereitet, bemerken sie anhand der akustischen Krankheitssymptome der Tante schnell, dass da noch etwas vorgeht. Als der farbige Soldat eher zufällig in die Kirche gerät, entdeckt er ein furchterregendes Geheimnis: die SS betreibt im Gewölbe ein streng geheimes und gut bewachtes Forschungslabor, in dem versucht wird, tote deutsche Soldaten mit übermenschlichen Kräften zum Leben zu erwecken und so doch noch den Endsieg zu erzielen..
J. J. Abrams, Garant für Action-Kino mit wenigstens ein bisschen Anspruch, hat produziert; inszeniert hat der Australier Julius Avery, der mir bereits mit „Son of a Gun“ positiv in Erinnerung war. Herausgekommen ist eine Art „From Dusk till Dawn“ statt mit psychopathischen Killern mit Soldaten und statt Vampiren mit untoten deutschen Soldaten. Eklatanter Unterschied zwischen beiden Filmen: „Operation Overlord“ nimmt sich angenehm ernst (nicht falsch verstehen: „From Dusk till Dawn“ finde ich genial), da ist nicht der geringste Hauch von Humor, Satire oder Ironie erkennbar.
Bis etwa knapp zur Mitte des Films ist „Overlord“ (so der Originaltitel) ein reinrassiger Kriegsfilm, als die 101st Airborne Division anfliegt, in starkes Flakfeuer gerät und bereits in der Luft große Verluste hinnehmen muss. Die Action in diesem Teil ist zwar nicht neu, aber beeindruckend intensiv in Szene gesetzt. Die Wackelkamera wird zwar ausgiebig benutzt, dennoch bleibt das Geschehen weitestgehend übersichtlich und man fühlt sich mittendrin statt nur dabei. Die permanent bedrohliche Atmosphäre durch die Aufklärung durch Deutsche ist danach stets fühlbar und wird nach dem Erreichen des Dorfes noch stärker: andauernd können sich die Amerikaner gerade noch so der Entdeckung entziehen. Im Dorf kommt dann die große Stunde des eigentlichen Hauptdarstellers: der Däne Pilou Asbæk („Ghost in the Shell“) stiehlt allen schauspielerisch die Schau und setzt den SS-Offizier abgrundtief böse in Szene. Mit der Entdeckung des unterirdischen Forschungslabor nimmt der Film dann den Twist Richtung Horror-Thriller, ab dann dreht Julius Avery noch ein Stück mehr an der ohnehin schon mit ordentlich Drehmoment angezogenen Spannungsschraube.
Hier sind es dann vor allem die allesamt handgemachten Masken, die begeistern und der Score, der die Spannung hervorragend fördert. Hier weisen einige Opfer Deformierungen auf, die durchaus an den Film „Das Ding aus einer anderen Welt“ erinnern, der hier vielleicht für das Creature Design Pate stand.
Manche, die zwischen Realität und fiktionaler Filmstory nicht unterscheiden können dürften vielleicht bemängeln, dass die Deutschen samt und sonders schlecht und verabscheuenswürdig dargestellt werden. Dem entgegen steht der amerikanische Corporal, der durchaus auch einen Hang zum Sadismus zeigt.
Das Bild ist toll, wenn auch in manchen Szenen etwas zu hochglanzprospektartig. Schärfe, Tiefenschärfe, Kontrast und Schwarzwert sind sehr gut; auch die Plastizität ist toll. Trotz der Tatsache, dass nahezu alle Szenen bei Nacht oder im Halbdunklen spielen sind alle Details perfekt herausgebildet. Das Bild wirkt trotz verschiedener Stilmittel weitestgehend natürlich, dadurch gewinnt der Film zusätzlich noch an Authentizität.
Der Sound liegt zwar in Atmos vor, das kann man aber natürlich nur mit entsprechender Technik nutzen. Der Dolby Digital-Track jedoch ist ebenfalls über fast jeden Zweifel erhaben. „Operation Overlord“ hat Bass und Dynamik satt, bei manchen Abschussgeräuschen von Gewehren ist das fast zu viel des Guten und wirkt unnatürlich; das jedoch ist Meckern auf höchstem Niveau. Die Surroundkulisse ist stets sehr gut vernehmbar, und auch direktionale Effekte sind perfekt ortbar. Irre: ein Soldat schießt seinen Munitionsstreifen leer, und der Aufprall des Magazinbodens auf den Brettern ist im Geballer glasklar zu hören.
Extras: wie üblich nicht angesehen, ich übernehme die Review-Wertung. Die Scheibe hat ein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: „Operation Overlord“ ist trotz der Thematik in der 2. Hälfte irgendwie geerdet und realistisch, man bekommt als Zuschauer nie das Gefühl, dass sich das nicht tatsächlich so ereignet haben könnte. Das ist wohl das größte Kompliment, das man den Filmemachern machen kann. Daneben ist der Film sauspannend und teils bockbrutal. „Operation Overlord“ sollte sich kein Action-Fan entgehen lassen. Eigentlich gebe ich solchen Filmen ungern die Höchstwertung, da ich mir das für Filme mit mehr Anspruch aufhebe; aber in seinem Genre hat „Overlord“ 5 Balken verdient. Zumal außerdem die Technik auch noch allerfeinste Sahne ist.
J. J. Abrams, Garant für Action-Kino mit wenigstens ein bisschen Anspruch, hat produziert; inszeniert hat der Australier Julius Avery, der mir bereits mit „Son of a Gun“ positiv in Erinnerung war. Herausgekommen ist eine Art „From Dusk till Dawn“ statt mit psychopathischen Killern mit Soldaten und statt Vampiren mit untoten deutschen Soldaten. Eklatanter Unterschied zwischen beiden Filmen: „Operation Overlord“ nimmt sich angenehm ernst (nicht falsch verstehen: „From Dusk till Dawn“ finde ich genial), da ist nicht der geringste Hauch von Humor, Satire oder Ironie erkennbar.
Bis etwa knapp zur Mitte des Films ist „Overlord“ (so der Originaltitel) ein reinrassiger Kriegsfilm, als die 101st Airborne Division anfliegt, in starkes Flakfeuer gerät und bereits in der Luft große Verluste hinnehmen muss. Die Action in diesem Teil ist zwar nicht neu, aber beeindruckend intensiv in Szene gesetzt. Die Wackelkamera wird zwar ausgiebig benutzt, dennoch bleibt das Geschehen weitestgehend übersichtlich und man fühlt sich mittendrin statt nur dabei. Die permanent bedrohliche Atmosphäre durch die Aufklärung durch Deutsche ist danach stets fühlbar und wird nach dem Erreichen des Dorfes noch stärker: andauernd können sich die Amerikaner gerade noch so der Entdeckung entziehen. Im Dorf kommt dann die große Stunde des eigentlichen Hauptdarstellers: der Däne Pilou Asbæk („Ghost in the Shell“) stiehlt allen schauspielerisch die Schau und setzt den SS-Offizier abgrundtief böse in Szene. Mit der Entdeckung des unterirdischen Forschungslabor nimmt der Film dann den Twist Richtung Horror-Thriller, ab dann dreht Julius Avery noch ein Stück mehr an der ohnehin schon mit ordentlich Drehmoment angezogenen Spannungsschraube.
Hier sind es dann vor allem die allesamt handgemachten Masken, die begeistern und der Score, der die Spannung hervorragend fördert. Hier weisen einige Opfer Deformierungen auf, die durchaus an den Film „Das Ding aus einer anderen Welt“ erinnern, der hier vielleicht für das Creature Design Pate stand.
Manche, die zwischen Realität und fiktionaler Filmstory nicht unterscheiden können dürften vielleicht bemängeln, dass die Deutschen samt und sonders schlecht und verabscheuenswürdig dargestellt werden. Dem entgegen steht der amerikanische Corporal, der durchaus auch einen Hang zum Sadismus zeigt.
Das Bild ist toll, wenn auch in manchen Szenen etwas zu hochglanzprospektartig. Schärfe, Tiefenschärfe, Kontrast und Schwarzwert sind sehr gut; auch die Plastizität ist toll. Trotz der Tatsache, dass nahezu alle Szenen bei Nacht oder im Halbdunklen spielen sind alle Details perfekt herausgebildet. Das Bild wirkt trotz verschiedener Stilmittel weitestgehend natürlich, dadurch gewinnt der Film zusätzlich noch an Authentizität.
Der Sound liegt zwar in Atmos vor, das kann man aber natürlich nur mit entsprechender Technik nutzen. Der Dolby Digital-Track jedoch ist ebenfalls über fast jeden Zweifel erhaben. „Operation Overlord“ hat Bass und Dynamik satt, bei manchen Abschussgeräuschen von Gewehren ist das fast zu viel des Guten und wirkt unnatürlich; das jedoch ist Meckern auf höchstem Niveau. Die Surroundkulisse ist stets sehr gut vernehmbar, und auch direktionale Effekte sind perfekt ortbar. Irre: ein Soldat schießt seinen Munitionsstreifen leer, und der Aufprall des Magazinbodens auf den Brettern ist im Geballer glasklar zu hören.
Extras: wie üblich nicht angesehen, ich übernehme die Review-Wertung. Die Scheibe hat ein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: „Operation Overlord“ ist trotz der Thematik in der 2. Hälfte irgendwie geerdet und realistisch, man bekommt als Zuschauer nie das Gefühl, dass sich das nicht tatsächlich so ereignet haben könnte. Das ist wohl das größte Kompliment, das man den Filmemachern machen kann. Daneben ist der Film sauspannend und teils bockbrutal. „Operation Overlord“ sollte sich kein Action-Fan entgehen lassen. Eigentlich gebe ich solchen Filmen ungern die Höchstwertung, da ich mir das für Filme mit mehr Anspruch aufhebe; aber in seinem Genre hat „Overlord“ 5 Balken verdient. Zumal außerdem die Technik auch noch allerfeinste Sahne ist.
mit 5
mit 5
mit 5
mit 4
bewertet am 22.03.19 um 08:37
In den USA, in naher Zukunft (vielleicht auch gerade eben..): Kane, der Ehemann der ehemaligen Soldatin und Biologin Lena, ebenfalls Soldat, kehrt nach 12 langen Monaten überraschend von einem Einsatz zurück. Die ganze Zeit hatte Lena nichts von ihrem Mann gehört; der Einsatz war streng geheim und auch die Angehörigen des Teams von Kane waren die ganze Zeit ahnungslos. Kane ist völlig verändert, hat keinerlei Erinnerungen an den Schimmer, ist schwerkrank und wird beim Krankentransport durch schwer bewaffnete Truppen in Quarantäne genommen. Dabei wird Lena in ein Geheimnis eingewiesen: Nach einem Meteoriteneinschlag ist ein Territorium rund um den getroffenen Leuchtturm vom sogenannten „Schimmer“ bedeckt; einer seltsam organisch wirkenden, passierbaren Art Kuppel, die sich beständig ausweitet und offensichtlich Fauna und Flora verändert. Ein Team von Naturwissenschaftlern, alles Frauen, soll den Schimmer erkunden, und Lena schließt sich an, um quasi an der Basis für die Therapie ihres Mannes zu forschen. Problem: außer Kane kam bislang kein Mitglied eines Teams aus dem Schimmer zurück..
Alex Garland ist ein Multitalent: der Brite hat die Romanvorlage zu „The Beach“ und als Drehbuchautor zum Beispiel die Drehbücher zu Danny Boyles „Sunshine“ und „28 Days Later“ geschrieben. 2015 hat der Engländer dann begonnen, Filme auch zu drehen und hat mit „Ex Machina“ einen vielbeachteten Achtungserfolg vorgelegt. Mit „Auslöschung“ hat Garland nun seinen zweiten Spielfilm inszeniert, der zunächst nur auf Netflix lief und nun auf Blu-ray veröffentlicht wurde.
„Auslöschung“ wurde nahezu ausnahmslos beinahe schon frenetisch bejubelt. Tatsächlich bietet der Film ein gewisses faszinierendes Durcheinander verschiedener Genres: zu Beginn wird ob der Ungewissheit, was als nächstes passieren könnte ordentlich Atmosphäre erzeugt, als der Ehemann überraschend völlig verändert als einziger zurückkommt. Danach wandelt sich der Film (kurz) zum Tech-Thriller, nur um kurz darauf mit dem Eindringen in den Schimmer eine Weile Mystery-Elemente gemischt mit ein paar Creature Feature-Attributen aufzuweisen. Ihr Übriges tun die grandiosen Regenwald-Kulissen mit den verlassenen menschlichen Niederlassungen, die durch die fremdartig mutierten Pflanzen in Beschlag genommen werden. Zum Ende hin wird „Auslöschung“ dann schon fast zu einem psychedelischen Psycho-Trip, der einem LSD-vernebelten Gehirn entsprungen zu sein scheint; etwas, was mir den Genuß zum Ende hin etwas verhagelt hat.
Mitdenken ist angesagt bei „Auslöschung“, und trotz des permanenten Mitdenkens bin ich mir nicht sicher, ob ich den Film völlig verstanden habe. Meine eigene Interpretation behalte ich zunächst für mich, um nicht zu spoilern. „Auslöschung“ ist für mich bis zum Beginn des Finales ein großartiger Film: atmosphärisch, spannend und anspruchsvoll. Mir persönlich war das Ende dann too much: das war vom Sinn, der Aussage und der Optik her deutlich over the top.
Gleichwohl das Ausgangsmaterial des Bildes für Netflix in 4K vorlag, muss man bei der BD ziemliche Abstriche machen. Diese Abstriche sind jedoch meist Stilmittel, die dem Film ungemein gut stehen. Beispielsweise die Verhörszenen in der Forschungseinrichtungen wirken alle flach, das hätte wohl nicht sein müssen, und im Schimmer sind viele Einstellungen ein wenig milchig. Der Kontrast ist insgesamt eher schwach, aber wie gesagt: dem Film steht das alles hervorragend.
Der Sound liegt, wie kann es bei Paramount anders sein, in Dolby Digital vor. Der Track ist zwar alles andere als schlecht, aber eben auch nicht sehr gut. Die Räumlichkeit ist mehr als passabel, und in den Actionsequenzen kommt durchaus Dynamik auf. Der Bass ist etwas lasch, aber das lässt sich regeln.
Die Extras habe ich nicht angesehen, ich vergebe den Mittelwert. Die Scheibe hat ein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: mir ist „realistische“ Science Fiction wie „Sunshine“ sehr deutlich lieber als quietschbunte Weltraum-Märchen mit Raumschlachten und Laserschwert-Gewirbel á la „Star Wars“.
„Auslöschung“ hätte für mich persönlich das Zeug zum Ausnahme-Sci Fi-Film, wenn da nicht das überfrachtete, psychedelische und pseudosymbolische Finale wäre. 7 Reviewbalken gäbe ich, aufgrund der gelungenen Mixtur verschiedener Genres und der Atmosphäre runde ich auf. Tja, vielen anderen gefällt´s anscheinend besser..
Alex Garland ist ein Multitalent: der Brite hat die Romanvorlage zu „The Beach“ und als Drehbuchautor zum Beispiel die Drehbücher zu Danny Boyles „Sunshine“ und „28 Days Later“ geschrieben. 2015 hat der Engländer dann begonnen, Filme auch zu drehen und hat mit „Ex Machina“ einen vielbeachteten Achtungserfolg vorgelegt. Mit „Auslöschung“ hat Garland nun seinen zweiten Spielfilm inszeniert, der zunächst nur auf Netflix lief und nun auf Blu-ray veröffentlicht wurde.
„Auslöschung“ wurde nahezu ausnahmslos beinahe schon frenetisch bejubelt. Tatsächlich bietet der Film ein gewisses faszinierendes Durcheinander verschiedener Genres: zu Beginn wird ob der Ungewissheit, was als nächstes passieren könnte ordentlich Atmosphäre erzeugt, als der Ehemann überraschend völlig verändert als einziger zurückkommt. Danach wandelt sich der Film (kurz) zum Tech-Thriller, nur um kurz darauf mit dem Eindringen in den Schimmer eine Weile Mystery-Elemente gemischt mit ein paar Creature Feature-Attributen aufzuweisen. Ihr Übriges tun die grandiosen Regenwald-Kulissen mit den verlassenen menschlichen Niederlassungen, die durch die fremdartig mutierten Pflanzen in Beschlag genommen werden. Zum Ende hin wird „Auslöschung“ dann schon fast zu einem psychedelischen Psycho-Trip, der einem LSD-vernebelten Gehirn entsprungen zu sein scheint; etwas, was mir den Genuß zum Ende hin etwas verhagelt hat.
Mitdenken ist angesagt bei „Auslöschung“, und trotz des permanenten Mitdenkens bin ich mir nicht sicher, ob ich den Film völlig verstanden habe. Meine eigene Interpretation behalte ich zunächst für mich, um nicht zu spoilern. „Auslöschung“ ist für mich bis zum Beginn des Finales ein großartiger Film: atmosphärisch, spannend und anspruchsvoll. Mir persönlich war das Ende dann too much: das war vom Sinn, der Aussage und der Optik her deutlich over the top.
Gleichwohl das Ausgangsmaterial des Bildes für Netflix in 4K vorlag, muss man bei der BD ziemliche Abstriche machen. Diese Abstriche sind jedoch meist Stilmittel, die dem Film ungemein gut stehen. Beispielsweise die Verhörszenen in der Forschungseinrichtungen wirken alle flach, das hätte wohl nicht sein müssen, und im Schimmer sind viele Einstellungen ein wenig milchig. Der Kontrast ist insgesamt eher schwach, aber wie gesagt: dem Film steht das alles hervorragend.
Der Sound liegt, wie kann es bei Paramount anders sein, in Dolby Digital vor. Der Track ist zwar alles andere als schlecht, aber eben auch nicht sehr gut. Die Räumlichkeit ist mehr als passabel, und in den Actionsequenzen kommt durchaus Dynamik auf. Der Bass ist etwas lasch, aber das lässt sich regeln.
Die Extras habe ich nicht angesehen, ich vergebe den Mittelwert. Die Scheibe hat ein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: mir ist „realistische“ Science Fiction wie „Sunshine“ sehr deutlich lieber als quietschbunte Weltraum-Märchen mit Raumschlachten und Laserschwert-Gewirbel á la „Star Wars“.
„Auslöschung“ hätte für mich persönlich das Zeug zum Ausnahme-Sci Fi-Film, wenn da nicht das überfrachtete, psychedelische und pseudosymbolische Finale wäre. 7 Reviewbalken gäbe ich, aufgrund der gelungenen Mixtur verschiedener Genres und der Atmosphäre runde ich auf. Tja, vielen anderen gefällt´s anscheinend besser..
mit 4
mit 4
mit 4
mit 3
bewertet am 18.03.19 um 09:26
Die Deutsche Demokratische Republik, 1979: die Familien Strelzyk und Wetzel planen die Republikflucht. Der Westen ist nur etwa 20 Kilometer von ihrem thüringischen Heimatort entfernt und doch so weit weg wie der Mars, und die innerdeutsche Grenze ist nicht nur streng bewacht, sondern auch mit einem schier unüberwindlichen Zaun und: Selbstschussanlagen gesichert. Also basteln die beiden Familien seit zwei Jahren an einem Heißluftballon, und bei günstigem Nordwind soll „´rübergemacht werden“. Die Wetzels kriegen, als es soweit ist, doch noch kalte Füße, und die Strelzyks versuchen es allein, verpassen jedoch ihr Ziel ganz knapp. Nun heißt es, den Plan in kürzester Zeit noch mal vorzubereiten und durchzuführen, denn: es ist nur eine Frage der Zeit, bis den beiden Familien die Stasi auf die (versehentlich hinterlassene) Spur kommt..
Zu Beginn von „Ballon“ führen einige Texttafeln in die Thematik ein: über 400 Menschen mussten auf der Flucht in den Westen ihr Leben lassen, und stellvertretend wird all den mutigen Flüchtlingen mit diesem Film ein Denkmal gesetzt.
„Ballon“ war eine Herzensangelegenheit von Michael „Bully“ Herbig, der als Regisseur mit „Der Schuh des Manitu“ den nach wie vor erfolgreichsten deutschen Film inszenierte. Bully wollte einen Film weitab von Comedy inszenieren, und auch aus diesem Grund spielt der Komiker selbst nicht mit.
„Ballon“ hält sich nicht mit der Schilderung des SED-Regimes oder den allgemeinen politischen Umständen in der ehemaligen DDR auf und setzt das Wissen darüber voraus. Der Film geriet auch nicht zum Polit-Drama oder -Thriller, „Ballon“ ist tatsächlich ein reinrassiger Thriller, und zwar ein sehr guter.
„Bully“ Herbig schafft es, die bedrückende Atmosphäre in der ehemaligen DDR beinahe fühlbar zu machen, wenn beispielsweise die Familie Strelzyk, mitten in den Vorbereitungen für den nächsten Fluchtversuch steckend, mit dem benachbarten Stasi-Funktionär auf gute Nachbarschaft machen muss. Ebenso gut gelingt es den Filmemachern zu transportieren, dass selbst vermeintlich ganz „normale“ Bürger bei Gelegenheiten wie dem Stoffkauf in auffällig großer Menge zum IM wurden. Über die gesamte Laufzeit des Filmes hinweg hat der Zuschauer quasi die Angst vor der Demaskierung im Nacken, und jedes Klingeln an der Haustür kann zum Ende führen. Dabei baut Bully auch schon mal einen nicht völlig gelungenen Jump Scare ein, der etwas plump wirkt.
Alle Schauspieler in „Ballon“ agieren auf sehr hohem, absolut glaubwürdigen Niveau, besonders jedoch Thomas Kretzschmann verleiht dem Stasi-Bluthund trotz aller regelrecht verbissenen Verfolgung jeder noch so kleinen Spur und der gnadenlosen Bestrafung kleinster „Fehler“ eine gewisse Ambivalenz.
Das Gesamtpaket von „Ballon“ jedoch ist sehr gelungen: der Film ist sehr spannend, bis in kleinste Details wie Autos, Mopeds, Klamotten und Frisuren äußerst authentisch, lässt den Zuschauer hautnah mitfühlen und verfügt außerdem noch über einen außerordentlich passenden Score, der das Geschehen nachdrücklich unterstützt. Bully kann also auch Thriller, und zwar sehr gut. „Ballon“ braucht sich hinter internationalen Genre-Vertretern wie z. B. aus Hollywood nicht verstecken.
Das Bild ist toll, wenn auch nicht hochglanzprospektartig. Schärfe, Tiefenschärfe, Kontrast und Schwarzwert sind sehr gut; bei der Plastizität wäre noch Luft nach oben gewesen. Das Bild wirkt absolut natürlich, dadurch gewinnt der Film zusätzlich noch an Authentizität.
Der Core des Atmos-Tracks liegt in TrueHD vor und ist ebenfalls über jeden Zweifel erhaben. „Ballon“ ist kein Action-Thriller, deshalb bleiben Bass- und Dynamikattacken aus. Die Surroundkulisse ist stets vorhanden, und auch direktionale Effekte erklingen gut ortbar. Der Track von „Ballon“ ist wie das Bild natürlich und keine Effekteorgie.
Extras: wie üblich nicht angesehen. Die Scheibe hat ein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: „Ballon“ hatte ich schon im Kino gesehen und für sehr gut befunden. Auch auf Blu-ray finde ich den Film immer noch Spitze, zumal die Scheibe technisch sehr gut gelungen ist. Chapeau, Bully: weiter so. Du hast es drauf, kannst gerne auch mal was in anderen Genres vorlegen.
Zu Beginn von „Ballon“ führen einige Texttafeln in die Thematik ein: über 400 Menschen mussten auf der Flucht in den Westen ihr Leben lassen, und stellvertretend wird all den mutigen Flüchtlingen mit diesem Film ein Denkmal gesetzt.
„Ballon“ war eine Herzensangelegenheit von Michael „Bully“ Herbig, der als Regisseur mit „Der Schuh des Manitu“ den nach wie vor erfolgreichsten deutschen Film inszenierte. Bully wollte einen Film weitab von Comedy inszenieren, und auch aus diesem Grund spielt der Komiker selbst nicht mit.
„Ballon“ hält sich nicht mit der Schilderung des SED-Regimes oder den allgemeinen politischen Umständen in der ehemaligen DDR auf und setzt das Wissen darüber voraus. Der Film geriet auch nicht zum Polit-Drama oder -Thriller, „Ballon“ ist tatsächlich ein reinrassiger Thriller, und zwar ein sehr guter.
„Bully“ Herbig schafft es, die bedrückende Atmosphäre in der ehemaligen DDR beinahe fühlbar zu machen, wenn beispielsweise die Familie Strelzyk, mitten in den Vorbereitungen für den nächsten Fluchtversuch steckend, mit dem benachbarten Stasi-Funktionär auf gute Nachbarschaft machen muss. Ebenso gut gelingt es den Filmemachern zu transportieren, dass selbst vermeintlich ganz „normale“ Bürger bei Gelegenheiten wie dem Stoffkauf in auffällig großer Menge zum IM wurden. Über die gesamte Laufzeit des Filmes hinweg hat der Zuschauer quasi die Angst vor der Demaskierung im Nacken, und jedes Klingeln an der Haustür kann zum Ende führen. Dabei baut Bully auch schon mal einen nicht völlig gelungenen Jump Scare ein, der etwas plump wirkt.
Alle Schauspieler in „Ballon“ agieren auf sehr hohem, absolut glaubwürdigen Niveau, besonders jedoch Thomas Kretzschmann verleiht dem Stasi-Bluthund trotz aller regelrecht verbissenen Verfolgung jeder noch so kleinen Spur und der gnadenlosen Bestrafung kleinster „Fehler“ eine gewisse Ambivalenz.
Das Gesamtpaket von „Ballon“ jedoch ist sehr gelungen: der Film ist sehr spannend, bis in kleinste Details wie Autos, Mopeds, Klamotten und Frisuren äußerst authentisch, lässt den Zuschauer hautnah mitfühlen und verfügt außerdem noch über einen außerordentlich passenden Score, der das Geschehen nachdrücklich unterstützt. Bully kann also auch Thriller, und zwar sehr gut. „Ballon“ braucht sich hinter internationalen Genre-Vertretern wie z. B. aus Hollywood nicht verstecken.
Das Bild ist toll, wenn auch nicht hochglanzprospektartig. Schärfe, Tiefenschärfe, Kontrast und Schwarzwert sind sehr gut; bei der Plastizität wäre noch Luft nach oben gewesen. Das Bild wirkt absolut natürlich, dadurch gewinnt der Film zusätzlich noch an Authentizität.
Der Core des Atmos-Tracks liegt in TrueHD vor und ist ebenfalls über jeden Zweifel erhaben. „Ballon“ ist kein Action-Thriller, deshalb bleiben Bass- und Dynamikattacken aus. Die Surroundkulisse ist stets vorhanden, und auch direktionale Effekte erklingen gut ortbar. Der Track von „Ballon“ ist wie das Bild natürlich und keine Effekteorgie.
Extras: wie üblich nicht angesehen. Die Scheibe hat ein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: „Ballon“ hatte ich schon im Kino gesehen und für sehr gut befunden. Auch auf Blu-ray finde ich den Film immer noch Spitze, zumal die Scheibe technisch sehr gut gelungen ist. Chapeau, Bully: weiter so. Du hast es drauf, kannst gerne auch mal was in anderen Genres vorlegen.
mit 5
mit 5
mit 5
mit 3
bewertet am 17.03.19 um 21:50
In den Sechzigern des letzten Jahrhunderts ist nicht nur das atomare Wettrüsten im vollen Gange, sondern auch der Wettlauf ins All: die beiden Supermächte USA und UdSSR wetteifern darum, wer beim nächsten Schritt in der unbemannten und bemannten Raumfahrt die Nase vorn hat. Bislang hat die Sowjetunion Amerika immer überholt; sei es beim ersten Satelliten in einer Umlaufbahn, sei es mit Laika, dem ersten Lebewesen im All oder dem ersten Weltraumspaziergang.
Für die USA ist es also ein weltpolitisches Muss, den ersten Menschen auf den Mond zu schicken, um sich als Supermacht nicht vom ersten Platz verdrängen zu lassen. In diesem von ständigem atomaren Säbelrasseln geprägten Szenario verliert die Familie des Testpiloten Armstrong ihre über alles geliebte kleine Tochter durch eine tödliche Krankheit, und Neil flüchtet sich so sehr in seine Arbeit, dass er nicht nur den Bezug zu seiner Frau und den Söhnen verliert, sondern erst ins Genmini-und später ins Apollo-Projekt aufgenommen wird: Neil Armstrong und seine Crew sollen als erste Menschen auf den Mond..
Tja, so steht es in den Geschichtsbüchern: die UdSSR und die USA haben Millionen und Milliarden US-Dollar und Rubel sowie Menschenleben dafür eingesetzt, ein politisches Signal zu setzen und ihren Status als Supermacht zu zementieren. Mit der ersten Mondlandung konnte sich die USA quasi das erste Mal von der UdSSR absetzen, und als 2003 mit dem Unglück der „Columbia“ die bemannte Raumfahrt quasi eingestellt wurde darf man heute durchaus die Frage nach dem Sinn des Ganzen stellen.
Damien Chazelle („Whiplash“, „LaLa Land“) nahm sich dieser Ereignisse an und verbildlichte die Story um Neil Armstrong. Dabei setzt er etwa da an, als Armstrong bereits Testpilot war und mit spektakulären Testflügen etwa mit der X-15 auf sich aufmerksam machte. Einen großen Teil der Filmstory macht die Story um die Privatperson Neil Armstrong und seine Familie aus, und Armstrong wird als liebevoller Vater gezeigt, der nie über den Verlust der Tochter hinweg kam, sich deshalb selbst von der Familie isolierte und vielleicht gerade dadurch beruflich so erfolgreich wurde. Auf das Astronauten-Training wird kaum eingegangen, dafür umso mehr auf verschiedene Testflüge: das wird Wackelkamera-Hassern aber mal so richtig auf den Keks gehen, denn beispielsweise bei einem Zwischenfall während eines Testfluges kann man mal ein paar Minuten so gut wie gar nichts erkennen. Dagegen ist der Kamerastil z. B. in den Bournes beinahe schon einschläfernd. Beim Einstieg in den Film während des Testfluges mit der X-15 fliegt man als Zuschauer regelrecht mit, später wird das mitunter nervig.
Nach meinem persönlichen Geschmack hat Hauptdarsteller mittlerweile ein paar Sterotypen entwickelt, und Gosling legt den Astronauten beinahe so an, als sei er vom Set von „Blade Runner 2049“ kurz ´rübergewechselt und hätte Szenen für „Aufbruch zum Mond“ vorgedreht, ohne die Rolle des Replikanten ablegen zu können. Ryan Gosling lacht ein Mal im gesamten Film mit Kollegen beim Bier, und ein Mal weint er. Das ist kein Schauspiel, das ist regelrecht (und nicht im positiven Sinn gemeint) stoisch.
Das Bild ist über weite Strecken sehr gut, jedoch in einigen wenigen dunklen Szene körnig, unscharf und weichgezeichnet. Besonders auffällig ist das in einer Einstellung, in der Goslings Profil im Halbdunkel gezeigt wird. Perfekt ist das Bild auf meiner Technik selten, aber dennoch sehr gut; und dem Ganzen wurde ein angenehmer filmischer 60ies-Look verpasst. Die IMAX-Szenen sind hervorragend, was natürlich kein Kunststück ist: die Takes dürften gerendert sein. Gesagt werden muss aber auch, dass die Einstellungen auf dem Mond für mich nach kurzer Zeit relativ langweilig wurden: das sind nun mal nicht die wunderschön anzusehenden Iguazú-Wasserfälle oder eine bizarre Vulkanlandschaft auf Island, das sind nach kurzer Zeit dröge anzusehende Bilder der öden Staubwüste mit Kratern von Meteoriteneinschlägen auf dem Erdtrabanten, die nach wenigen Sekunden ihre Faszination verlieren.
Der Sound liegt in Atmos vor und wurde durch meinen Receiver in Dolby TrueHD reproduziert. Während der verschiedenen Testphasen ist der Track ungemein dynamisch und mit einem spürbaren, regelrecht wabernden Bass versehen. Während der „normalen“ Szenen nimmt sich der Track deutlich zurück, und im Vergleich mit dem neulich gesehenen „Einer nach dem Anderen“ fallen hörbar geringere Surroundgeräusche und direktionale Effekte auf. Trotzdem: ein sehr guter Track.
Extras: wie üblich nicht angesehen. Sie scheinen allerdings sehr umfangreich zu sein: auf dem Cover sind haufenweise Boni angeführt, und auf einer extra DVD sind noch mehr. Die Scheibe hat ein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung erhielt "Aubruch zum Mond" allen Vorschußlorbeeren zum Trotz nur ein Goldmännchen für die besten visuellen Effekte. Das sollte man nicht überbewerten; Oscars sind nicht zwangsläufig Indikatoren für wirklich gute Filme. Dennoch spricht das eine gewisse eigene Sprache. „Aufbruch zum Mond“ ist für mich ein guter Film, jedoch kein sehr guter. Warum? Einer der Schwerpunkte des Streifens ist neben der Vorbereitung auf die und die Durchführung der Raumflüge die Privatperson Neil Armstrong und dessen Familie. Ryan Gosling spielt zu reduziert, um tatsächliche Dramatik und Emotionen zu erzeugen; die die Ehefrau spielende Claire Foy zeigt da, wo der schauspielerische Hammer hängt. Kurz vor der Mondlandung wäre ich fast eingeschlafen, das passiert mir sehr selten. Vielleicht hatte ich mir zu viel erwartet, lieber nochmal „Apollo 13“. 7 Reviewbalken hätte ich vergeben und aufgerundet; als Kontrapunkt zum meiner Meinung nach sehr wohlwollenden Review runde ich dieses Mal ab.
Für die USA ist es also ein weltpolitisches Muss, den ersten Menschen auf den Mond zu schicken, um sich als Supermacht nicht vom ersten Platz verdrängen zu lassen. In diesem von ständigem atomaren Säbelrasseln geprägten Szenario verliert die Familie des Testpiloten Armstrong ihre über alles geliebte kleine Tochter durch eine tödliche Krankheit, und Neil flüchtet sich so sehr in seine Arbeit, dass er nicht nur den Bezug zu seiner Frau und den Söhnen verliert, sondern erst ins Genmini-und später ins Apollo-Projekt aufgenommen wird: Neil Armstrong und seine Crew sollen als erste Menschen auf den Mond..
Tja, so steht es in den Geschichtsbüchern: die UdSSR und die USA haben Millionen und Milliarden US-Dollar und Rubel sowie Menschenleben dafür eingesetzt, ein politisches Signal zu setzen und ihren Status als Supermacht zu zementieren. Mit der ersten Mondlandung konnte sich die USA quasi das erste Mal von der UdSSR absetzen, und als 2003 mit dem Unglück der „Columbia“ die bemannte Raumfahrt quasi eingestellt wurde darf man heute durchaus die Frage nach dem Sinn des Ganzen stellen.
Damien Chazelle („Whiplash“, „LaLa Land“) nahm sich dieser Ereignisse an und verbildlichte die Story um Neil Armstrong. Dabei setzt er etwa da an, als Armstrong bereits Testpilot war und mit spektakulären Testflügen etwa mit der X-15 auf sich aufmerksam machte. Einen großen Teil der Filmstory macht die Story um die Privatperson Neil Armstrong und seine Familie aus, und Armstrong wird als liebevoller Vater gezeigt, der nie über den Verlust der Tochter hinweg kam, sich deshalb selbst von der Familie isolierte und vielleicht gerade dadurch beruflich so erfolgreich wurde. Auf das Astronauten-Training wird kaum eingegangen, dafür umso mehr auf verschiedene Testflüge: das wird Wackelkamera-Hassern aber mal so richtig auf den Keks gehen, denn beispielsweise bei einem Zwischenfall während eines Testfluges kann man mal ein paar Minuten so gut wie gar nichts erkennen. Dagegen ist der Kamerastil z. B. in den Bournes beinahe schon einschläfernd. Beim Einstieg in den Film während des Testfluges mit der X-15 fliegt man als Zuschauer regelrecht mit, später wird das mitunter nervig.
Nach meinem persönlichen Geschmack hat Hauptdarsteller mittlerweile ein paar Sterotypen entwickelt, und Gosling legt den Astronauten beinahe so an, als sei er vom Set von „Blade Runner 2049“ kurz ´rübergewechselt und hätte Szenen für „Aufbruch zum Mond“ vorgedreht, ohne die Rolle des Replikanten ablegen zu können. Ryan Gosling lacht ein Mal im gesamten Film mit Kollegen beim Bier, und ein Mal weint er. Das ist kein Schauspiel, das ist regelrecht (und nicht im positiven Sinn gemeint) stoisch.
Das Bild ist über weite Strecken sehr gut, jedoch in einigen wenigen dunklen Szene körnig, unscharf und weichgezeichnet. Besonders auffällig ist das in einer Einstellung, in der Goslings Profil im Halbdunkel gezeigt wird. Perfekt ist das Bild auf meiner Technik selten, aber dennoch sehr gut; und dem Ganzen wurde ein angenehmer filmischer 60ies-Look verpasst. Die IMAX-Szenen sind hervorragend, was natürlich kein Kunststück ist: die Takes dürften gerendert sein. Gesagt werden muss aber auch, dass die Einstellungen auf dem Mond für mich nach kurzer Zeit relativ langweilig wurden: das sind nun mal nicht die wunderschön anzusehenden Iguazú-Wasserfälle oder eine bizarre Vulkanlandschaft auf Island, das sind nach kurzer Zeit dröge anzusehende Bilder der öden Staubwüste mit Kratern von Meteoriteneinschlägen auf dem Erdtrabanten, die nach wenigen Sekunden ihre Faszination verlieren.
Der Sound liegt in Atmos vor und wurde durch meinen Receiver in Dolby TrueHD reproduziert. Während der verschiedenen Testphasen ist der Track ungemein dynamisch und mit einem spürbaren, regelrecht wabernden Bass versehen. Während der „normalen“ Szenen nimmt sich der Track deutlich zurück, und im Vergleich mit dem neulich gesehenen „Einer nach dem Anderen“ fallen hörbar geringere Surroundgeräusche und direktionale Effekte auf. Trotzdem: ein sehr guter Track.
Extras: wie üblich nicht angesehen. Sie scheinen allerdings sehr umfangreich zu sein: auf dem Cover sind haufenweise Boni angeführt, und auf einer extra DVD sind noch mehr. Die Scheibe hat ein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung erhielt "Aubruch zum Mond" allen Vorschußlorbeeren zum Trotz nur ein Goldmännchen für die besten visuellen Effekte. Das sollte man nicht überbewerten; Oscars sind nicht zwangsläufig Indikatoren für wirklich gute Filme. Dennoch spricht das eine gewisse eigene Sprache. „Aufbruch zum Mond“ ist für mich ein guter Film, jedoch kein sehr guter. Warum? Einer der Schwerpunkte des Streifens ist neben der Vorbereitung auf die und die Durchführung der Raumflüge die Privatperson Neil Armstrong und dessen Familie. Ryan Gosling spielt zu reduziert, um tatsächliche Dramatik und Emotionen zu erzeugen; die die Ehefrau spielende Claire Foy zeigt da, wo der schauspielerische Hammer hängt. Kurz vor der Mondlandung wäre ich fast eingeschlafen, das passiert mir sehr selten. Vielleicht hatte ich mir zu viel erwartet, lieber nochmal „Apollo 13“. 7 Reviewbalken hätte ich vergeben und aufgerundet; als Kontrapunkt zum meiner Meinung nach sehr wohlwollenden Review runde ich dieses Mal ab.
mit 3
mit 4
mit 5
mit 5
bewertet am 16.03.19 um 13:10
Irgendwo in Norwegens Provinz; vermutlich nahe dem Polarkreis (dem Klima und der lang andauernden Nacht nach zu schließen): Lebensinhalt von Nils Dickland, schweigsamem Exil-Schweden, ist das Fahren seines Schneepfluges. Da er seinen Job wirklich hingebungsvoll ausübt und die Straßen Nordnorwegens dadurch immer befahrbar sind, wird er sogar „Bürger des Jahres“ in seinem Heimatort. Als sein Sohn angeblich an einer Überdosis Rauschgift gestorben aufgefunden wird zweifelt Nils sofort an diesem vermeintlichen Unfall, die Polizei indes ermittelt gar nicht erst. Also beginnt Nils, auf eigene Faust im Milieu zu ermitteln, und er ist gleichzeitig Ermittler, Richter und Henker. Der ortsansässige Drogenbaron „Graf“, von der Natur nicht gerade mit normalen menschlichen Verhaltensweisen ausgestattet sieht sich bald zum Gegenangriff genötigt und ruft dabei eher unabsichtlich auch noch den serbischen Paten der organisierten Kriminalität Außenstelle Nordnorwegen auf den Plan...
„Einer nach dem Anderen“ wurde ja in verschiedenen Quellen über den grünen Klee hinaus gelobt, und auf dem Radar hatte ich den Film schon geraume Zeit. Da nun ein Remake unter dem Namen „Hard Powder“ mit Liam Neeson angelaufen ist, wurde mir der Film wieder in Erinnerung gerufen und da die Scheibe im Preis ordentlich gesunken war, kam es jetzt zur Sichtung.
„Einer nach dem Anderen“ wird als schwarze Komödie bezeichnet, dem kann ich nur bedingt zustimmen. Der selten auftretende Humor ist derart tiefschwarz, dass er nur selten als solcher erkennbar ist. Als Beispiel möge die Szene dienen, in der Nils und seine Frau den toten Sohn identifizieren müssen. Manch einer mag im quälend langsamen, quietschenden Hochpumpen der Bahre im Beisein der Eltern lakonischen Witz entdecken, mir entzog sich dieser völlig, was prinzipiell bei mir während des gesamten Films so war. Für mich ist „Einer nach dem Anderen" beinahe schon ein reinrassiger Thriller, der auf typisch nordische Art lakonisch-verlangsamt inszeniert und in einigen Szenen verblüffend brutal ist. Da prügelt Nils schon mal ein Opfer zu Tode oder schlägt einem anderen mit einem Stock Zähne aus. Natürlich gibt es die eine oder andere Szene, die grotesk überzeichnet ist, lustig fand ich die dennoch nicht. Die meisten Grotesken gehen auf das Konto von Pål Sverre Valheim Hagen, der seinen Charakter „Graf“ hart an der Grenze zur Karikatur anlegt, aber die Grenze immer gerade noch so elegant umschifft.
Insgesamt betrachtet ist „Einer nach dem Anderen“ ein durchaus gelungener Vertreter der Thriller aus dem hohen Norden, nur hielt er nicht völlig, was ich mir von ihm versprochen hatte.
Technisch ist die Scheibe außerordentlich.
Das Bild ist einwandfrei, ich konnte auf meiner Technik keinerlei Bildfehler ausmachen.
Selbst die hellsten Schneeflächen im Sonnenschein werden so wiedergegeben, dass man noch jede Einzelheiten erkennen kann. Es erscheinen keinerlei Überstrahlungen, keine Koronas, nix. Super. Besonders beeindruckend gerieten Einstellung der Stadt in der Polarnacht, diese Bilder sind wie viele andere Einstellung sorgfältig komponiert und ästhetisch fotographiert. In dieser Hinsicht ist der Film ganz großes Kino.
Auch tonal ist die Scheibe irre. Der deutsche Track liegt in DTS HD MA vor und ist nicht nur beeindruckend räumlich, sondern der Track bildet Geräuschquellen auf eine Weise ab, die ihresgleichen sucht. Die direktionalen Effekte sind so gut abgemischt, dass man sich in manch einer Szene tatsächlich mitten im Raum sitzend fühlt, wenn rechts hinter einem eine Person spricht. Perfekt.
Extras: nicht angesehen. Die Scheibe hat kein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: Auf dem Cover von „Einer nach dem Anderen“ steht „Ein bitterböser Spaß“ und „Tarantino on ice“. Hm. Den Spaß musste ich mit der Lupe suchen und hab´ ihn trotzdem nicht gefunden. An Tarantino erinnern entfernt die teils verblüffend brutalen Gewalteruptionen, dafür fehlt (Gott sei Dank) das ausufernde Gequatsche besonders des Winter-Westerns „The Hateful 8“. Wahrscheinlich bin ich aufgrund der Aufschriften und der ähnlich klingenden Vorschusslorbeeren mit einer bestimmten Erwartungshaltung an den Film herangegangen, die nicht getroffen wurde. Das mach „Einer nach dem Anderen“ durchaus nicht zu einem schlechten Film. Geschmackssache. Technisch ist die Scheibe allerdings hervorragend.
„Einer nach dem Anderen“ wurde ja in verschiedenen Quellen über den grünen Klee hinaus gelobt, und auf dem Radar hatte ich den Film schon geraume Zeit. Da nun ein Remake unter dem Namen „Hard Powder“ mit Liam Neeson angelaufen ist, wurde mir der Film wieder in Erinnerung gerufen und da die Scheibe im Preis ordentlich gesunken war, kam es jetzt zur Sichtung.
„Einer nach dem Anderen“ wird als schwarze Komödie bezeichnet, dem kann ich nur bedingt zustimmen. Der selten auftretende Humor ist derart tiefschwarz, dass er nur selten als solcher erkennbar ist. Als Beispiel möge die Szene dienen, in der Nils und seine Frau den toten Sohn identifizieren müssen. Manch einer mag im quälend langsamen, quietschenden Hochpumpen der Bahre im Beisein der Eltern lakonischen Witz entdecken, mir entzog sich dieser völlig, was prinzipiell bei mir während des gesamten Films so war. Für mich ist „Einer nach dem Anderen" beinahe schon ein reinrassiger Thriller, der auf typisch nordische Art lakonisch-verlangsamt inszeniert und in einigen Szenen verblüffend brutal ist. Da prügelt Nils schon mal ein Opfer zu Tode oder schlägt einem anderen mit einem Stock Zähne aus. Natürlich gibt es die eine oder andere Szene, die grotesk überzeichnet ist, lustig fand ich die dennoch nicht. Die meisten Grotesken gehen auf das Konto von Pål Sverre Valheim Hagen, der seinen Charakter „Graf“ hart an der Grenze zur Karikatur anlegt, aber die Grenze immer gerade noch so elegant umschifft.
Insgesamt betrachtet ist „Einer nach dem Anderen“ ein durchaus gelungener Vertreter der Thriller aus dem hohen Norden, nur hielt er nicht völlig, was ich mir von ihm versprochen hatte.
Technisch ist die Scheibe außerordentlich.
Das Bild ist einwandfrei, ich konnte auf meiner Technik keinerlei Bildfehler ausmachen.
Selbst die hellsten Schneeflächen im Sonnenschein werden so wiedergegeben, dass man noch jede Einzelheiten erkennen kann. Es erscheinen keinerlei Überstrahlungen, keine Koronas, nix. Super. Besonders beeindruckend gerieten Einstellung der Stadt in der Polarnacht, diese Bilder sind wie viele andere Einstellung sorgfältig komponiert und ästhetisch fotographiert. In dieser Hinsicht ist der Film ganz großes Kino.
Auch tonal ist die Scheibe irre. Der deutsche Track liegt in DTS HD MA vor und ist nicht nur beeindruckend räumlich, sondern der Track bildet Geräuschquellen auf eine Weise ab, die ihresgleichen sucht. Die direktionalen Effekte sind so gut abgemischt, dass man sich in manch einer Szene tatsächlich mitten im Raum sitzend fühlt, wenn rechts hinter einem eine Person spricht. Perfekt.
Extras: nicht angesehen. Die Scheibe hat kein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: Auf dem Cover von „Einer nach dem Anderen“ steht „Ein bitterböser Spaß“ und „Tarantino on ice“. Hm. Den Spaß musste ich mit der Lupe suchen und hab´ ihn trotzdem nicht gefunden. An Tarantino erinnern entfernt die teils verblüffend brutalen Gewalteruptionen, dafür fehlt (Gott sei Dank) das ausufernde Gequatsche besonders des Winter-Westerns „The Hateful 8“. Wahrscheinlich bin ich aufgrund der Aufschriften und der ähnlich klingenden Vorschusslorbeeren mit einer bestimmten Erwartungshaltung an den Film herangegangen, die nicht getroffen wurde. Das mach „Einer nach dem Anderen“ durchaus nicht zu einem schlechten Film. Geschmackssache. Technisch ist die Scheibe allerdings hervorragend.
mit 4
mit 5
mit 5
mit 3
bewertet am 09.03.19 um 12:01
1970 ereignet sich ein musikhistorischer Paukenschlag, von dem ein paar Jahre lang nur ein paar wenige erfahren: Faroukh Bulsara, der Sohn pakistanischer Einwanderer lernt nach einem Gig die beiden verbleibenden Mitglieder Roger Taylor und Brian May der relativ erfolglosen Band „Smile“ kennen und schließt sich ihnen an. Nach einer Weile nennt die Combo sich „Queen“ und Faroukh sich Freddie Mercury, und der Rest ist Musikgeschichte..
"Bohemian Rhapsody“ ist im Februar mit insgesamt 4 Oscars ausgezeichnet worden, und einen davon erhielt zu Recht Rami Malek, der Freddie Mercury nicht nur darstellt, sondern für die Kamera auferstehen lässt und lebt. Der Film setzt mit besagtem Treffen ein und schildert den Weg der Band zu einer der erfolgreichsten Rockbands überhaupt. Jeder, der „Queen“ kennt (und mag) weiß, dass die Gruppierung zu Beginn reinen Rock spielte, um im Laufe ihrer Karriere mit allerlei Stilrichtungen zu experimentieren, wobei (für mein Empfinden nicht nur gelungene) für eine Rockband durchaus einige exotische Songs wie „Radio Gaga“ herauskamen. Einer ihrer größten Hits ist nicht nur eine kunterbunte Mischung aus Hardrock und operettenhaften Gesangseinlagen, sondern auch Namensgeber des Films. Die Entstehung dieses Klassikers wird besonders hervorgehoben, denn Musik wie dieser wurde seinerzeit nur wenig Erfolg prognostiziert. Denkste: nach der erstmaligen Sendung im Radio trat der Song seinen unglaublichen Siegeszug an und erreichte gleich zwei Mal ein Millionenpublikum: nach Mercurys Tod 1991 landete „Bohemian Rhapsody“ wieder ganz vorne in den Charts. Nachdem Freddie Mercury im Film zunächst seine eigene Homosexualität entdeckt (sein Umfeld ahnte es wohl länger als er) beginnt der Anfang vom Ende. Ohnehin labil flüchtete sich Mercury in unzählige anonyme Sex-Abenteuer und Drogeneskapaden, und es kommt was kommen muss: er erkrankt an der damals „Lustseuche“ genannten Immunschwäche AIDS und stirbt 1991 viel zu früh. "Bohemian Rhapsody“ begleitet Queen mit Fokus auf Freddie Mercury vom eingangs erwähnten Treffen bis zu ihrem legendären „Live Aid“-Auftritt, schildert die wilde Zeit während der Siebziger, allerdings erfreulicherweise ohne Drogenexzesse und Sex mit Groupies allzu plakativ auszuschlachten, und mit all den „kreativen Differenzen“ auch humorvoll, um etwa ab der Eröffnung von Mercurys furchtbarer Diagnose zunehmend dramatischer zu werden. Dennoch ist „Bohemian Rhapsody“ ziemlich leichtfüßig in Szene gesetzt und die meiste Zeit alles andere als traurig. Überraschend war für mich, dass Bryan Singer den Film inszeniert hat: wusste ich gar nicht, und hätte ich so von Mr. X-Men nicht erwartet.
Das Bild ist sehr gut, jedoch nicht außergewöhnlich. Die Tageslichtaufnahmen wirken allesamt sehr natürlich, sind scharf und wohl kontrastiert. Besonders beeindruckend gerieten die Aufnahmen während der Konzerte, wenn aus der Perspektive der Band das Publikum gezeigt wird. In Aufnahmen im Dunklen und im Halbdunkel ist der Kontrast nicht immer perfekt, und auch der Schwarzwert könnte satter sein. Dennoch: für die Höchstwertung reicht es locker.
Tja, der Sound.. Ich habe es mir und den Mitsehern erspart, während der Konzertszenen auf die englische Tonspur umzuschalten und den HD-Sound zu genießen. Der deutsche Track in DTS schlägt sich aber auch wacker, kann aber gegen den Track von „A Star is Born“ (ebenfalls kein HD-Sound) kaum anstinken. Bei den Konzerten in „Bohemian Rhapsody“ öffnet sich der Raum schön weit, und Bass und Dynamik werden merklich gesteigert; das war bei „A Star is Born“ aber noch hörbar besser. Dennoch: der Track ist besser als gedacht; die Schelte ist nur zum Teil gerechtfertigt.
Extras: wie üblich nicht angesehen. Das Steel ist geprägt, hinten mit einer kleineren Prägung versehen und innen mit einem Foto der Band, geschossen von schräg oben, versehen.
Mein persönliches Fazit: „Bohemian Rhapsody“ wird dem um ihn gemachten Hype gerecht, ein toller Film, der der Band von ihren Anfängen bis zum Zenith ihrer Karriere folgt und dabei semi-biographische Züge aufweist, die einen Teil der Lebensgeschichte um Freddie Mercury erzählen. „Bohemian Rhapsody“ ist (melo-) dramatisch, spannend, teils sehr lustig und sehr berührend. Volltreffer!
"Bohemian Rhapsody“ ist im Februar mit insgesamt 4 Oscars ausgezeichnet worden, und einen davon erhielt zu Recht Rami Malek, der Freddie Mercury nicht nur darstellt, sondern für die Kamera auferstehen lässt und lebt. Der Film setzt mit besagtem Treffen ein und schildert den Weg der Band zu einer der erfolgreichsten Rockbands überhaupt. Jeder, der „Queen“ kennt (und mag) weiß, dass die Gruppierung zu Beginn reinen Rock spielte, um im Laufe ihrer Karriere mit allerlei Stilrichtungen zu experimentieren, wobei (für mein Empfinden nicht nur gelungene) für eine Rockband durchaus einige exotische Songs wie „Radio Gaga“ herauskamen. Einer ihrer größten Hits ist nicht nur eine kunterbunte Mischung aus Hardrock und operettenhaften Gesangseinlagen, sondern auch Namensgeber des Films. Die Entstehung dieses Klassikers wird besonders hervorgehoben, denn Musik wie dieser wurde seinerzeit nur wenig Erfolg prognostiziert. Denkste: nach der erstmaligen Sendung im Radio trat der Song seinen unglaublichen Siegeszug an und erreichte gleich zwei Mal ein Millionenpublikum: nach Mercurys Tod 1991 landete „Bohemian Rhapsody“ wieder ganz vorne in den Charts. Nachdem Freddie Mercury im Film zunächst seine eigene Homosexualität entdeckt (sein Umfeld ahnte es wohl länger als er) beginnt der Anfang vom Ende. Ohnehin labil flüchtete sich Mercury in unzählige anonyme Sex-Abenteuer und Drogeneskapaden, und es kommt was kommen muss: er erkrankt an der damals „Lustseuche“ genannten Immunschwäche AIDS und stirbt 1991 viel zu früh. "Bohemian Rhapsody“ begleitet Queen mit Fokus auf Freddie Mercury vom eingangs erwähnten Treffen bis zu ihrem legendären „Live Aid“-Auftritt, schildert die wilde Zeit während der Siebziger, allerdings erfreulicherweise ohne Drogenexzesse und Sex mit Groupies allzu plakativ auszuschlachten, und mit all den „kreativen Differenzen“ auch humorvoll, um etwa ab der Eröffnung von Mercurys furchtbarer Diagnose zunehmend dramatischer zu werden. Dennoch ist „Bohemian Rhapsody“ ziemlich leichtfüßig in Szene gesetzt und die meiste Zeit alles andere als traurig. Überraschend war für mich, dass Bryan Singer den Film inszeniert hat: wusste ich gar nicht, und hätte ich so von Mr. X-Men nicht erwartet.
Das Bild ist sehr gut, jedoch nicht außergewöhnlich. Die Tageslichtaufnahmen wirken allesamt sehr natürlich, sind scharf und wohl kontrastiert. Besonders beeindruckend gerieten die Aufnahmen während der Konzerte, wenn aus der Perspektive der Band das Publikum gezeigt wird. In Aufnahmen im Dunklen und im Halbdunkel ist der Kontrast nicht immer perfekt, und auch der Schwarzwert könnte satter sein. Dennoch: für die Höchstwertung reicht es locker.
Tja, der Sound.. Ich habe es mir und den Mitsehern erspart, während der Konzertszenen auf die englische Tonspur umzuschalten und den HD-Sound zu genießen. Der deutsche Track in DTS schlägt sich aber auch wacker, kann aber gegen den Track von „A Star is Born“ (ebenfalls kein HD-Sound) kaum anstinken. Bei den Konzerten in „Bohemian Rhapsody“ öffnet sich der Raum schön weit, und Bass und Dynamik werden merklich gesteigert; das war bei „A Star is Born“ aber noch hörbar besser. Dennoch: der Track ist besser als gedacht; die Schelte ist nur zum Teil gerechtfertigt.
Extras: wie üblich nicht angesehen. Das Steel ist geprägt, hinten mit einer kleineren Prägung versehen und innen mit einem Foto der Band, geschossen von schräg oben, versehen.
Mein persönliches Fazit: „Bohemian Rhapsody“ wird dem um ihn gemachten Hype gerecht, ein toller Film, der der Band von ihren Anfängen bis zum Zenith ihrer Karriere folgt und dabei semi-biographische Züge aufweist, die einen Teil der Lebensgeschichte um Freddie Mercury erzählen. „Bohemian Rhapsody“ ist (melo-) dramatisch, spannend, teils sehr lustig und sehr berührend. Volltreffer!
mit 5
mit 5
mit 4
mit 3
bewertet am 07.03.19 um 18:41
Roy ist Hitman und arbeitet in New Orleans für den Mobster Stan. Als er einem säumigen Schuldner nur Angst machen und auf keinen Fall Waffen einsetzen soll, verstößt er bewusst gegen diese Auflage von Stan. Dieser Verstoß erweist sich als weise Voraussicht, denn: Roy und sein Partner werden von Stan wegen eines schief gegangenen Jobs hereingelegt und beim Überfall selbst überfallen; Roy kommt gerade so mit dem Leben davon und kann eine gerade nicht mehr minderjährige Prostituierte namens Rocky retten. Die beiden Verbündeten wider Willen befinden sich fortan auf der Flucht vor Stans Schergen und der Polizei, und Rocky will unbedingt noch kurz nach Galveston, um Schulden einzutreiben..
„Galveston “ ist ein Film von Mélanie Laurent, der französischen Kinobesitzerin und Widerstandskämpferin in Tarantinos „Inglorious Basterds“. Im Grunde ist „Galveston“ ein Roadmovie mit viel Drama-, ein paar Thriller- und wenig Actionelementen. Irgendwo steht geschrieben, dass „Galveston“ „Hell or High Water“ ähnlich sei, das kann ich so nicht bestätigen: die einzige und wesentliche Gemeinsamkeit der beiden Filme ist, dass Ben Foster eine Hauptrolle spielt.
„Galveston“ ist mit guten 90 Minuten nicht allzu lang, und so wirkt der Film trotz seiner weitgehend verlangsamten Erzählweise nicht gelängt. Der Film ist durchaus spannend inszeniert, auf gewisse Weise melodramatisch und toll fotographiert. Ben Foster und Elle Fanning spielen herausragend, und besonders Foster wandelt sich eindrucksvoll vom wortkargen, vermeintlich totkranken Eigenbrötler zum Mann, der Sympathien für das junge Mädchen entwickelt. „Galveston“ mündet schließlich in ein recht brutales Finale und endet ohne Hoffnungsschimmer.
Auf meiner Technik präsentierte sich das Bild eigentlich ziemlich gut. Der Schwarzwert ist satt, der Kontrast ist ausgewogen. Die Schärfe ist hoch; insgesamt ist das Bild über weite Strecken einwandfrei, wenn auch ab und an farblich verfremdet.
Beim Sound könnte der Bass tatsächlich stärker sein, das lässt sich aber regeln. Die restlichen Parameter wie Dynamik und Surroundkulisse sind recht ordentlich, aber nicht herausragend.
Extras: nicht angesehen, ich vergebe die vorliegende Durchschnittswertung. Meine Version hat ein Wendecover und kommt in einer Klarsicht-Amaray.
Mein persönliches Fazit: nun, bei genauerem Nachdenken nehme ich meine Aussage in der Analyse zurück: Von der Machart her ähneln sich „Hell or High Water“ und „Galveston“ doch ein wenig, jedoch erreicht dieser Film hier nie die Güte der genannten Referenz. Dennoch: der Film ist für einen etwas anspruchsvolleren Filmabend gut geeignet, ob mehrfach muss jeder für sich selbst entscheiden.
„Galveston “ ist ein Film von Mélanie Laurent, der französischen Kinobesitzerin und Widerstandskämpferin in Tarantinos „Inglorious Basterds“. Im Grunde ist „Galveston“ ein Roadmovie mit viel Drama-, ein paar Thriller- und wenig Actionelementen. Irgendwo steht geschrieben, dass „Galveston“ „Hell or High Water“ ähnlich sei, das kann ich so nicht bestätigen: die einzige und wesentliche Gemeinsamkeit der beiden Filme ist, dass Ben Foster eine Hauptrolle spielt.
„Galveston“ ist mit guten 90 Minuten nicht allzu lang, und so wirkt der Film trotz seiner weitgehend verlangsamten Erzählweise nicht gelängt. Der Film ist durchaus spannend inszeniert, auf gewisse Weise melodramatisch und toll fotographiert. Ben Foster und Elle Fanning spielen herausragend, und besonders Foster wandelt sich eindrucksvoll vom wortkargen, vermeintlich totkranken Eigenbrötler zum Mann, der Sympathien für das junge Mädchen entwickelt. „Galveston“ mündet schließlich in ein recht brutales Finale und endet ohne Hoffnungsschimmer.
Auf meiner Technik präsentierte sich das Bild eigentlich ziemlich gut. Der Schwarzwert ist satt, der Kontrast ist ausgewogen. Die Schärfe ist hoch; insgesamt ist das Bild über weite Strecken einwandfrei, wenn auch ab und an farblich verfremdet.
Beim Sound könnte der Bass tatsächlich stärker sein, das lässt sich aber regeln. Die restlichen Parameter wie Dynamik und Surroundkulisse sind recht ordentlich, aber nicht herausragend.
Extras: nicht angesehen, ich vergebe die vorliegende Durchschnittswertung. Meine Version hat ein Wendecover und kommt in einer Klarsicht-Amaray.
Mein persönliches Fazit: nun, bei genauerem Nachdenken nehme ich meine Aussage in der Analyse zurück: Von der Machart her ähneln sich „Hell or High Water“ und „Galveston“ doch ein wenig, jedoch erreicht dieser Film hier nie die Güte der genannten Referenz. Dennoch: der Film ist für einen etwas anspruchsvolleren Filmabend gut geeignet, ob mehrfach muss jeder für sich selbst entscheiden.
mit 4
mit 4
mit 4
mit 3
bewertet am 05.03.19 um 11:00
Jackson Maine ist nicht nur Superstar, begnadeter Gitarrist und Sänger; er ist auch ein depressives, alkoholkrankes und drogenabhängiges Wrack. Die meiste Zeit des Lebens und auf der Bühne immer ist Jackson stockbesoffen und total zugedröhnt. Als er nach einem Gig dringend etwas (alkoholisches, natürlich..) zu trinken braucht, stolpert er eher zufällig in eine Drag Bar und erlebt den Auftritt von Ally mit: der äußerst talentierten Sängerin und Songwriterin blieb bislang eine größere Karriere aufgrund ihrer „zu großen Nase“ verwehrt, und so fristet sie ihr Dasein bei einem Caterer und singt in Bars. Beide verlieben sich insgeheim auf den ersten Blick, und Jackson fördert Ally zum Star. Als Allys Karrierekurve steil ansteigt und sie an einen Produzenten gerät, der sie zusehends in eine andere musikalische Richtung drängt verliert Jackson aus Enttäuschung über Allys Abkehr von ihren Wurzeln immer mehr die Kontrolle über sich und sein Leben..
„A Star is Born“ wurde nunmehr nach 1937 und 1972 (glaub´ ich) bereits das dritte Mal verfilmt, die Lebensälteren unter uns erinnern sich vielleicht noch an die Verfilmung mit Barbara Streisand und Kris Kristofferson. Multitalent Bradley Cooper (mehrfach als Bester Hauptdarsteller Oscar-nominiert, aber noch nie ausgezeichnet) nahm sich des Stoffes erneut an und setzte ihn als seine erste Regiearbeit für die Leinwand um. Seine Version von „A Star is Born“ wurde für insgesamt 9 Goldmännchen nominiert, gewonnen hat der Film dann doch nur lediglich einen: heute morgen wurde Lady Gaga für den Besten Song ausgezeichnet, Bradley Cooper ging als Regisseur und Hauptdarsteller leer aus.
Im Prinzip ist „A Star is Born“ eine recht banale Liebesgeschichte, wie sie schon tausendfach verfilmt wurde. Auch „A Star is Born“ unterscheidet sich von den üblichen Verdächtigen in den meisten Hinsichten kaum: ein Mann und eine Frau lernen sich kennen, verlieben sich ineinander; eine ganze Weile hängt der Himmel (in diesem Falle statt Geigen) voller E-Gitarren und dann geht alles den Bach ´runter. Auch Probleme durch Alkohol- und Drogenexzesse sind in Liebesdramen keine Seltenheit. Ein Alleinstellungsmerkmal von „A Star is Born“ ist, dass Bradley Cooper für den Film Gesangsunterricht nehmen musste und Lady Gaga Schauspielunterricht, und dass alle Auftritte tatsächlich live aufgenommen wurden.
Erstaunlich, welche Performance beide sowohl darstellerisch wie auch gesanglich (Lady Gaga sowieso, auch wenn ich ihre Musik eigentlich nicht besonders mag) bringen.
„A Star is Born“ ist für mich sehr deutlich besser als erwartet, und die eigentlich erwarteten, ausufernden Kitschigkeiten blieben dank Bradley Coopers zurückhaltender Inszenierung aus. Cooper spielt dennoch recht geschickt auf der Klaviatur der Emotionen, und am Ergreifendsten wirkt das ganze; natürlich; bei den Auftritten.
Beim Bild konnte ich keinerlei Bildfehler feststellen. Schärfe, Tiefenschärfe, Kontrast, Schwarzwert, Plastizität: alles top.
Der deutsche Track wurde durch meinen Receiver als Dolby Digital EX reproduziert. Wie immer wurde im Vorfeld ordentlich auf den Publisher eingeprügelt, weil der deutschen Synchro der Scheibe kein HD-Ton oder gar Atmos spendiert wurde. So schlecht fand ich den Track eigentlich gar nicht mal. Während der „normalen“ Szenen hält sich der Track zwar zurück, bei den Auftritten jedoch öffnet sich quasi der gesamte vordere Raum und wird breiter und höher, während trotzdem eine Surroundkulisse nach hinten besteht. Die Dynamik ist dann gut bis sehr gut, und auch der Bass und die Räumlichkeit stellt zufrieden. Bis ich die englische Original-Tonspur gehört habe, vergebe ich erstmal 4 Balken.
Extras habe ich (noch) nicht angesehen, werde ich aber noch: da sind noch ein paar Auftritte drin, die nicht in den Film aufgenommen wurden. Die Scheibe hat ein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: eigentlich sind Liebesdramen so gar nicht mein Ding. Das Buch zu „A Star is Born“ hatte ich seinerzeit als Teenager gelesen und war wohl mehr davon fasziniert und abgestoßen, wie man sich mit Alkohol und Drogen derart zugrunde richten kann als von der Love Story angezogen. Diese Neuverfilmung hier finde ich rundherum gelungen, denn es ist tatsächlich ein Drama, das unglaubwürdige Dramatik und übertriebene Kitschromantik recht elegant umschifft.
Hinzu kommt mitreißende und berührende Musik, die live von den beiden Hauptdarstellern vorgetragen wird. Mit Lady Gagas Musik und vor allem ihren seltsamen Kostümen kann ich normalerweise nix anfangen, aber nach ihrem Auftritt in „A Star is Born“ hoffe ich, dass man sie öfter auf der Leinwand sieht.
„A Star is Born“ wurde nunmehr nach 1937 und 1972 (glaub´ ich) bereits das dritte Mal verfilmt, die Lebensälteren unter uns erinnern sich vielleicht noch an die Verfilmung mit Barbara Streisand und Kris Kristofferson. Multitalent Bradley Cooper (mehrfach als Bester Hauptdarsteller Oscar-nominiert, aber noch nie ausgezeichnet) nahm sich des Stoffes erneut an und setzte ihn als seine erste Regiearbeit für die Leinwand um. Seine Version von „A Star is Born“ wurde für insgesamt 9 Goldmännchen nominiert, gewonnen hat der Film dann doch nur lediglich einen: heute morgen wurde Lady Gaga für den Besten Song ausgezeichnet, Bradley Cooper ging als Regisseur und Hauptdarsteller leer aus.
Im Prinzip ist „A Star is Born“ eine recht banale Liebesgeschichte, wie sie schon tausendfach verfilmt wurde. Auch „A Star is Born“ unterscheidet sich von den üblichen Verdächtigen in den meisten Hinsichten kaum: ein Mann und eine Frau lernen sich kennen, verlieben sich ineinander; eine ganze Weile hängt der Himmel (in diesem Falle statt Geigen) voller E-Gitarren und dann geht alles den Bach ´runter. Auch Probleme durch Alkohol- und Drogenexzesse sind in Liebesdramen keine Seltenheit. Ein Alleinstellungsmerkmal von „A Star is Born“ ist, dass Bradley Cooper für den Film Gesangsunterricht nehmen musste und Lady Gaga Schauspielunterricht, und dass alle Auftritte tatsächlich live aufgenommen wurden.
Erstaunlich, welche Performance beide sowohl darstellerisch wie auch gesanglich (Lady Gaga sowieso, auch wenn ich ihre Musik eigentlich nicht besonders mag) bringen.
„A Star is Born“ ist für mich sehr deutlich besser als erwartet, und die eigentlich erwarteten, ausufernden Kitschigkeiten blieben dank Bradley Coopers zurückhaltender Inszenierung aus. Cooper spielt dennoch recht geschickt auf der Klaviatur der Emotionen, und am Ergreifendsten wirkt das ganze; natürlich; bei den Auftritten.
Beim Bild konnte ich keinerlei Bildfehler feststellen. Schärfe, Tiefenschärfe, Kontrast, Schwarzwert, Plastizität: alles top.
Der deutsche Track wurde durch meinen Receiver als Dolby Digital EX reproduziert. Wie immer wurde im Vorfeld ordentlich auf den Publisher eingeprügelt, weil der deutschen Synchro der Scheibe kein HD-Ton oder gar Atmos spendiert wurde. So schlecht fand ich den Track eigentlich gar nicht mal. Während der „normalen“ Szenen hält sich der Track zwar zurück, bei den Auftritten jedoch öffnet sich quasi der gesamte vordere Raum und wird breiter und höher, während trotzdem eine Surroundkulisse nach hinten besteht. Die Dynamik ist dann gut bis sehr gut, und auch der Bass und die Räumlichkeit stellt zufrieden. Bis ich die englische Original-Tonspur gehört habe, vergebe ich erstmal 4 Balken.
Extras habe ich (noch) nicht angesehen, werde ich aber noch: da sind noch ein paar Auftritte drin, die nicht in den Film aufgenommen wurden. Die Scheibe hat ein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: eigentlich sind Liebesdramen so gar nicht mein Ding. Das Buch zu „A Star is Born“ hatte ich seinerzeit als Teenager gelesen und war wohl mehr davon fasziniert und abgestoßen, wie man sich mit Alkohol und Drogen derart zugrunde richten kann als von der Love Story angezogen. Diese Neuverfilmung hier finde ich rundherum gelungen, denn es ist tatsächlich ein Drama, das unglaubwürdige Dramatik und übertriebene Kitschromantik recht elegant umschifft.
Hinzu kommt mitreißende und berührende Musik, die live von den beiden Hauptdarstellern vorgetragen wird. Mit Lady Gagas Musik und vor allem ihren seltsamen Kostümen kann ich normalerweise nix anfangen, aber nach ihrem Auftritt in „A Star is Born“ hoffe ich, dass man sie öfter auf der Leinwand sieht.
mit 5
mit 5
mit 4
mit 3
bewertet am 25.02.19 um 12:53
In einer schon noch ein paar Jahre entfernten Zukunft stürzt ein Raumschiff der sogenannten „Life Foundation“ im malaysischen Regenwald ab. An Bord (natürlich streng geheim): vier außerirdische Lebensformen, die erforscht werden sollen, denn der Chef von Life Foundation sucht beständig nach Wegen, Krankheiten zu besiegen, auch wenn bei den Testphasen haufenweise Menschen über die Wupper gehen (warum also nicht auch im All suchen). Dumm nur, dass bei dem Crash eine der Lebensformen ausbüxen kann, denn: das Alien „schlüpft“ regelrecht in seine Wirte und nutzt ihre Körper und Persönlichkeit zur Tarnung und zum Reisen.
Kurz darauf soll der sturköpfige Enthüllungsjournalist Eddie Brock den aalglatten und skrupellosen Chef von „Life Foundation“ namens Drake eher wohlwollend interviewen und stellt entgegen des Auftrages und wider besseren Wissens (derartige Fragestellungen haben ihn schon den Job in New York gekostet) zwar die richtigen Fragen, nur leider eben an falscher Stelle. Ergebnis und Siegerehrung: Job weg, Freundin auch (weil sie ihren Job wegen Eddie auch los ist) und die Wohnung bald. Ein Insider jedoch bestätigt Eddies Vermutungen mit den Todesfällen bei Experimenten und schleust ihn bei der „Life Foundation“ ein. Bald hat Eddie mehr (und unter anderem physische) Verbindungen zu den Machenschaften der Organisation, als ihm lieb ist, was ihn unter anderem zu nur sehr bedingt gesellschaftsfähigem Verhalten führt..
Venom ist ebenfalls, wie so ziemlich alle Marvel-Charaktere, bereits eine ziemlich alte Comic-Figur. Das erste Mal trat der Symbiont 1985 an die Öffentlichkeit und baute sich nach und nach eine eingeschworene und stets wachsende Fanbase auf. Filmisch trat das Vieh erstmals 2007 im dritten Teil von Raimis „Spider-Men“ ans Licht der Öffentlichkeit. Jetzt, wo Sony eine Reihe mit Marvel-Figuren startet, schlug die Stunde des Aliens (das ziemlich gut Englisch spricht und noch dazu sehr gut mit Sarkasmus und Wortwitz umgehen kann), und gleich bekam der Außerirdische seinen Auftritt im Erstling der Reihe.
Die Vorlagen, nämlich die Graphic Novels, boten jede Menge Blut & Gedärme sowie besagten Zynismus, und so sollte „Venom“ ein düsterer Vertreter im Superhelden-Genre werden. Leider gelang das nur zum Teil, denn Ruben Fleischer schafft es nur bedingt, eine düstere Atmosphäre zu schaffen, zu nähren und zu erhalten. Ein Übriges tut die Tatsache, dass Venom zwar Köpfe abbeißen darf, aber eben nur von Opfern, die a) verdorbene Charaktere sind und b) ohnehin bald an Anämie gestorben wären. Im Film sieht man nämlich aus der Erinnerung heraus nur kurz ein wenig Blut, als Eddie dem Häscher von Drake eine Kopfnuss verpasst. Während der Film etwa in der ersten Stunde noch einigermaßen atmosphärisch ist und die Auswirkungen der Symbiose auf Eddies Körper und Geist mit einigen denkwürdigen Szenen von Eddies Verhalten zeigt, gerät die letzte halbe Stunde zum marveltypischen CGI-Gewitter, das zu diesem üblichen Special Effects-Spektakel noch den unglücklichen Umstand aufweist, dass sich die Gegner sehr ähnlich sehen. Und so flutschen zwei schwarze Farbklekse 20 Minuten lang kämpfend über die Mattscheibe, und am Schluss erkennt man wer gewonnen hat.
Der Film hat Gott sei Dank mit Tom Hardy und Michelle Williams zwei Charakterdarsteller vorzuweisen, die ihren Rollen Leben einhauchen, denn der "Schurke" wäre statt im Film hinter dem Schalter der örtlichen Hypo-Vereinsbank besser aufgehoben: der Schauspieler hat in dieser Rolle keine Ausstrahlung, kein Charisma und null Bedrohlichkeit. Und so bleibt unterm Strich nur ein weiterer Marvel: die Fans werden ihn lieben; alle anderen jedoch werden wohl eher skeptisch eine Augenbraue hochziehen.
Das Bild ist; wie man es von einem hochbudgetierten Blockbuster erwarten kann; nahezu tadellos. Die an anderer Stelle erwähnten Randunschärfen fielen mir nicht auf. Insgesamt blieben Bildfehler, wenn sie denn überhaupt auftreten, im unauffälligen Rahmen. Der Film spielt meist bei Nacht, und dafür ist die Detailreichtum toll. Das ist ein Indiz dafür, dass Schwarzwert und Kontrast sehr gut sind.
Die 3D-Fassung liefert ein Bild, das sehr hohe, aber nicht höchste Weihen verdient: auf meiner mittlerweile doch recht betagten Technik entstand ein wenig Ghosting, selten Doppelkonturen, und alle Bildhintergründe sind stets vergleichsweise scharf. Das Bild bietet ein paar Pop Outs und eine hervorragende Tiefenstaffelung. Dunkler wird’s halt, wie immer bei Shutter-Technik, was bei den vielen dämmrigen und dunklen Szenen nicht gerade hilfreich ist.
Auch beim Sound fielen mir keine wesentlichen Ausrutscher auf. Klar, der Bass besonders bei Venoms Stimme könnte tiefer reichen und besser grummeln, aber das lässt sich nachjustieren. Ansonsten hat der Track alles, was ein Soundtrack einer Comic-Verfilmung braucht: Surroundkulisse, Dynamik und direktionale Effekte, alles da.
Extras: wie üblich nicht angesehen, wie üblich vergebe ich den Mittelwert. 2D- und 3D-Version liegen auf gesonderten Scheiben vor. Die Scheibe hat kein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: ein Marvel halt. „Venom“ hat durchaus gute Ansätze, verfolgt sie aber nicht konsequent genug. Für mich am störendsten ist wieder mal das Effekte-Geballer im Finale; etwas was mich schon seit längerem bei den Marvels stört. „Venom“ sticht leider auch kaum aus der Masse der Marvels hervor, schade drum. Die Vorlage gäbe soviel mehr her. 7 Review-Balken vergäbe ich wegen der guten ersten Stunde; aufgrund der meines Erachtens sehr wohlwollenden 8 Review-Punkte runde ich als Kontrast ab.
Kurz darauf soll der sturköpfige Enthüllungsjournalist Eddie Brock den aalglatten und skrupellosen Chef von „Life Foundation“ namens Drake eher wohlwollend interviewen und stellt entgegen des Auftrages und wider besseren Wissens (derartige Fragestellungen haben ihn schon den Job in New York gekostet) zwar die richtigen Fragen, nur leider eben an falscher Stelle. Ergebnis und Siegerehrung: Job weg, Freundin auch (weil sie ihren Job wegen Eddie auch los ist) und die Wohnung bald. Ein Insider jedoch bestätigt Eddies Vermutungen mit den Todesfällen bei Experimenten und schleust ihn bei der „Life Foundation“ ein. Bald hat Eddie mehr (und unter anderem physische) Verbindungen zu den Machenschaften der Organisation, als ihm lieb ist, was ihn unter anderem zu nur sehr bedingt gesellschaftsfähigem Verhalten führt..
Venom ist ebenfalls, wie so ziemlich alle Marvel-Charaktere, bereits eine ziemlich alte Comic-Figur. Das erste Mal trat der Symbiont 1985 an die Öffentlichkeit und baute sich nach und nach eine eingeschworene und stets wachsende Fanbase auf. Filmisch trat das Vieh erstmals 2007 im dritten Teil von Raimis „Spider-Men“ ans Licht der Öffentlichkeit. Jetzt, wo Sony eine Reihe mit Marvel-Figuren startet, schlug die Stunde des Aliens (das ziemlich gut Englisch spricht und noch dazu sehr gut mit Sarkasmus und Wortwitz umgehen kann), und gleich bekam der Außerirdische seinen Auftritt im Erstling der Reihe.
Die Vorlagen, nämlich die Graphic Novels, boten jede Menge Blut & Gedärme sowie besagten Zynismus, und so sollte „Venom“ ein düsterer Vertreter im Superhelden-Genre werden. Leider gelang das nur zum Teil, denn Ruben Fleischer schafft es nur bedingt, eine düstere Atmosphäre zu schaffen, zu nähren und zu erhalten. Ein Übriges tut die Tatsache, dass Venom zwar Köpfe abbeißen darf, aber eben nur von Opfern, die a) verdorbene Charaktere sind und b) ohnehin bald an Anämie gestorben wären. Im Film sieht man nämlich aus der Erinnerung heraus nur kurz ein wenig Blut, als Eddie dem Häscher von Drake eine Kopfnuss verpasst. Während der Film etwa in der ersten Stunde noch einigermaßen atmosphärisch ist und die Auswirkungen der Symbiose auf Eddies Körper und Geist mit einigen denkwürdigen Szenen von Eddies Verhalten zeigt, gerät die letzte halbe Stunde zum marveltypischen CGI-Gewitter, das zu diesem üblichen Special Effects-Spektakel noch den unglücklichen Umstand aufweist, dass sich die Gegner sehr ähnlich sehen. Und so flutschen zwei schwarze Farbklekse 20 Minuten lang kämpfend über die Mattscheibe, und am Schluss erkennt man wer gewonnen hat.
Der Film hat Gott sei Dank mit Tom Hardy und Michelle Williams zwei Charakterdarsteller vorzuweisen, die ihren Rollen Leben einhauchen, denn der "Schurke" wäre statt im Film hinter dem Schalter der örtlichen Hypo-Vereinsbank besser aufgehoben: der Schauspieler hat in dieser Rolle keine Ausstrahlung, kein Charisma und null Bedrohlichkeit. Und so bleibt unterm Strich nur ein weiterer Marvel: die Fans werden ihn lieben; alle anderen jedoch werden wohl eher skeptisch eine Augenbraue hochziehen.
Das Bild ist; wie man es von einem hochbudgetierten Blockbuster erwarten kann; nahezu tadellos. Die an anderer Stelle erwähnten Randunschärfen fielen mir nicht auf. Insgesamt blieben Bildfehler, wenn sie denn überhaupt auftreten, im unauffälligen Rahmen. Der Film spielt meist bei Nacht, und dafür ist die Detailreichtum toll. Das ist ein Indiz dafür, dass Schwarzwert und Kontrast sehr gut sind.
Die 3D-Fassung liefert ein Bild, das sehr hohe, aber nicht höchste Weihen verdient: auf meiner mittlerweile doch recht betagten Technik entstand ein wenig Ghosting, selten Doppelkonturen, und alle Bildhintergründe sind stets vergleichsweise scharf. Das Bild bietet ein paar Pop Outs und eine hervorragende Tiefenstaffelung. Dunkler wird’s halt, wie immer bei Shutter-Technik, was bei den vielen dämmrigen und dunklen Szenen nicht gerade hilfreich ist.
Auch beim Sound fielen mir keine wesentlichen Ausrutscher auf. Klar, der Bass besonders bei Venoms Stimme könnte tiefer reichen und besser grummeln, aber das lässt sich nachjustieren. Ansonsten hat der Track alles, was ein Soundtrack einer Comic-Verfilmung braucht: Surroundkulisse, Dynamik und direktionale Effekte, alles da.
Extras: wie üblich nicht angesehen, wie üblich vergebe ich den Mittelwert. 2D- und 3D-Version liegen auf gesonderten Scheiben vor. Die Scheibe hat kein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: ein Marvel halt. „Venom“ hat durchaus gute Ansätze, verfolgt sie aber nicht konsequent genug. Für mich am störendsten ist wieder mal das Effekte-Geballer im Finale; etwas was mich schon seit längerem bei den Marvels stört. „Venom“ sticht leider auch kaum aus der Masse der Marvels hervor, schade drum. Die Vorlage gäbe soviel mehr her. 7 Review-Balken vergäbe ich wegen der guten ersten Stunde; aufgrund der meines Erachtens sehr wohlwollenden 8 Review-Punkte runde ich als Kontrast ab.
mit 3
mit 5
mit 5
mit 3
bewertet am 18.02.19 um 10:41
Chicago, Illinois, in den 90-ern des letzten Jahrhunderts: der Erzbischof der Stadt wird mit einem Messer brutal abgeschlachtet. Ein Verdächtiger wird noch vom Tatort flüchtend schnell gefasst: der Chorknabe Aaron ist mit des Bischofs Blut beschmiert und hat dessen Ring in der Tasche. Der Staranwalt Vail wittert sofort eine Chance, seinen Marktwert zu steigern und nimmt sich des Falls an. Aaron jedoch, schüchterner Stotterer und eher Opfer- als Tätertyp behauptet zwar, während der Tat im Raum gewesen zu sein, aber auch dass noch eine dritte Person anwesend war. Der überaus arrogante Anwalt Vail, ansonsten eher an seinem Profit und seinem Prestige denn am Wohl seiner Mandanten interessiert wird nach einem Zwischenfall mit Aaron klar, dass der junge Mann an einer dissoziativen Persönlichkeitsspaltung leiden könnte..
"Zwielicht" war 1996 in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert: der Film war mit Richard Gere, damals auf dem Zenith seines Erfolges und mit Laura Linney hochkarätig besetzt, es war Gregory Hoblits erster Spielfilm (der Regisseur drehte später unter anderem noch den oft zu Unrecht gescholtenen "Dämon" mit Denzel Washington) und: es war Edward Nortons erster Auftritt in einem Spielfilm. Norton setzte sich im Casting neben 2000 anderen Bewerbern unter anderem gegen Matt Damon und Leonardo di Caprio durch und erhielt lächerliche 50.000 $ als Gage. "Zwielicht" war Nortons Türöffner zu einer Vielzahl von hochbudgetierten Hollywood-Produktionen, die ihn für eine Weile zum Superstar machten. By the way: eine ähnliche Rolle hat Edward Norton 5 Jahre später in Frank Oz´ "The Score" gespielt.
"Zwielicht" ist für mich ein Klassiker aus den Neunzigern, als eine ganze Reihe von spannenden Justizthrillern heraus kam. Der Film hat besagte Besonderheit, dass Norton durch die Rolle mit dissoziativer Persönlichkeitsspaltung quasi zwei Rollen herausragend verkörpert.
Richard Gere bleibt auch in "Zwielicht" Womanizer, konterkariert sein Image jedoch auch dadurch, dass er das prestige- und mediengeile Arschloch überzeugend gibt. Der Film ist sehr spannend, teils ordentlich brutal und verblüffte mich vor über 20 Jahren nachhaltig mit seinem Schlusstwist. Dass ich das Ende schon kannte minderte den Genuss beim erneuten Sehen gar nicht.
Bild und Ton sind, am Alter des Ausgangsmaterials gemessen, überraschend gut für die blaue Scheibe aufbereitet worden.
Das Bild ist nicht 100%-ig scharf, wirkt dafür aber durch die nicht vorgenommene Überschärfung umso natürlicher. Besonders die Szenen im hellen Tageslicht wirken, als würde man aus dem Fenster sehen, da die Sterilität von manchen neueren Hochglanzproduktionen fehlt. Der Kontrast und der Schwarzwert sind nahezu perfekt, und die Plastizität ist in sehr vielen Szenen toll.
Der Sound liegt "nur" in Dolby Digital 5.1 vor, ist aber dennoch wunderbar räumlich abgemischt worden. Am besten klingt der Score; beim Bass muss man alleine schon genrebedingt ein paar Abstriche machen. In den wenigen Actionszenen kommt gute Dynamik auf, und ein paar direktionale Effekte werden ab und an auch beigemischt.
Die Extras habe ich wie üblich nicht angesehen, ich vergebe 3 Balken. Die Scheibe hat ein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: "Zwielicht" hat für mich das Zeug zum Evergreen, der Film ist kein Stück gealtert (wenn man mal von Anzügen und Frisuren absieht. Daran erkennt man schon das Alter des Films). Dem damaligen Superstar Gere wurde vom Newcomer Norton ordentlich die Butter vom Brot genommen, toll was der spätere "American History X" und "Fight Club"-Star schauspielerisch abruft. "Zwielicht" sollte eigentlich in jeder gut sortierten Sammlung stehen, und technisch stellt die Scheibe durchaus ebenfalls mehr als zufrieden.
"Zwielicht" war 1996 in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert: der Film war mit Richard Gere, damals auf dem Zenith seines Erfolges und mit Laura Linney hochkarätig besetzt, es war Gregory Hoblits erster Spielfilm (der Regisseur drehte später unter anderem noch den oft zu Unrecht gescholtenen "Dämon" mit Denzel Washington) und: es war Edward Nortons erster Auftritt in einem Spielfilm. Norton setzte sich im Casting neben 2000 anderen Bewerbern unter anderem gegen Matt Damon und Leonardo di Caprio durch und erhielt lächerliche 50.000 $ als Gage. "Zwielicht" war Nortons Türöffner zu einer Vielzahl von hochbudgetierten Hollywood-Produktionen, die ihn für eine Weile zum Superstar machten. By the way: eine ähnliche Rolle hat Edward Norton 5 Jahre später in Frank Oz´ "The Score" gespielt.
"Zwielicht" ist für mich ein Klassiker aus den Neunzigern, als eine ganze Reihe von spannenden Justizthrillern heraus kam. Der Film hat besagte Besonderheit, dass Norton durch die Rolle mit dissoziativer Persönlichkeitsspaltung quasi zwei Rollen herausragend verkörpert.
Richard Gere bleibt auch in "Zwielicht" Womanizer, konterkariert sein Image jedoch auch dadurch, dass er das prestige- und mediengeile Arschloch überzeugend gibt. Der Film ist sehr spannend, teils ordentlich brutal und verblüffte mich vor über 20 Jahren nachhaltig mit seinem Schlusstwist. Dass ich das Ende schon kannte minderte den Genuss beim erneuten Sehen gar nicht.
Bild und Ton sind, am Alter des Ausgangsmaterials gemessen, überraschend gut für die blaue Scheibe aufbereitet worden.
Das Bild ist nicht 100%-ig scharf, wirkt dafür aber durch die nicht vorgenommene Überschärfung umso natürlicher. Besonders die Szenen im hellen Tageslicht wirken, als würde man aus dem Fenster sehen, da die Sterilität von manchen neueren Hochglanzproduktionen fehlt. Der Kontrast und der Schwarzwert sind nahezu perfekt, und die Plastizität ist in sehr vielen Szenen toll.
Der Sound liegt "nur" in Dolby Digital 5.1 vor, ist aber dennoch wunderbar räumlich abgemischt worden. Am besten klingt der Score; beim Bass muss man alleine schon genrebedingt ein paar Abstriche machen. In den wenigen Actionszenen kommt gute Dynamik auf, und ein paar direktionale Effekte werden ab und an auch beigemischt.
Die Extras habe ich wie üblich nicht angesehen, ich vergebe 3 Balken. Die Scheibe hat ein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: "Zwielicht" hat für mich das Zeug zum Evergreen, der Film ist kein Stück gealtert (wenn man mal von Anzügen und Frisuren absieht. Daran erkennt man schon das Alter des Films). Dem damaligen Superstar Gere wurde vom Newcomer Norton ordentlich die Butter vom Brot genommen, toll was der spätere "American History X" und "Fight Club"-Star schauspielerisch abruft. "Zwielicht" sollte eigentlich in jeder gut sortierten Sammlung stehen, und technisch stellt die Scheibe durchaus ebenfalls mehr als zufrieden.
mit 5
mit 4
mit 4
mit 3
bewertet am 09.02.19 um 12:00
Die einerseits völlig normale, andererseits alles andere als normale Familie Parr wird in die Normalität gezwungen: Superhelden wurden als illegal proklamiert, und vorbei ist nun vor allem Bob Parrs Dasein als Superheld Mr. Incredible. Ein superreiches Geschwisterpaar will, dass Superhelden ihre Taten zum Wohle der Menschen wieder legal verüben können, allerdings soll nach verschiedenen Evaluationen zunächst nur Helen Parr aka Elastigirl Supertaten verbringen, damit die Superhelden wieder salonfähig werden, während Bob den Haushalt schmeißt und die Kinder hütet. Das funktioniert auch eine Weile leidlich, und während Bob nach und nach Baby Jack-Jacks multiple Superkräfte entdeckt und fördert, rettet Helen die Welt. Aber hinter der Aktion steckt ein fieser Plan..
Auf dem Regiestuhl hat für „Die Unglaublichen 2“ erneut Brad Bird Platz genommen, und normalerweise ist ein Folgefilm dann auch in den besten Händen. Das ist, soviel sei vorweg genommen, bei „The Incredibles 2“ nicht der Fall.
Bird hat mit „Die Unglaublichen“ vor einigen Jahren einen tollen Animationsfilm inszeniert; gleichermaßen für Jung und Alt; witzig, rasant und auf rührende Art und Weise Familien-“Probleme“ zwischen Eltern und Kindern behandelnd. „Die Unglaublichen“ war frisch und anders, „Die Unglaublichen 2“ ist auf seltsame Art und Weise besonders im 3. Viertel ziemlich lahm und unspritzig. Dem Film hätte eine Straffung oder besser: eine Kürzung um etwa 20 Minuten gut getan.
So bleibt unterm Strich eine Fortsetzung, die man nicht unbedingt gesehen haben muss.
Das Bild von „Die Unglaublichen 2“ ist, wie kann es bei einem animierten Film auch anders sein, hervorragend. Und das in jedem einzelnen Parameter. Punkt.
Ich habe zwar insgesamt viele animierte Filme gesehen, aber vor „Die Unglaublichen 2“ schon länger keinen mehr. Darum bin ich umso verblüffter, wie fotorealistisch auch schwierigste Strukturen wie Haar oder Wasser wirken. „Die Unglaublichen 2“ ist bereits in 2D teils unfassbar plastisch, aber die 3D-Version setzt definitiv noch ein paar Schippen drauf.
Das 3D ist perfekt. Lediglich Pop Outs sind ziemlich selten, dafür ist das Bild ungeheuer räumlich und schön tief gestaffelt. Ghosting, Aliasing, Doppelkonturen: alles Fehlanzeige. Diese Blu-ray ist Referenz und kann als Demo-Material für die eigene 3D-Technik verwendet werden.
Der Sound ist so, wie man es von einem hoch budgetierten Hollywood-Animationsfilm und von einer Disney-Produktion erwarten kann: bassstark, hochdynamisch und mit allerlei Surroundgeräuschen und direktionalen Effekten angefettet.
Extras: nicht angesehen, ich vergebe die Durchschnittswertung. Das Pop Art-Steelbook ist hochwertig verarbeitet; das Motiv ist natürlich Geschmackssache. 3D, 2D-Version und Boni liegen auf drei separaten Scheiben vor.
Mein persönliches Fazit: War zwar ganz ok, aber mehr als ein Mal muss ich „Die Unglaublichen 2“ nicht sehen. Wie so oft bei Folgefilmen fehlt die Frische, die Originalität und der Esprit des Erstlings, und der Film ist zu lang. Schade drum. 3 Balken wären etwas wenig, ich vergäbe 7 von 10; also runde ich auf.
Auf dem Regiestuhl hat für „Die Unglaublichen 2“ erneut Brad Bird Platz genommen, und normalerweise ist ein Folgefilm dann auch in den besten Händen. Das ist, soviel sei vorweg genommen, bei „The Incredibles 2“ nicht der Fall.
Bird hat mit „Die Unglaublichen“ vor einigen Jahren einen tollen Animationsfilm inszeniert; gleichermaßen für Jung und Alt; witzig, rasant und auf rührende Art und Weise Familien-“Probleme“ zwischen Eltern und Kindern behandelnd. „Die Unglaublichen“ war frisch und anders, „Die Unglaublichen 2“ ist auf seltsame Art und Weise besonders im 3. Viertel ziemlich lahm und unspritzig. Dem Film hätte eine Straffung oder besser: eine Kürzung um etwa 20 Minuten gut getan.
So bleibt unterm Strich eine Fortsetzung, die man nicht unbedingt gesehen haben muss.
Das Bild von „Die Unglaublichen 2“ ist, wie kann es bei einem animierten Film auch anders sein, hervorragend. Und das in jedem einzelnen Parameter. Punkt.
Ich habe zwar insgesamt viele animierte Filme gesehen, aber vor „Die Unglaublichen 2“ schon länger keinen mehr. Darum bin ich umso verblüffter, wie fotorealistisch auch schwierigste Strukturen wie Haar oder Wasser wirken. „Die Unglaublichen 2“ ist bereits in 2D teils unfassbar plastisch, aber die 3D-Version setzt definitiv noch ein paar Schippen drauf.
Das 3D ist perfekt. Lediglich Pop Outs sind ziemlich selten, dafür ist das Bild ungeheuer räumlich und schön tief gestaffelt. Ghosting, Aliasing, Doppelkonturen: alles Fehlanzeige. Diese Blu-ray ist Referenz und kann als Demo-Material für die eigene 3D-Technik verwendet werden.
Der Sound ist so, wie man es von einem hoch budgetierten Hollywood-Animationsfilm und von einer Disney-Produktion erwarten kann: bassstark, hochdynamisch und mit allerlei Surroundgeräuschen und direktionalen Effekten angefettet.
Extras: nicht angesehen, ich vergebe die Durchschnittswertung. Das Pop Art-Steelbook ist hochwertig verarbeitet; das Motiv ist natürlich Geschmackssache. 3D, 2D-Version und Boni liegen auf drei separaten Scheiben vor.
Mein persönliches Fazit: War zwar ganz ok, aber mehr als ein Mal muss ich „Die Unglaublichen 2“ nicht sehen. Wie so oft bei Folgefilmen fehlt die Frische, die Originalität und der Esprit des Erstlings, und der Film ist zu lang. Schade drum. 3 Balken wären etwas wenig, ich vergäbe 7 von 10; also runde ich auf.
mit 4
mit 5
mit 5
mit 3
bewertet am 04.02.19 um 09:28
Eckhausen, bei Hannover, 2003: in der britischen Garnison taucht überraschend das schwerkranke Mädchen Alice Webster wieder auf, das elf Jahre zuvor spurlos verschwunden war. Es konnte seinerzeit nie geklärt werden, ob Alice "nur" durchgebrannt war oder .. entführt wurde. Im Rettungswagen gibt das Mädchen jedoch Sophie Giroux als eigenen Namen an. Die ermittelnde Militärpolizistin Eve Stone, Tochter eines ehemaligen Generals, findet heraus, dass eine Sophie Giroux ebenfalls vor Jahren in Frankreich verschwand und kontaktiert den damals ermittelnden französischen Kriminalbeamten: Julien Baptiste (genau, DER Julien Baptiste aus der 1. Staffel).
Baptiste hegt wie die Mutter von "Alice" recht schnell Zweifel daran, dass das Mädchen die echte Alice ist; der Vater weigert sich wider besseren Wissens beharrlich, das auch nur zu vermuten. Baptiste fängt an zu bohren und zu graben und entdeckt Spuren, die bis in den 2. Golfkrieg führen..
Die erste Staffel von "The Missing" empfand ich persönlich als eine herausragende Thriller-Serie, die enorm spannend und hochdramatisch erzählt ist. Die zweite Staffel der BBC-Serie fängt ungewöhnlich an, wenn man sie mit der 1. vergleicht und weist in den ersten 2, 3 Folgen beinahe schon eine Art Mystery-Touch auf, was nicht zuletzt an dem zombie-mäßigen Aussehen des Mädchens liegt. Während dieser ersten Folgen wusste ich noch nicht so recht, ob mir diese neue, vermutete Machart gefällt. Nach diesen Folgen jedoch kommt die 2. Staffel auf Kurs und potenziert die Markenzeichen der 1. Staffel um ein Vielfaches: nebeneinander werden drei Storylines erzählt, die alle miteinander zu tun haben; und dabei wird wieder zwischen der Vergangenheit in 2003, 2014 und 2016 hin und her gesprungen. Dabei berühren sich die Erzählstränge nur ab und an, um am Schluss miteinander verwoben zu werden und dann Sinn zu ergeben. Bis dahin wird der Zuschauer permanent gefordert: wer nicht stets aufmerksam bleibt verpasst wichtige Details, die bei den eigenen Ermittlungen dann fehlen.
Auch die 2. Staffel von "The Missing" ist wieder sehr spannend, außergewöhnlich dramatisch und teils sehr berührend.
Entgegen meiner üblichen Sehgewohnheiten wurde „The Missing“ statt auf 65 Zoll auf einem Fernseher mit 37 Zoll Diagonale gesehen. Auf dieser kleineren Mattscheibe zeigte sich das Bild scharf, ausgewogen kontrastiert und mit sattem Schwarzwert versehen, dabei zudem noch schön plastisch. Ich denke nicht, dass sich die Parameter auf einer größeren Diagonale verschlechtern, deshalb: Höchstwertung.
Der Sound wurde nur durch die TV-Lautsprecher übertragen, liegt auf der Scheibe aber in DTS HD MA 5.1 vor und sollte, wie von anderen BBC-Produktionen gewohnt, recht gut ausfallen. Ich vergebe zunächst mal 4 Balken, denn allzu viel Bass und Dynamik dürfte aufgrund der eher dialoglastigen Inszenierung nicht zu erwarten sein. Das Ergebnis wird nach einer Überprüfung auf der Heimkinoanlage eventuell angepasst.
Die Extras habe ich nicht angesehen, ich vergebe vorsichtige drei Balken. Die Laufzeit der Serie insgesamt ist nicht übermäßig lang: es liegen 8 Folgen mit je etwa 60 Minuten Laufzeit vor. Diese Amaray verfügt leider nicht über einen Hochglanz-Pappschuber und passt somit nicht zur 1. Staffel.
Mein persönliches Fazit: die 2. Staffel von "The Missing" ist wiederum eine herausragende Thriller-Serie, und im Gegensatz zur 1. Staffel schlägt das Pendel bei der 2. mehr in Richtung Thriller denn in Richtung Drama aus. Sauspannend, perfekt erzählt und hochdramatisch: Thriller-Serienfans; ansehen!
Baptiste hegt wie die Mutter von "Alice" recht schnell Zweifel daran, dass das Mädchen die echte Alice ist; der Vater weigert sich wider besseren Wissens beharrlich, das auch nur zu vermuten. Baptiste fängt an zu bohren und zu graben und entdeckt Spuren, die bis in den 2. Golfkrieg führen..
Die erste Staffel von "The Missing" empfand ich persönlich als eine herausragende Thriller-Serie, die enorm spannend und hochdramatisch erzählt ist. Die zweite Staffel der BBC-Serie fängt ungewöhnlich an, wenn man sie mit der 1. vergleicht und weist in den ersten 2, 3 Folgen beinahe schon eine Art Mystery-Touch auf, was nicht zuletzt an dem zombie-mäßigen Aussehen des Mädchens liegt. Während dieser ersten Folgen wusste ich noch nicht so recht, ob mir diese neue, vermutete Machart gefällt. Nach diesen Folgen jedoch kommt die 2. Staffel auf Kurs und potenziert die Markenzeichen der 1. Staffel um ein Vielfaches: nebeneinander werden drei Storylines erzählt, die alle miteinander zu tun haben; und dabei wird wieder zwischen der Vergangenheit in 2003, 2014 und 2016 hin und her gesprungen. Dabei berühren sich die Erzählstränge nur ab und an, um am Schluss miteinander verwoben zu werden und dann Sinn zu ergeben. Bis dahin wird der Zuschauer permanent gefordert: wer nicht stets aufmerksam bleibt verpasst wichtige Details, die bei den eigenen Ermittlungen dann fehlen.
Auch die 2. Staffel von "The Missing" ist wieder sehr spannend, außergewöhnlich dramatisch und teils sehr berührend.
Entgegen meiner üblichen Sehgewohnheiten wurde „The Missing“ statt auf 65 Zoll auf einem Fernseher mit 37 Zoll Diagonale gesehen. Auf dieser kleineren Mattscheibe zeigte sich das Bild scharf, ausgewogen kontrastiert und mit sattem Schwarzwert versehen, dabei zudem noch schön plastisch. Ich denke nicht, dass sich die Parameter auf einer größeren Diagonale verschlechtern, deshalb: Höchstwertung.
Der Sound wurde nur durch die TV-Lautsprecher übertragen, liegt auf der Scheibe aber in DTS HD MA 5.1 vor und sollte, wie von anderen BBC-Produktionen gewohnt, recht gut ausfallen. Ich vergebe zunächst mal 4 Balken, denn allzu viel Bass und Dynamik dürfte aufgrund der eher dialoglastigen Inszenierung nicht zu erwarten sein. Das Ergebnis wird nach einer Überprüfung auf der Heimkinoanlage eventuell angepasst.
Die Extras habe ich nicht angesehen, ich vergebe vorsichtige drei Balken. Die Laufzeit der Serie insgesamt ist nicht übermäßig lang: es liegen 8 Folgen mit je etwa 60 Minuten Laufzeit vor. Diese Amaray verfügt leider nicht über einen Hochglanz-Pappschuber und passt somit nicht zur 1. Staffel.
Mein persönliches Fazit: die 2. Staffel von "The Missing" ist wiederum eine herausragende Thriller-Serie, und im Gegensatz zur 1. Staffel schlägt das Pendel bei der 2. mehr in Richtung Thriller denn in Richtung Drama aus. Sauspannend, perfekt erzählt und hochdramatisch: Thriller-Serienfans; ansehen!
mit 5
mit 5
mit 5
mit 3
bewertet am 29.01.19 um 07:47
Overwatch ist eine strengst geheime Unterorganisation der CIA, die immer dann zum Zuge kommt, wenn Diplomatie und Militär versagt haben. Nicht selten sind gezielte Tötungen die Aufträge, und alleine deshalb geben alle Mitglieder ihre Identität auf: jegliche Art von persönlichen Daten in jeder erdenklichen Art von Datenbank verschwindet. James Silva, einst hochbegabtes Kind mit Hang zu körperlicher Gewalt, ehemaliger Angehöriger der Special Forces, ehemaliger CIA-Außenagent und jetzt höchst teamfähiger, stets gelassener und hoch sympathischer Führer des Einsatzteams von Overwatch, findet bei einem Einsatz eine codierte Festplatte. Darauf befinden sich die Ortsangaben von Behältern mit höchst radioaktivem Cäsium, das für den Bau von schmutzigen Bomben genutzt werden soll. Doch nur ein Überläufer, der sich in einer südostasiatischen Stadt in die amerikanische Botschaft rettet kennt den Code für die Festplatte, gibt ihn aber nur für seine Einreise in die USA preis.
Challenge: zwischen Botschaft und Flughafen liegen 22 Meilen, die Feinde des Überläufers sind nicht gerade zimperlich und das Zeitfenster bis zum Abflug ist klein.. Und über allem schwebt ein Aufklärungsflugzeug der Russen.
„Mile 22“ ist nach „Lone Survivor“, „Boston“ und „Deepwater Horizon“ die mittlerweile sage und schreibe 4. Zusammenarbeit von Regisseur Peter Berg und Oscar-Preisträger Mark Wahlberg. Wie in den Kommentaren schon mal angemerkt ist „Mile 22“ tatsächlich so eine Art Mélange aus „16 Blocks“ und „S.W.A.T.“, allerdings eine Mélange mit der Hauptzutat Amphetamin. Im Film gibt es nur selten Stillstand, und die Action dominiert: „Mile 22“ ist ein reinrassiger Actioner, ohne Wenn und Aber. Und als Actioner funktioniert der Film recht gut: die Fights und die Schießereien sind hervorragend choreographiert, mit wenig und teils komplett ohne Kameragewackel, so dass man auch etwas erkennen kann. Wie man es von Filmen mit Indonesiens Martial Arts-Star Iko Uwais kennt, sind die Kämpfe teils extrem brutal: ich dachte immer, das wäre das Markenzeichen vom Regisseur der „Raids“ Gareth Evans; scheint eher so, dass sich so was Uwais ins Drehbuch wünscht. Da werden Knochen gebrochen und Kehlen aufgeschltzt, dass es (k)eine wahre Freude ist; und Uwais sieht hinterher immer aus wie ein Schlachthof-Metzger.
Wahlberg legt seinen Spezialagenten absolut überzeugend so an wie seinen Detective in „The Departed“: unsympathisch, großmäulig, absolut menschenfeindlich und nur auf den Auftrag fixiert. Der Schlusstwist ist zwar nicht völlig unvorhersehbar, hat mich aber dennoch überrascht. Das Ende lässt zudem einen Folgefilm erwarten.
Man darf jedoch nicht vergessen, dass hier eine amerikanische Organisation gezeigt wird (und so unrealistisch scheint mir diese gezeigte Einheit nicht), die absolut skrupellos auch schon mal entwaffnete Gefangene liquidiert.
Auf meiner Technik präsentierte sich das Bild eigentlich ziemlich gut. Der Schwarzwert ist satt, der Kontrast ist ausgewogen. Die Schärfe ist hoch; insgesamt ist das Bild so, wie man es von einer Big Budget-Blockbuster Produktion erwarten kann.
Der Sound ist so, wie man es von einem hoch budgetierten Hollywood-Actioner erwarten kann: bassstark, hochdynamisch und mit allerlei Surroundgeräuschen und direktionalen Effekten angefettet.
Extras: nicht angesehen, ich vergebe die Durchschnittswertung. Meine Version hat kein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: „Mile 22“ ist definitiv ein sehr straff inszenierter Actioner, der aus der Masse heraus sticht und der dem Zuschauer kaum eine Minute Atempause gönnt. Die Action ist nahezu perfekt in Szene gesetzt und hilft darüber hinweg, dass die Story altbekannt ist und bereits mehrfach in ähnlicher Form über die Leinwand geflimmert ist. Wahlberg spielt das Arschloch hervorragend; Uwais tut das, was er am besten kann und zeigt darüber hinaus Ansätze von darstellerischem Können. Von mir eine uneingeschränkte Kaufempfehlung für Action-Fans, und für alle anderen (außer vielleicht für Fans von romantischen Komödien und Walt Disney) definitiv eine Sehempfehlung.
Challenge: zwischen Botschaft und Flughafen liegen 22 Meilen, die Feinde des Überläufers sind nicht gerade zimperlich und das Zeitfenster bis zum Abflug ist klein.. Und über allem schwebt ein Aufklärungsflugzeug der Russen.
„Mile 22“ ist nach „Lone Survivor“, „Boston“ und „Deepwater Horizon“ die mittlerweile sage und schreibe 4. Zusammenarbeit von Regisseur Peter Berg und Oscar-Preisträger Mark Wahlberg. Wie in den Kommentaren schon mal angemerkt ist „Mile 22“ tatsächlich so eine Art Mélange aus „16 Blocks“ und „S.W.A.T.“, allerdings eine Mélange mit der Hauptzutat Amphetamin. Im Film gibt es nur selten Stillstand, und die Action dominiert: „Mile 22“ ist ein reinrassiger Actioner, ohne Wenn und Aber. Und als Actioner funktioniert der Film recht gut: die Fights und die Schießereien sind hervorragend choreographiert, mit wenig und teils komplett ohne Kameragewackel, so dass man auch etwas erkennen kann. Wie man es von Filmen mit Indonesiens Martial Arts-Star Iko Uwais kennt, sind die Kämpfe teils extrem brutal: ich dachte immer, das wäre das Markenzeichen vom Regisseur der „Raids“ Gareth Evans; scheint eher so, dass sich so was Uwais ins Drehbuch wünscht. Da werden Knochen gebrochen und Kehlen aufgeschltzt, dass es (k)eine wahre Freude ist; und Uwais sieht hinterher immer aus wie ein Schlachthof-Metzger.
Wahlberg legt seinen Spezialagenten absolut überzeugend so an wie seinen Detective in „The Departed“: unsympathisch, großmäulig, absolut menschenfeindlich und nur auf den Auftrag fixiert. Der Schlusstwist ist zwar nicht völlig unvorhersehbar, hat mich aber dennoch überrascht. Das Ende lässt zudem einen Folgefilm erwarten.
Man darf jedoch nicht vergessen, dass hier eine amerikanische Organisation gezeigt wird (und so unrealistisch scheint mir diese gezeigte Einheit nicht), die absolut skrupellos auch schon mal entwaffnete Gefangene liquidiert.
Auf meiner Technik präsentierte sich das Bild eigentlich ziemlich gut. Der Schwarzwert ist satt, der Kontrast ist ausgewogen. Die Schärfe ist hoch; insgesamt ist das Bild so, wie man es von einer Big Budget-Blockbuster Produktion erwarten kann.
Der Sound ist so, wie man es von einem hoch budgetierten Hollywood-Actioner erwarten kann: bassstark, hochdynamisch und mit allerlei Surroundgeräuschen und direktionalen Effekten angefettet.
Extras: nicht angesehen, ich vergebe die Durchschnittswertung. Meine Version hat kein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: „Mile 22“ ist definitiv ein sehr straff inszenierter Actioner, der aus der Masse heraus sticht und der dem Zuschauer kaum eine Minute Atempause gönnt. Die Action ist nahezu perfekt in Szene gesetzt und hilft darüber hinweg, dass die Story altbekannt ist und bereits mehrfach in ähnlicher Form über die Leinwand geflimmert ist. Wahlberg spielt das Arschloch hervorragend; Uwais tut das, was er am besten kann und zeigt darüber hinaus Ansätze von darstellerischem Können. Von mir eine uneingeschränkte Kaufempfehlung für Action-Fans, und für alle anderen (außer vielleicht für Fans von romantischen Komödien und Walt Disney) definitiv eine Sehempfehlung.
mit 4
mit 5
mit 5
mit 3
bewertet am 26.01.19 um 17:30
Über Mittelamerika (wieso eigentlich immer über Mittelamerika!? Ach so, ja: der genutzte Teil des Heimatplaneten der Rasse sieht in "Predators" ja aus wie subtropischer Regenwald) stürzt mal wieder ein Alien-Raumschiff ab (dieses Mal wurde es abgeschossen) und unterbricht ein Sniper-Team der Amerikaner, die gerade einen Drogen-Dealer liquidieren wollen. Bei der Absicherung des Unfallortes und der beabsichtigten Erstversorgung etwaiger Verletzter durch das Sniper-Team zerlegt das Unfallopfer erst mal zwei der Teammitglieder. Der Teamleader nimmt in weiser Voraussicht Ausrüstungsgegenstände aus dem Alien-Schiff an sich und schickt sie an seinen autistischen Sohn, denn er ahnt schon, dass die Regierung einen Alien-Kontakt erstmal vertuschen will. Der Sohn benutzt die Teile als Halloween-Kostüm und setzt dadurch im Equipment installierte Tracker in Gang, und als das Alien (mittlerweile Predator genannt) ausbricht, macht es sich auf die Suche nach seiner Ausrüstung… Der Predator wird allerdings selbst gesucht, und zwar von der One Man Crew des Schiffes, das ihn abgeschossen hat.
Shane Black ist dem Filmkundigen natürlich kein Unbekannter, hat der Amerikaner doch nicht nur vor diesem hier andere Filme wie „The Nice Guys“ gedreht und einige (ziemlich gute) Drehbücher geschrieben („Lethal Weapon“), er hat im Ur-„Predator“ auch ein Mitglied des Teams von Arnie gespielt, das ziemlich schnell unschön aus dem Leben schied. Meines Erachtens hat er als Regisseur bislang nur einen guten Film gedreht („Kiss Kiss Bang Bang“), und diese Meinung hat „Predator Upgrade“ nicht verändert.
„Predator Upgrade“ fängt zwar mit bis zum Bodenblech durchgetretenem Gaspedal an, ist aber zumindest mal zu Beginn gar nicht mal so schlecht; jedoch wird es der Film mit jeder Filmminute mehr. Ziemlich ikonisch ist die Splatterszene, als dem Predator die Eingeweide des getöteten Soldaten auf die Maske fallen und er die gelben Augen öffnet. Danach wird der Film zwar actionhaltig, aber eben auch zum Teil seltsam klamaukig. Was der Film nicht wird: spannend und atmosphärisch.
Ob nun Behinderungen und das Tourette-Syndrom hier veralbert werden ist mir persönlich einerlei, politische Unkorrektheit fand ich schon immer gut. Sehr viel störender fand ich die extremen Logiklöcher, wenn beispielsweise die neu angeworbenen „Teammitglieder“ (die „Irren“ aus dem Bus) auch angesichts eines 2,50 und eines weiteren 3,50 m großen, nicht gerade sympathisch aussehenden Außerirdischen nicht das geringste bisschen Angst zeigen oder eine Biologin ohne jede Ausbildung plötzlich hervorragend mit halbautomatischen Waffen umgehen kann. Derlei Logiklöcher gibt es zuhauf, das nervt nach einer Weile doch ziemlich.
Grundsätzlich gefällt es mir persönlich schon, wenn eine unheimliche oder spannende Stimmung durch einen gut platzierten Oneliner aufgelockert wird (legendär aus dem Ur-"Predator": "Du blutest!" Entgegnung: "Ich habe keine Zeit zum bluten..." oder "Wenn es blutet, können wir es töten.."), aber wenn Spannung und Atmosphäre nicht vorhanden sind wirken blöde Sprüche eben oft deplatziert.
Was ich am schlimmsten fand ist, dass „Predator Upgrade“ nicht das geringste bisschen Atmosphäre erzeugt. „Predator“ von 1987 ist Kult, ist kein bisschen gealtert und beeindruckt nach wie vor auch bei der x-ten Sichtung gerade durch besagte Atmosphäre, die durch den Score, komponiert für die Ewigkeit, maßgeblich gefördert wird. Der Score erklingt ansatzweise auch in „Upgrade“, das reißt es aber leider nicht ´raus.
Unterm Strich bleibt ein seelenloser Actioner, ohne Spannung und ohne Atmosphäre, den genau genommen kein Mensch braucht.
Auf meiner Technik präsentierte sich das Bild eigentlich ziemlich gut. Der Schwarzwert ist satt, der Kontrast ist ausgewogen. Die Schärfe ist hoch; insgesamt ist das Bild so, wie man es von einer Big Budget-Blockbuster Produktion erwarten kann.
Beim Sound könnte der Bass tatsächlich stärker sein, das lässt sich aber regeln. Die restlichen Parameter wie Dynamik und Surroundkulisse sind recht ordentlich, aber nicht herausragend.
Extras: nicht angesehen, ich vergebe die vorliegende Durchschnittswertung. Meine Version hat ein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: hat die Menschheit (sprich: die Fanbase) einen weiteren neuen „Predator“-Film gebraucht? Vielleicht schon, aber sicher nicht in dieser Form. An eine Fortsetzung einer Creature Feature-Ikone („Predator“ ist für mich weder reiner Action- noch Horror- noch Science Fiction-Film) sollte ein versierter Regisseur ´ran, der sein Handwerk auch versteht und nicht nur auf nahezu permanente Action und unnötige Comedy setzt, sondern Gänsehaut-Atmosphäre erzeugen kann. Und das kann Shane Black nun mal nicht.
Shane Black ist dem Filmkundigen natürlich kein Unbekannter, hat der Amerikaner doch nicht nur vor diesem hier andere Filme wie „The Nice Guys“ gedreht und einige (ziemlich gute) Drehbücher geschrieben („Lethal Weapon“), er hat im Ur-„Predator“ auch ein Mitglied des Teams von Arnie gespielt, das ziemlich schnell unschön aus dem Leben schied. Meines Erachtens hat er als Regisseur bislang nur einen guten Film gedreht („Kiss Kiss Bang Bang“), und diese Meinung hat „Predator Upgrade“ nicht verändert.
„Predator Upgrade“ fängt zwar mit bis zum Bodenblech durchgetretenem Gaspedal an, ist aber zumindest mal zu Beginn gar nicht mal so schlecht; jedoch wird es der Film mit jeder Filmminute mehr. Ziemlich ikonisch ist die Splatterszene, als dem Predator die Eingeweide des getöteten Soldaten auf die Maske fallen und er die gelben Augen öffnet. Danach wird der Film zwar actionhaltig, aber eben auch zum Teil seltsam klamaukig. Was der Film nicht wird: spannend und atmosphärisch.
Ob nun Behinderungen und das Tourette-Syndrom hier veralbert werden ist mir persönlich einerlei, politische Unkorrektheit fand ich schon immer gut. Sehr viel störender fand ich die extremen Logiklöcher, wenn beispielsweise die neu angeworbenen „Teammitglieder“ (die „Irren“ aus dem Bus) auch angesichts eines 2,50 und eines weiteren 3,50 m großen, nicht gerade sympathisch aussehenden Außerirdischen nicht das geringste bisschen Angst zeigen oder eine Biologin ohne jede Ausbildung plötzlich hervorragend mit halbautomatischen Waffen umgehen kann. Derlei Logiklöcher gibt es zuhauf, das nervt nach einer Weile doch ziemlich.
Grundsätzlich gefällt es mir persönlich schon, wenn eine unheimliche oder spannende Stimmung durch einen gut platzierten Oneliner aufgelockert wird (legendär aus dem Ur-"Predator": "Du blutest!" Entgegnung: "Ich habe keine Zeit zum bluten..." oder "Wenn es blutet, können wir es töten.."), aber wenn Spannung und Atmosphäre nicht vorhanden sind wirken blöde Sprüche eben oft deplatziert.
Was ich am schlimmsten fand ist, dass „Predator Upgrade“ nicht das geringste bisschen Atmosphäre erzeugt. „Predator“ von 1987 ist Kult, ist kein bisschen gealtert und beeindruckt nach wie vor auch bei der x-ten Sichtung gerade durch besagte Atmosphäre, die durch den Score, komponiert für die Ewigkeit, maßgeblich gefördert wird. Der Score erklingt ansatzweise auch in „Upgrade“, das reißt es aber leider nicht ´raus.
Unterm Strich bleibt ein seelenloser Actioner, ohne Spannung und ohne Atmosphäre, den genau genommen kein Mensch braucht.
Auf meiner Technik präsentierte sich das Bild eigentlich ziemlich gut. Der Schwarzwert ist satt, der Kontrast ist ausgewogen. Die Schärfe ist hoch; insgesamt ist das Bild so, wie man es von einer Big Budget-Blockbuster Produktion erwarten kann.
Beim Sound könnte der Bass tatsächlich stärker sein, das lässt sich aber regeln. Die restlichen Parameter wie Dynamik und Surroundkulisse sind recht ordentlich, aber nicht herausragend.
Extras: nicht angesehen, ich vergebe die vorliegende Durchschnittswertung. Meine Version hat ein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: hat die Menschheit (sprich: die Fanbase) einen weiteren neuen „Predator“-Film gebraucht? Vielleicht schon, aber sicher nicht in dieser Form. An eine Fortsetzung einer Creature Feature-Ikone („Predator“ ist für mich weder reiner Action- noch Horror- noch Science Fiction-Film) sollte ein versierter Regisseur ´ran, der sein Handwerk auch versteht und nicht nur auf nahezu permanente Action und unnötige Comedy setzt, sondern Gänsehaut-Atmosphäre erzeugen kann. Und das kann Shane Black nun mal nicht.
mit 2
mit 5
mit 4
mit 2
bewertet am 26.01.19 um 12:01
Neulich, während der letzten Eiszeit irgendwo in Europa: der junge Mann Keda steht auf der Schwelle zum erwachsen werden und wird das erste Mal mit auf die Büffeljagd genommen (wahrscheinlich eher auf die Wisentjagd). Der Jagderfolg scheint gerade groß, als sich eines der Tiere dazu entschließt, sich nicht so ohne weiteres aufzugeben und den Spieß umdreht: dabei stürzt Keda in eine Schlucht und bleibt unerreichbar für die anderen Jäger schwer verletzt auf einem schmalen Felsvorsprung liegen, worauf die Jäger ihn zurück lassen. Der Junge kämpft sich jedoch zurück ins Leben, und als er bei einem Angriff von Wölfen einen davon verletzt, der ebenfalls zurück bleibt beginnt eine ungewöhnliche Freundschaft..
Aha. So also ist der Mensch auf den Hund gekommen. Genau das wollen die Filmemacher den Zuschauer Glauben machen, und so abwegig scheint die Story auch nicht. „Alpha“ ist insbesondere visuell herausragend: besonders während der ersten etwa 45 Minuten ist beinahe jede Einstellung ein kleines Kunstwerk, das farblich perfekt abgestimmt und außergewöhnlich fotographiert wirklich beeindruckt. Da liegt auch einer der Hasen im Pfeffer von „Alpha“: in einer rauen und rohen Atmosphäre, wie man sie von einem Vorzeitfilm eigentlich erwartet haben Hochglanz-Prospektaufnahmen nichts zu suchen. Darüber könnte man jedoch hinwegsehen, sind doch viele Bilder wirklich beeindruckend; in Kombination mit den häufigen Logiklöchern jedoch wird so mancher Sachverhalt in „Alpha“ zum Ärgernis.
SPOILER:
Dass Vorzeitmenschen, die in der Lage waren Feuer zu machen unter anderem Zunder oder ähnliches mit sich trugen ist bekannt; woher jedoch inmitten einer freien Schneefläche (um nicht zu sagen Eiswüste) ohne jeden Bewuchs plötzlich Brennmaterial kommen soll ist etwas fragwürdig.
Keda fällt ins Wasser und macht anschließend mit nassem Equipment ein lächerlich kleines Feuerchen, das ihn vor dem Erfrieren bewahren soll.
Gerade noch mit dick geschwollenem, gebrochenem Knöchel nahezu bewegungsunfähig, ist Keda ohne erkennbar größeren Zeitsprung nach einem Kräuterwickel geradezu springlebendig. Und trägt dann einen ausgewachsenen Wolf gefühlt tagelang und kilometerweit durch die Wallachei.
Derlei Auffälligkeiten gibt es zuhauf, das ist eine ärgerliche Spielerei mit der Intelligenz des Zuschauers.
SPOILER ENDE
Dennoch: „Alpha“ ist recht unterhaltsam und nicht unspannend, allzu sehr nachdenken sollte man über das Gesehen jedoch nicht. Untertitel lesen zu müssen empfand ich etwas störend, das hat man in vergleichbaren Filmen wie "Der Mann aus dem Eis" besser gelöst. Milchbrötchen Kodi Smit-McPhee müht sich redlich, ist aber trotzdem für mich eine Fehlbesetzung.
Technisch bewegt sich die Scheibe au sehr hohem Niveau. Besonders die Plastizität des Bildes ist beispielhaft; ohnehin sind alle Parameter im sattgrünen Bereich. Bildfehler waren au meiner Technik nicht erkennbar oder so marginal, dass sie nicht weiter ins Gewicht allen.
Der deutsche Track liegt in DTS HD MA 5.1 vor und stellt ebenfalls mehr als zufrieden. Zugegeben: an Bass hätte es etwas mehr sein dürfen, aber das lässt sich regeln. Die Dynamik passt, und besonders während des Wolfsgeheuls und während des Sturms ist die Surroundkulisse hervorragend. Für die Höchstwertung reicht es locker.
Die Extras hab ich wie meist nicht angesehen, ich vergebe die Mittelwertung. Die Scheibe hat kein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: ich hätte mir von der Thematik eigentlich mehr erwartet; allerdings hatte Regisseur Albert Hughes zusammen mit seinem Bruder auch schon „The Book of Eli“ verbrochen, der ebenfalls vor Logiklöchern nur so wimmelte. Daran stören sich andere vielleicht nicht, mir persönlich verhagelt sowas schon den Genuss. Davon abgesehen ist „Alpha“ leidlich unterhaltsam und für einen kurzweiligen Filmabend gerade so geeignet, wenn man gerade nichts anderes zur Hand hat. Neu kaufen muss man den Film nun wirklich nicht, und unbedingt gesehen haben zum Release muss man ihn auch nicht. 3 Balken vergebe ich wegen der tollen Visualisierung, verdient hat sie der Film eigentlich nicht.
Aha. So also ist der Mensch auf den Hund gekommen. Genau das wollen die Filmemacher den Zuschauer Glauben machen, und so abwegig scheint die Story auch nicht. „Alpha“ ist insbesondere visuell herausragend: besonders während der ersten etwa 45 Minuten ist beinahe jede Einstellung ein kleines Kunstwerk, das farblich perfekt abgestimmt und außergewöhnlich fotographiert wirklich beeindruckt. Da liegt auch einer der Hasen im Pfeffer von „Alpha“: in einer rauen und rohen Atmosphäre, wie man sie von einem Vorzeitfilm eigentlich erwartet haben Hochglanz-Prospektaufnahmen nichts zu suchen. Darüber könnte man jedoch hinwegsehen, sind doch viele Bilder wirklich beeindruckend; in Kombination mit den häufigen Logiklöchern jedoch wird so mancher Sachverhalt in „Alpha“ zum Ärgernis.
SPOILER:
Dass Vorzeitmenschen, die in der Lage waren Feuer zu machen unter anderem Zunder oder ähnliches mit sich trugen ist bekannt; woher jedoch inmitten einer freien Schneefläche (um nicht zu sagen Eiswüste) ohne jeden Bewuchs plötzlich Brennmaterial kommen soll ist etwas fragwürdig.
Keda fällt ins Wasser und macht anschließend mit nassem Equipment ein lächerlich kleines Feuerchen, das ihn vor dem Erfrieren bewahren soll.
Gerade noch mit dick geschwollenem, gebrochenem Knöchel nahezu bewegungsunfähig, ist Keda ohne erkennbar größeren Zeitsprung nach einem Kräuterwickel geradezu springlebendig. Und trägt dann einen ausgewachsenen Wolf gefühlt tagelang und kilometerweit durch die Wallachei.
Derlei Auffälligkeiten gibt es zuhauf, das ist eine ärgerliche Spielerei mit der Intelligenz des Zuschauers.
SPOILER ENDE
Dennoch: „Alpha“ ist recht unterhaltsam und nicht unspannend, allzu sehr nachdenken sollte man über das Gesehen jedoch nicht. Untertitel lesen zu müssen empfand ich etwas störend, das hat man in vergleichbaren Filmen wie "Der Mann aus dem Eis" besser gelöst. Milchbrötchen Kodi Smit-McPhee müht sich redlich, ist aber trotzdem für mich eine Fehlbesetzung.
Technisch bewegt sich die Scheibe au sehr hohem Niveau. Besonders die Plastizität des Bildes ist beispielhaft; ohnehin sind alle Parameter im sattgrünen Bereich. Bildfehler waren au meiner Technik nicht erkennbar oder so marginal, dass sie nicht weiter ins Gewicht allen.
Der deutsche Track liegt in DTS HD MA 5.1 vor und stellt ebenfalls mehr als zufrieden. Zugegeben: an Bass hätte es etwas mehr sein dürfen, aber das lässt sich regeln. Die Dynamik passt, und besonders während des Wolfsgeheuls und während des Sturms ist die Surroundkulisse hervorragend. Für die Höchstwertung reicht es locker.
Die Extras hab ich wie meist nicht angesehen, ich vergebe die Mittelwertung. Die Scheibe hat kein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: ich hätte mir von der Thematik eigentlich mehr erwartet; allerdings hatte Regisseur Albert Hughes zusammen mit seinem Bruder auch schon „The Book of Eli“ verbrochen, der ebenfalls vor Logiklöchern nur so wimmelte. Daran stören sich andere vielleicht nicht, mir persönlich verhagelt sowas schon den Genuss. Davon abgesehen ist „Alpha“ leidlich unterhaltsam und für einen kurzweiligen Filmabend gerade so geeignet, wenn man gerade nichts anderes zur Hand hat. Neu kaufen muss man den Film nun wirklich nicht, und unbedingt gesehen haben zum Release muss man ihn auch nicht. 3 Balken vergebe ich wegen der tollen Visualisierung, verdient hat sie der Film eigentlich nicht.
mit 3
mit 5
mit 5
mit 3
bewertet am 20.01.19 um 13:44
Im Jahr 2006 urlaubt eine dreiköpfige englische Familie in Frankreich, als ihr Auto den Geist aufgibt. Die Reparatur soll mindestens einen Tag dauern, also quartieren die drei sich im einzigen Hotel des Örtchens ein. Die Mutter schläft, Vater und Sohn gehen ins nahe gelegenen Schwimmbad und dort passiert das von allen Eltern am meisten Gefürchtete: der kleine Sohn verschwindet im Gewühl einer kleinen Public Viewing-Veranstaltung. Eine groß angelegte Suche durch die Polizei und auch die Einschaltung der Medien führt zwar schnell zur Identifikation potentieller des Kindesmissbrauchs Verdächtiger, jedoch nicht zum Auffinden des Kindes. Das Kind bleibt 10 Jahre verschwunden, die Ehe der Eltern zerbricht und besonders der mittlerweile alkoholkranke und äußerst jähzornige Vater kommt über den Verlust und die Unklarheit des Schicksals seines Sohnes nicht hinweg: wie ein Getriebener sucht er selbst 10 Jahre nach den Geschehnissen weiterhin nach Spuren. Und er findet auch welche..
„The Missing“ befand sich bereits etwa 2 Jahre in meiner Sammlung, bevor ich sie um die Weihnachtszeit herum mal einlegte. Seinerzeit hatten mich die überaus positiven Kritiken zum Kauf bewogen, und nach der Sichtung lässt sich sagen, dass die Kritiken allesamt zu Recht so positiv ausfallen. Die BBC-Serie ist eine überaus gelungene Mischung aus Drama, Thriller und Suspense und springt dabei zudem noch geschickt zwischen zwei Zeitebenen (2006 und 2016) und manchmal auch dazwischen hin und her. „The Missing“ ist sehr spannend und gleichzeitig sehr dramatisch: überaus authentisch werden die Auswirkungen der Ungewissheit des Schicksals ihres kleinen Sohnes auf die Eltern transportiert, und besonders der leidende Vater wird beeindruckend dargestellt durch James Nesbitt (einer der Zwerge in „Der Hobbit“). Auch die Rolle der Medien, dargestellt durch Paparazzi und einen besonders skrupellosen Journalisten, wird hervor gehoben, die das Schicksal des Jungen und das Leid der Eltern nur zu ihrem eigenen Vorteil nutzen wollen. „The Missing“ versteht es geschickt, immer wieder falsche Fährten zu legen, Haken zu schlagen und den einen oder anderen verblüffenden Twist aus dem Hut zu zaubern, so dass man als mit den Beteiligten ermittelnder Zuschauer immer wieder von vorne anfängt.
Neben Nesbitt spielen noch einige Hochkaräter in „The Missing“ mit: außer Tchéky Karyo sind noch Frances O´Connor, Jason Flemyng und Saïd Taghmaoui mit an Bord.
Entgegen meiner üblichen Sehgewohnheiten wurde „The Missing“ statt auf 65 Zoll auf einem Fernseher mit 37 Zoll Diagonale gesehen. Auf dieser kleineren Mattscheibe zeigte sich das Bild scharf, ausgewogen kontrastiert und mit sattem Schwarzwert versehen, dabei zudem noch schön plastisch. Ich denke nicht, dass sich die Parameter auf einer größeren Diagonale verschlechtern, deshalb: Höchstwertung.
Der Sound wurde nur durch die TV-Lautsprecher übertragen, liegt auf der Scheibe aber in DTS HD MA 5.1 vor und sollte, wie von anderen BBC-Produktionen gewohnt, recht gut ausfallen. Ich vergebe zunächst mal 4 Balken, denn allzu viel Bass und Dynamik dürfte aufgrund der eher dialoglastigen Inszenierung nicht zu erwarten sein. Das Ergebnis wird nach einer Überprüfung auf der Heimkinoanlage eventuell angepasst.
Die Extras habe ich nicht angesehen, ich vergebe vorsichtige drei Balken. Die Laufzeit der Serie insgesamt ist nicht übermäßig lang: es liegen 8 Folgen mit je etwa 60 Minuten Laufzeit vor. Die Amaray verfügt über einen Hochglanz-Pappschuber.
Mein persönliches Fazit: mittlerweile bin ich schon seit einigen Jahren Serienfan, denn viele Serien wie „Game of Thrones“, „Vikings“, „Homeland“, „The Killing“ oder „Die Brücke“ sind hochkarätiges Genre-Kino im Langstreckenformat. Besonders Thrillerserien haben es mir angetan, und da ist „The Missing“ ziemlich weit vorne mit dabei. Ich würde „The Missing“ am Ehesten mit „The Killing“ vergleichen, die Serie kann ich jedem Thriller-Freund uneingeschränkt empfehlen. Die Staffel kostet zur Zeit nur 11€ bei Ama und ist ab und an auf eBay sogar noch deutlich günstiger zu schnappen.
„The Missing“ befand sich bereits etwa 2 Jahre in meiner Sammlung, bevor ich sie um die Weihnachtszeit herum mal einlegte. Seinerzeit hatten mich die überaus positiven Kritiken zum Kauf bewogen, und nach der Sichtung lässt sich sagen, dass die Kritiken allesamt zu Recht so positiv ausfallen. Die BBC-Serie ist eine überaus gelungene Mischung aus Drama, Thriller und Suspense und springt dabei zudem noch geschickt zwischen zwei Zeitebenen (2006 und 2016) und manchmal auch dazwischen hin und her. „The Missing“ ist sehr spannend und gleichzeitig sehr dramatisch: überaus authentisch werden die Auswirkungen der Ungewissheit des Schicksals ihres kleinen Sohnes auf die Eltern transportiert, und besonders der leidende Vater wird beeindruckend dargestellt durch James Nesbitt (einer der Zwerge in „Der Hobbit“). Auch die Rolle der Medien, dargestellt durch Paparazzi und einen besonders skrupellosen Journalisten, wird hervor gehoben, die das Schicksal des Jungen und das Leid der Eltern nur zu ihrem eigenen Vorteil nutzen wollen. „The Missing“ versteht es geschickt, immer wieder falsche Fährten zu legen, Haken zu schlagen und den einen oder anderen verblüffenden Twist aus dem Hut zu zaubern, so dass man als mit den Beteiligten ermittelnder Zuschauer immer wieder von vorne anfängt.
Neben Nesbitt spielen noch einige Hochkaräter in „The Missing“ mit: außer Tchéky Karyo sind noch Frances O´Connor, Jason Flemyng und Saïd Taghmaoui mit an Bord.
Entgegen meiner üblichen Sehgewohnheiten wurde „The Missing“ statt auf 65 Zoll auf einem Fernseher mit 37 Zoll Diagonale gesehen. Auf dieser kleineren Mattscheibe zeigte sich das Bild scharf, ausgewogen kontrastiert und mit sattem Schwarzwert versehen, dabei zudem noch schön plastisch. Ich denke nicht, dass sich die Parameter auf einer größeren Diagonale verschlechtern, deshalb: Höchstwertung.
Der Sound wurde nur durch die TV-Lautsprecher übertragen, liegt auf der Scheibe aber in DTS HD MA 5.1 vor und sollte, wie von anderen BBC-Produktionen gewohnt, recht gut ausfallen. Ich vergebe zunächst mal 4 Balken, denn allzu viel Bass und Dynamik dürfte aufgrund der eher dialoglastigen Inszenierung nicht zu erwarten sein. Das Ergebnis wird nach einer Überprüfung auf der Heimkinoanlage eventuell angepasst.
Die Extras habe ich nicht angesehen, ich vergebe vorsichtige drei Balken. Die Laufzeit der Serie insgesamt ist nicht übermäßig lang: es liegen 8 Folgen mit je etwa 60 Minuten Laufzeit vor. Die Amaray verfügt über einen Hochglanz-Pappschuber.
Mein persönliches Fazit: mittlerweile bin ich schon seit einigen Jahren Serienfan, denn viele Serien wie „Game of Thrones“, „Vikings“, „Homeland“, „The Killing“ oder „Die Brücke“ sind hochkarätiges Genre-Kino im Langstreckenformat. Besonders Thrillerserien haben es mir angetan, und da ist „The Missing“ ziemlich weit vorne mit dabei. Ich würde „The Missing“ am Ehesten mit „The Killing“ vergleichen, die Serie kann ich jedem Thriller-Freund uneingeschränkt empfehlen. Die Staffel kostet zur Zeit nur 11€ bei Ama und ist ab und an auf eBay sogar noch deutlich günstiger zu schnappen.
mit 5
mit 5
mit 4
mit 3
bewertet am 12.01.19 um 12:13
Wir erinnern uns: Saga Norén, die schwedische Ermittlerin mit Asperger, sitzt in einer geschlossenen Anstalt, da sie nach wie vor des Mordes an ihrer Mutter verdächtigt wird. Bald löst sich dieser Verdacht in Luft auf, und Saga kommt gerade zur rechten Zeit frei, denn ein grausamer Mord erschüttert Dänemark und Schweden gleichermaßen: unter der Öresundbrücke wird eine gesteinigte Frau aufgefunden, und diese Frau war Leiterin der dänischen Ausländerbehörde. Also beginnen Saga und ihr Kollege Henryk zunächst, im "Milieu" der Migranten, ihrem Umfeld und den bearbeitenden Behörden zu ermitteln, bis erneut ein Mord verübt wird. Dieses Mal wurde das Opfer mit einem Stromschlag getötet. Nun müssen Saga und Henryk wieder mal die Puzzleteilchen zusammen setzen und gleichzeitig um ihre Beziehung und gegen die Schatten in ihrer Vergangenheit kämpfen..
"Die Brücke" ist eine Ausnahmeserie aus dem hohen Norden, und ich habe die ersten drei Staffeln regelrecht verschlungen. Der besondere Reiz bei "Die Brücke" ist neben der perfekt-vertrackten Erzählweise von gleichzeitig verlaufenden, aber auch von zeitlich unterschiedlich anzusiedelnden Strängen besonders die außergewöhnliche Persönlichkeit von Saga Noren, kongenial verkörpert von Sofia Helin. Neben Helin versteht es meines Erachtens nur noch Claire Danes ("Homeland"), eine Person mit psychischer Beeinträchtigung derart überzeugend darzustellen.
Helins Charakter leidet am Asperger-Syndrom, einer Erscheinungsform von Autismus, die nicht selten mit einer Inselbegabung einher geht. Saga Noren ist zu Empathie und zu ihrer Wahrnehmung nicht fähig, was zu bemerkenswerten zwischenmenschlichen Interaktionen und Dialogen führt. Jedoch befähigt sie ihre nur auf Daten und Fakten reduzierte Wahrnehmung als Ermittlerin oftmals in außergewöhnlichem Maße.
Die Story ist ab Folge 1 spannend und steigert sich spannungstechnisch von Folge zu Folge bis zu einem durchaus blutig-brutalen Finale, dessen Auflösungen nur zum Teil vorhersehbar sind. Im Gegensatz zur dritten Staffel, in der einige Erzählstränge nicht beendet wurden und lediglich als Überleitung für das Finale fungierten wird hier die Geschichte zu Ende erzählt.
Da sich an Bild und Ton gegenüber den ersten beiden Staffeln nix geändert hat übernehme ich den Text meiner beiden Bewertungen und ändere geringfügig ab.
Das Bild fand ich trotz 1080i eigentlich gar nicht mal schlecht; da war das ebenfalls in 1080i vorliegende Bild der "Millenium-Trilogie" und hier besonders von "Verdammnis" deutlich schlechter. Wie in der ersten und auch der zweiten Staffel werden immer wieder Totale der Stadt bei Nacht gezeigt, die hervorragend scharf sind und die durch eigenwillige Farbgebung faszinieren, rauschen tut da auch nix. Die Tageslichtaufnahmen fand ich allesamt sehr scharf und gut kontrastiert. Die Farbgebung am Tag ist stark entsättigt, was der Atmosphäre außerordentlich zugute kommt.
Der Sound ist für die meist relativ actionarme Umsetzung hervorragend abgemischt. Der in DTS HD MA 5.1 vorliegende deutsche Track punktet mit einer tollen räumlichen Klangkulisse und während des Scores mit tiefreichendem und voluminösem Bass. Geräusche lassen sich gut orten und wirken allesamt höchst realistisch. Lediglich wie in den beiden Vorgängerstaffeln auch wirkt der Score etwas zu laut abgemischt.
Extras habe ich noch nicht angesehen, ich vergebe vorerst einen Mittelwert. Die Staffel kommt leider (wie die Vorgänger) ohne Schuber in einer schmucklosen Amaray mit Wendecover. Die Spieldauer der acht Episoden beträgt natürlich etwa 480 Minuten und nicht, wie oben unter den Specs angegeben, 66 Minuten.
Mein persönliches Fazit: so, nun isse leider ´rum, die Serie. "Die Brücke" verbleibt in der Sammlung und wird irgendwann sicher wieder im Player landen. Ganz großes Thriller-Kino im Sereinformat aus dem (nicht ganz so) hohen Norden und auf Augenhöhe mit der "Millenium"-Trilogie.
"Die Brücke" ist eine Ausnahmeserie aus dem hohen Norden, und ich habe die ersten drei Staffeln regelrecht verschlungen. Der besondere Reiz bei "Die Brücke" ist neben der perfekt-vertrackten Erzählweise von gleichzeitig verlaufenden, aber auch von zeitlich unterschiedlich anzusiedelnden Strängen besonders die außergewöhnliche Persönlichkeit von Saga Noren, kongenial verkörpert von Sofia Helin. Neben Helin versteht es meines Erachtens nur noch Claire Danes ("Homeland"), eine Person mit psychischer Beeinträchtigung derart überzeugend darzustellen.
Helins Charakter leidet am Asperger-Syndrom, einer Erscheinungsform von Autismus, die nicht selten mit einer Inselbegabung einher geht. Saga Noren ist zu Empathie und zu ihrer Wahrnehmung nicht fähig, was zu bemerkenswerten zwischenmenschlichen Interaktionen und Dialogen führt. Jedoch befähigt sie ihre nur auf Daten und Fakten reduzierte Wahrnehmung als Ermittlerin oftmals in außergewöhnlichem Maße.
Die Story ist ab Folge 1 spannend und steigert sich spannungstechnisch von Folge zu Folge bis zu einem durchaus blutig-brutalen Finale, dessen Auflösungen nur zum Teil vorhersehbar sind. Im Gegensatz zur dritten Staffel, in der einige Erzählstränge nicht beendet wurden und lediglich als Überleitung für das Finale fungierten wird hier die Geschichte zu Ende erzählt.
Da sich an Bild und Ton gegenüber den ersten beiden Staffeln nix geändert hat übernehme ich den Text meiner beiden Bewertungen und ändere geringfügig ab.
Das Bild fand ich trotz 1080i eigentlich gar nicht mal schlecht; da war das ebenfalls in 1080i vorliegende Bild der "Millenium-Trilogie" und hier besonders von "Verdammnis" deutlich schlechter. Wie in der ersten und auch der zweiten Staffel werden immer wieder Totale der Stadt bei Nacht gezeigt, die hervorragend scharf sind und die durch eigenwillige Farbgebung faszinieren, rauschen tut da auch nix. Die Tageslichtaufnahmen fand ich allesamt sehr scharf und gut kontrastiert. Die Farbgebung am Tag ist stark entsättigt, was der Atmosphäre außerordentlich zugute kommt.
Der Sound ist für die meist relativ actionarme Umsetzung hervorragend abgemischt. Der in DTS HD MA 5.1 vorliegende deutsche Track punktet mit einer tollen räumlichen Klangkulisse und während des Scores mit tiefreichendem und voluminösem Bass. Geräusche lassen sich gut orten und wirken allesamt höchst realistisch. Lediglich wie in den beiden Vorgängerstaffeln auch wirkt der Score etwas zu laut abgemischt.
Extras habe ich noch nicht angesehen, ich vergebe vorerst einen Mittelwert. Die Staffel kommt leider (wie die Vorgänger) ohne Schuber in einer schmucklosen Amaray mit Wendecover. Die Spieldauer der acht Episoden beträgt natürlich etwa 480 Minuten und nicht, wie oben unter den Specs angegeben, 66 Minuten.
Mein persönliches Fazit: so, nun isse leider ´rum, die Serie. "Die Brücke" verbleibt in der Sammlung und wird irgendwann sicher wieder im Player landen. Ganz großes Thriller-Kino im Sereinformat aus dem (nicht ganz so) hohen Norden und auf Augenhöhe mit der "Millenium"-Trilogie.
mit 5
mit 5
mit 5
mit 3
bewertet am 08.01.19 um 11:03
Joe, offensichtlich ein an einer postraumatischen Belastungsstörung leidender Kriegsveteran, lebt mit seiner demenzkranken Mutter zusammen und hat nach seiner Dienstzeit seine wahre Berufung gefunden: er befreit junge Mädchen aus den Fängen von Kinderschändern. Bei einem dieser Jobs befreit er auch die junge Nina: ihr Vater, ein hochrangiger Politiker, kann sich nicht an die Polizei wenden, da er mitten im Wahlkampf steckt. Doch kaum befreit, wird Nina sofort wieder „entführt“, und so macht sich Joe ein letztes Mal auf..
„A Beautiful Day“ ist ein Film, der sehr deutlich von anderen Genrevertretern (hier wären allen voran „Taxi Driver“ und vielleicht noch „Léon – Der Profi“zu nennen) inspiriert ist. Im Gegensatz zu den genannten ist bei „A Beautiful Day“ die tragische Figur weder Psychopath noch eiskalter Auftragsmörder, sondern selbst gewissermaßen Opfer: der durch und durch ehrbare, aber gebrochene, an seinen Kriegserlebnissen leidende Einzelgänger kümmert sich rührend um seine Mutter, kasteit sich selbst und verschafft seiner Seele Linderung, indem er Kinderschänder mit dem Hammer erschlägt.
Dies zeigt Regisseurin Lynne Ramsey in reduzierter Bildsprache, die oftmals nur mit Bildfragmenten aufwartet und so der Fantasie des Zuschauers viel Spielraum lässt. Joaquin Phoenix trägt den Film spielend mit absoluter Präsenz, ohne viele Worte, Gestik oder Mimik und eben dadurch umso eindrucksvoller.
Am Bild lässt sich kaum etwas aussetzen. Alle Parameter bewegen sich im sattgrünen Bereich; lediglich die Plastizität könnte höher sein.
Die Blu-ray verfügt über eine erstaunlich luftige und räumliche Tonspur, die besonders während des Scores beeindruckt. Die Gewaltspitzen sind rar, hier jedoch punktet der Track dann aber auch mit Dynamik und Bass.
Extras: nicht angesehen, ich vergebe den Wert des Reviews. Die Scheibe hat ein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: Neben den genannten „Léon – Der Profi“ und „Taxi Driver“ hat mich „A Beautiful Day“ irgendwie an „The Equalizer“ in Dramaform erinnert. Joaquin Phoenix´ Charakter nimmt wie Denzel Washingtons aus moralischen Gründen die Justiz in die eigenen Hände, jedoch nicht aus Ohnmacht ob der Untätigkeit des Gesetzes, sondern zur Linderung für seine gequälte Seele. Und wo „The Equalizer“ ein reiner Action-Thriller ist, ist „A Beautiful Day“ ein bestürzendes, hoch emotionales Drama.
„A Beautiful Day“ ist bisweilen wie ein Schlag in die Magengrube und definitiv ein Kino-Kleinod dieses Jahres.
„A Beautiful Day“ ist ein Film, der sehr deutlich von anderen Genrevertretern (hier wären allen voran „Taxi Driver“ und vielleicht noch „Léon – Der Profi“zu nennen) inspiriert ist. Im Gegensatz zu den genannten ist bei „A Beautiful Day“ die tragische Figur weder Psychopath noch eiskalter Auftragsmörder, sondern selbst gewissermaßen Opfer: der durch und durch ehrbare, aber gebrochene, an seinen Kriegserlebnissen leidende Einzelgänger kümmert sich rührend um seine Mutter, kasteit sich selbst und verschafft seiner Seele Linderung, indem er Kinderschänder mit dem Hammer erschlägt.
Dies zeigt Regisseurin Lynne Ramsey in reduzierter Bildsprache, die oftmals nur mit Bildfragmenten aufwartet und so der Fantasie des Zuschauers viel Spielraum lässt. Joaquin Phoenix trägt den Film spielend mit absoluter Präsenz, ohne viele Worte, Gestik oder Mimik und eben dadurch umso eindrucksvoller.
Am Bild lässt sich kaum etwas aussetzen. Alle Parameter bewegen sich im sattgrünen Bereich; lediglich die Plastizität könnte höher sein.
Die Blu-ray verfügt über eine erstaunlich luftige und räumliche Tonspur, die besonders während des Scores beeindruckt. Die Gewaltspitzen sind rar, hier jedoch punktet der Track dann aber auch mit Dynamik und Bass.
Extras: nicht angesehen, ich vergebe den Wert des Reviews. Die Scheibe hat ein Wendecover.
Mein persönliches Fazit: Neben den genannten „Léon – Der Profi“ und „Taxi Driver“ hat mich „A Beautiful Day“ irgendwie an „The Equalizer“ in Dramaform erinnert. Joaquin Phoenix´ Charakter nimmt wie Denzel Washingtons aus moralischen Gründen die Justiz in die eigenen Hände, jedoch nicht aus Ohnmacht ob der Untätigkeit des Gesetzes, sondern zur Linderung für seine gequälte Seele. Und wo „The Equalizer“ ein reiner Action-Thriller ist, ist „A Beautiful Day“ ein bestürzendes, hoch emotionales Drama.
„A Beautiful Day“ ist bisweilen wie ein Schlag in die Magengrube und definitiv ein Kino-Kleinod dieses Jahres.
mit 5
mit 5
mit 5
mit 2
bewertet am 27.12.18 um 10:27
Wir erinnern uns: Carrie Mathison war zuletzt Beraterin der US-Präsidentin Keane, als auf diese ein Attentat verübt wurde. Verantwortlich dafür: die Geheimdienste, denen die neu gewählte Präsidentin Zügel anlegen wollte. Daraufhin wurden 200 Personen willkürlich verhaftet, denen die Mittäterschaft oder wenigstens die stillschweigende Duldung unterstellt wurde. Unter diesen befindet sich der General McClendon, der am Tag seiner endgültigen Inhaftierung zu Tode kommt, ausgerechnet nachdem die Präsidentin die Todesstrafe für ihn fordert. Für ihre Gegner, allen voran dem populistischen „Journalisten“ Brad O´Keefe, ist klar: McClendon wurde im Auftrag der Präsidentin ermordet. Dadurch bewegt sich Keane in der öffentlichen Meinung geradewegs auf die Art der autokratischen Regierungsführung zu, die ihr ihre Gegner, ebenfalls allen voran O´Keefe, vorwerfen.
O´Keefe, immer noch auf der Flucht, wird bald von Saul Berenson gestellt, und ab dann wird bald klar: irgendeine Macht manipuliert hier die Politik und mit ihr die Politiker bis in höchste Ebenen, die Medien und damit die gesamten USA..
Die siebte Staffel von „Homeland“ schließt direkt und nahtlos an die sechste an und spielt erneut auf amerikanischem Boden. Dieses Mal wird, wie oben angedeutet, die USA in ihrer Gesamtheit von einer fremden Macht durch Fake News in Social Media, Schläfer und Spezialagenten für Infiltration bis zum drohenden Sturz der Regierung manipuliert. Wieder muss die bipolare Carrie zusammen mit Saul Berenson die Nation retten und dabei ihre immer schwierigere familiäre Situation bewältigen.
Neben besagten Fake News und den sozialen Netzwerken werden dieses Mal die nach wie vor existenten Machenschaften der ausländischen Geheimdienste in den USA thematisiert. Die Themenauswahl macht „Homeland“ wie schon wie in den früheren Staffeln zu einer Art Serien-Glaskugel: jeder, der ab und an Nachrichten liest weiß, dass nach wie vor die Rolle Russlands in Donald Trumps Wahlkampf und seiner Amtszeit nicht restlos geklärt ist. Parallel dazu hat die Hauptfigur Carrie Mathison gegen die stärker werdenden Symptome ihrer Krankheit, aber auch mit ihren familiären Probleme zu kämpfen. Dabei werden auch schmutzige Tricks von Carrie und den amerikanischen Geheimdiensten nicht ausgespart. Claire Danes schauspielert auf gewohnt höchstem Niveau, und man nimmt ihr besonders jede Sekunde ab, wenn die Symptome ihrer Erkrankung erscheinen.
Mit der 7. Staffel ist „Homeland“ noch einmal zur Höchstform aufgelaufen: die Season ist ähnlich spannend wie die erste, und man ist versucht, die Staffel an einem Stück zu verschlingen.
Bild und Ton der 7. Staffel sind qualitativ identisch mit der 6., deshalb übernehme ich meinen Text.
Das Bild von Staffel 7 ist tadellos. Die Schärfe ist außerordentlich, daraus resultiert mit dem gut gewählten Kontrast ein hoher Detailreichtum auch in dunklen Szenen. Der Schwarzwert könnte ausgewogener sein, das allerdings ist Meckern auf höchstem Niveau.
Der Sound tritt erst in den Vordergrund, wenn er gefordert wird. Der DTS-Track ist für "Homeland" völlig ausreichend, denn in dieser Thriller-Serie dominieren Dialoge. Wenn es allerdings actionmäßig zur Sache geht, dann tut der Sound sein Übriges: bei den wenigen Explosionen grummelt der Bass ordentlich, und die Feuergefechte werden hochdynamisch ins Wohnzimmer transportiert.
Extras habe ich (noch) nicht angesehen, ich vergebe einen Mittelwert. Wie gewohnt kommt auch diese Staffel im schicken DigiPak mit Pappschuber, perfekt passend zu den Veröffentlichung der Vorgängerstaffeln.
Mein persönliches Fazit: seit der 1. Staffel bin ich an von „Homeland“, und meine Faszination ist ungebrochen. Mit der 3. Season hatte die Serie seinerzeit einen minimalen Durchhänger, alle anderen Staffeln sind allererste Serien-Sahne. „Homeland“ muss man als Thriller-Fan gesehen haben.
O´Keefe, immer noch auf der Flucht, wird bald von Saul Berenson gestellt, und ab dann wird bald klar: irgendeine Macht manipuliert hier die Politik und mit ihr die Politiker bis in höchste Ebenen, die Medien und damit die gesamten USA..
Die siebte Staffel von „Homeland“ schließt direkt und nahtlos an die sechste an und spielt erneut auf amerikanischem Boden. Dieses Mal wird, wie oben angedeutet, die USA in ihrer Gesamtheit von einer fremden Macht durch Fake News in Social Media, Schläfer und Spezialagenten für Infiltration bis zum drohenden Sturz der Regierung manipuliert. Wieder muss die bipolare Carrie zusammen mit Saul Berenson die Nation retten und dabei ihre immer schwierigere familiäre Situation bewältigen.
Neben besagten Fake News und den sozialen Netzwerken werden dieses Mal die nach wie vor existenten Machenschaften der ausländischen Geheimdienste in den USA thematisiert. Die Themenauswahl macht „Homeland“ wie schon wie in den früheren Staffeln zu einer Art Serien-Glaskugel: jeder, der ab und an Nachrichten liest weiß, dass nach wie vor die Rolle Russlands in Donald Trumps Wahlkampf und seiner Amtszeit nicht restlos geklärt ist. Parallel dazu hat die Hauptfigur Carrie Mathison gegen die stärker werdenden Symptome ihrer Krankheit, aber auch mit ihren familiären Probleme zu kämpfen. Dabei werden auch schmutzige Tricks von Carrie und den amerikanischen Geheimdiensten nicht ausgespart. Claire Danes schauspielert auf gewohnt höchstem Niveau, und man nimmt ihr besonders jede Sekunde ab, wenn die Symptome ihrer Erkrankung erscheinen.
Mit der 7. Staffel ist „Homeland“ noch einmal zur Höchstform aufgelaufen: die Season ist ähnlich spannend wie die erste, und man ist versucht, die Staffel an einem Stück zu verschlingen.
Bild und Ton der 7. Staffel sind qualitativ identisch mit der 6., deshalb übernehme ich meinen Text.
Das Bild von Staffel 7 ist tadellos. Die Schärfe ist außerordentlich, daraus resultiert mit dem gut gewählten Kontrast ein hoher Detailreichtum auch in dunklen Szenen. Der Schwarzwert könnte ausgewogener sein, das allerdings ist Meckern auf höchstem Niveau.
Der Sound tritt erst in den Vordergrund, wenn er gefordert wird. Der DTS-Track ist für "Homeland" völlig ausreichend, denn in dieser Thriller-Serie dominieren Dialoge. Wenn es allerdings actionmäßig zur Sache geht, dann tut der Sound sein Übriges: bei den wenigen Explosionen grummelt der Bass ordentlich, und die Feuergefechte werden hochdynamisch ins Wohnzimmer transportiert.
Extras habe ich (noch) nicht angesehen, ich vergebe einen Mittelwert. Wie gewohnt kommt auch diese Staffel im schicken DigiPak mit Pappschuber, perfekt passend zu den Veröffentlichung der Vorgängerstaffeln.
Mein persönliches Fazit: seit der 1. Staffel bin ich an von „Homeland“, und meine Faszination ist ungebrochen. Mit der 3. Season hatte die Serie seinerzeit einen minimalen Durchhänger, alle anderen Staffeln sind allererste Serien-Sahne. „Homeland“ muss man als Thriller-Fan gesehen haben.
mit 5
mit 5
mit 5
mit 3
bewertet am 25.12.18 um 10:43
Robert McCall, in einem früheren Leben CIA-Attentäter, hat vor einigen Jahren seine Berufung gefunden: nachdem er die brutalen Luden einer blutjungen Hure „diszipliniert“ hat, fungiert er nun wie weiland Robin Hood als Rächer der Enterbten und Beschützer von Witwen und Waisen seines Viertels. Er fährt als eine Art Taxifahrer Holocaust-Überlebende durch die Gegend, integriert seine muslimische Nachbarin und „diszipliniert“ schon mal ein paar reiche Kids, die ein „Nein“ einer jungen Frau nicht akzeptiert haben. Als eine Freundin aus besagtem früheren Leben vermeintlich bei einem Hotel-Raubüberfall getötet wird, fängt McCall an zu bohren und findet schnell heraus, dass da mehr dahinter steckt..
„The Equalizer“ war 2014 ein Publikums- und Kassenerfolg, und das erste Mal überhaupt hat Denzel Washington mit „The Equalizer 2“ eine Fortsetzung eines seiner Hits gedreht. Wieder hat Antoine Fuqua die Regie übernommen und damit bereits zum 4. Mal mit Washington zusammen gearbeitet.
Hat bereits der Erstling mit einer fragwürdigen Selbstjustiz-Message aufgewartet, dürfte auch „The Equalizer 2“ vor allem Menschen ähnlichen Schlages derer, die nach dem Tod des Deutschen in Chemnitz Jagd auf Ausländer machten, zum Applaudieren bringen.
Damit einhergehend wird dem skrupellosen und brutalen ehemaligen Auftragsmörder der Regierung ärgerlicherweise fast ein Heiligenschein verliehen, wenn er einen Studenten davon abhält, in die Gang-Szene abzurutschen.
Es waren die Actionszenen, die „The Equalizer“ zu etwas besonderem machten: McCall ging unmittelbar vor den Kämpfen den Ablauf des Fights vor seinem geistigen Auge durch, nutzte dabei alles, was sich in Reichweite befand und stoppte die Zeit. In „Equalizer 2“ blieb davon nur noch die Stoppuhr übrig, so dass man manchmal unwillkürlich die Stirn runzelt.
Davon unbenommen ist auch „The Equalizer 2“ ein guter Action-Thriller geworden, der aber durchaus die eine oder Länge im Mittelteil aufweist. Die maßgebliche Würze fehlt wie angesprochen, und ebenso fehlt, dass McCall seinen Opfern verbal vor Augen führt, woran sie gerade unschön ableben. Ein schauspielerisches Highlight wie etwa die Konversation zwischen Washington und Marton Czokas aus dem Erstling fehlt schmerzlich.
Das Bild der BD ist sehr gut. Der Film spielt oft nachts oder eben im Sauwetter des Finales; dafür ist das Bild an sich hervorragend. Besonders bei Szenen wie im Versteck hinter dem Bücherregal zeigt sich jedes Detail trotz des schummrigen Lichtes. Die Tageslichtsszenen sind allesamt scharf, perfekt kontrastiert und plastisch. Bei Nacht wartet der Transfer mit einem satten Schwarzwert und ausgewogenem Kontrast auf, und so bleiben die Details erhalten.
So richtig lässt der Track die Muskeln erst im etwa 20 Minuten langen Finale im Orkan spielen. Der Wind bläst ordentlich um den Zuschauer herum, die Schüsse peitschen recht dynamisch durchs Wohnzimmer, und Abschüsse wie Einschläge sind recht genau ortbar. Vor dem Finale ist der Sound zwar recht ordentlich, aber nichts besonderes.
Die Extras liegen auf einer gesonderten Disc vor. Wie üblich habe ich die Extras nicht angesehen; ich vergebe daher einen Durchschnittswert.
Das Steel ist mit einem Popart- Motiv versehen, das sicherlich nicht jedermann gefällt.
Mein persönliches Fazit: Wie schon der Erstling ist auch „The Equalizer 2“ ein Selbstjustiz-Thriller, dessen Message durchaus falsch verstanden werden kann. Davon distanziert betrachtet ist der Film ein recht guter Actioner, der allerdings die Güte des Vorgängers nicht erreicht und dem als Nachfolger die wesentlichen Erkennungsmerkmale erstaunlicherweise abgehen. 4 Punkte gibt es nur wegen Washingtons Performance.
„The Equalizer“ war 2014 ein Publikums- und Kassenerfolg, und das erste Mal überhaupt hat Denzel Washington mit „The Equalizer 2“ eine Fortsetzung eines seiner Hits gedreht. Wieder hat Antoine Fuqua die Regie übernommen und damit bereits zum 4. Mal mit Washington zusammen gearbeitet.
Hat bereits der Erstling mit einer fragwürdigen Selbstjustiz-Message aufgewartet, dürfte auch „The Equalizer 2“ vor allem Menschen ähnlichen Schlages derer, die nach dem Tod des Deutschen in Chemnitz Jagd auf Ausländer machten, zum Applaudieren bringen.
Damit einhergehend wird dem skrupellosen und brutalen ehemaligen Auftragsmörder der Regierung ärgerlicherweise fast ein Heiligenschein verliehen, wenn er einen Studenten davon abhält, in die Gang-Szene abzurutschen.
Es waren die Actionszenen, die „The Equalizer“ zu etwas besonderem machten: McCall ging unmittelbar vor den Kämpfen den Ablauf des Fights vor seinem geistigen Auge durch, nutzte dabei alles, was sich in Reichweite befand und stoppte die Zeit. In „Equalizer 2“ blieb davon nur noch die Stoppuhr übrig, so dass man manchmal unwillkürlich die Stirn runzelt.
Davon unbenommen ist auch „The Equalizer 2“ ein guter Action-Thriller geworden, der aber durchaus die eine oder Länge im Mittelteil aufweist. Die maßgebliche Würze fehlt wie angesprochen, und ebenso fehlt, dass McCall seinen Opfern verbal vor Augen führt, woran sie gerade unschön ableben. Ein schauspielerisches Highlight wie etwa die Konversation zwischen Washington und Marton Czokas aus dem Erstling fehlt schmerzlich.
Das Bild der BD ist sehr gut. Der Film spielt oft nachts oder eben im Sauwetter des Finales; dafür ist das Bild an sich hervorragend. Besonders bei Szenen wie im Versteck hinter dem Bücherregal zeigt sich jedes Detail trotz des schummrigen Lichtes. Die Tageslichtsszenen sind allesamt scharf, perfekt kontrastiert und plastisch. Bei Nacht wartet der Transfer mit einem satten Schwarzwert und ausgewogenem Kontrast auf, und so bleiben die Details erhalten.
So richtig lässt der Track die Muskeln erst im etwa 20 Minuten langen Finale im Orkan spielen. Der Wind bläst ordentlich um den Zuschauer herum, die Schüsse peitschen recht dynamisch durchs Wohnzimmer, und Abschüsse wie Einschläge sind recht genau ortbar. Vor dem Finale ist der Sound zwar recht ordentlich, aber nichts besonderes.
Die Extras liegen auf einer gesonderten Disc vor. Wie üblich habe ich die Extras nicht angesehen; ich vergebe daher einen Durchschnittswert.
Das Steel ist mit einem Popart- Motiv versehen, das sicherlich nicht jedermann gefällt.
Mein persönliches Fazit: Wie schon der Erstling ist auch „The Equalizer 2“ ein Selbstjustiz-Thriller, dessen Message durchaus falsch verstanden werden kann. Davon distanziert betrachtet ist der Film ein recht guter Actioner, der allerdings die Güte des Vorgängers nicht erreicht und dem als Nachfolger die wesentlichen Erkennungsmerkmale erstaunlicherweise abgehen. 4 Punkte gibt es nur wegen Washingtons Performance.
mit 4
mit 5
mit 5
mit 3
bewertet am 23.12.18 um 16:15
Top Angebote
plo
GEPRÜFTES MITGLIED
FSK 18
Aktivität
Forenbeiträge361
Kommentare1.064
Blogbeiträge0
Clubposts0
Bewertungen1.489
Mein Avatar
Weitere Funktionen
Weitere Listen
Beste Bewertungen
plo hat die folgenden 4 Blu-rays am besten bewertet:
Letzte Bewertungen
22.04.24 The Killer - Someone Deserves to Die
28.05.23 Pakt der Wölfe (4K Remastered)
27.04.23 Operation Fortune
25.04.23 Ticket ins Paradies (2022)
02.04.23 Im Westen nichts Neues (2022) 4K (Limited Collector's Mediabook Edition) (4K UHD + Blu-ray)
30.03.23 Daylight (1996)
14.03.23 Die Spur der Knochen
11.03.23 The Black Phone (2021)
Filme suchen nach
Mit dem Blu-ray Filmfinder können Sie Blu-rays nach vielen unterschiedlichen Kriterien suchen.
Die Filmbewertungen von plo wurde 586x besucht.