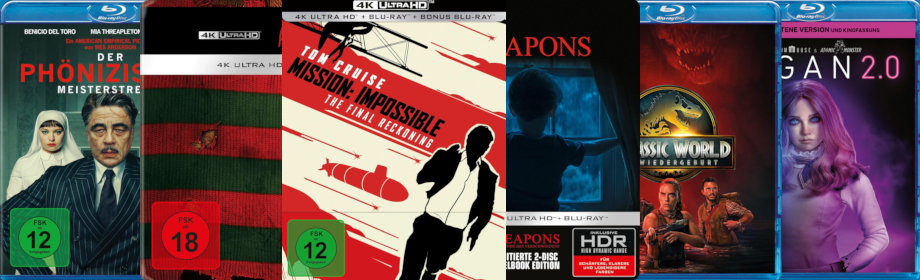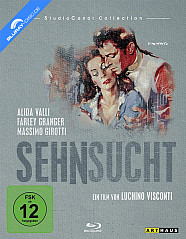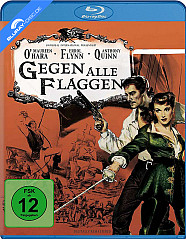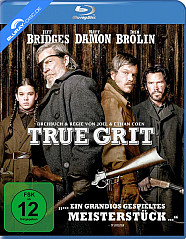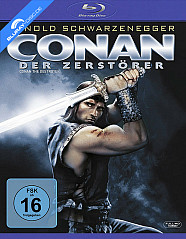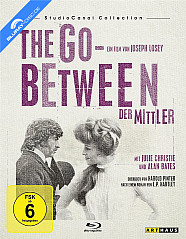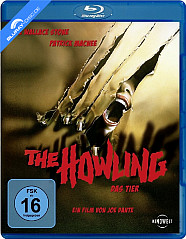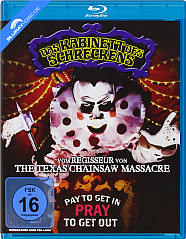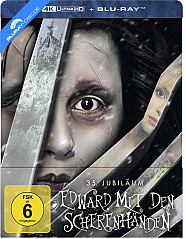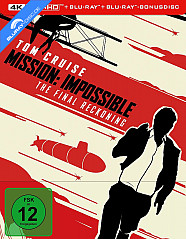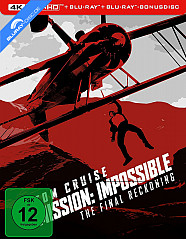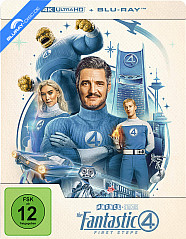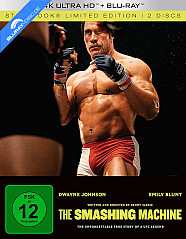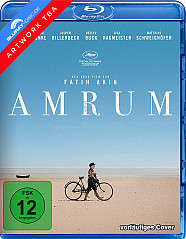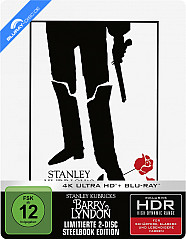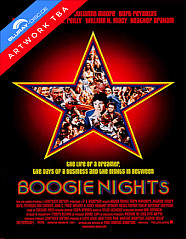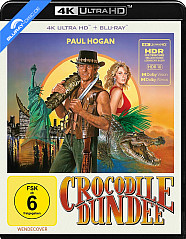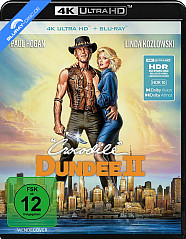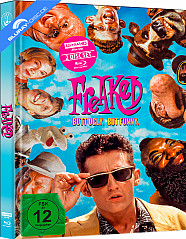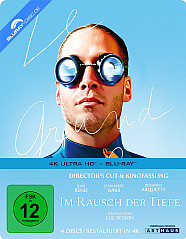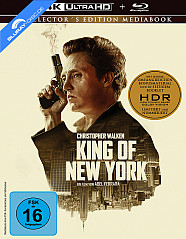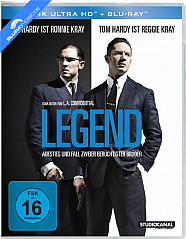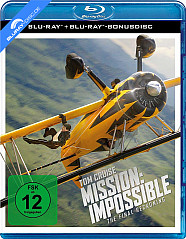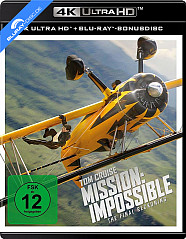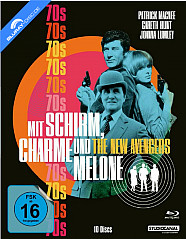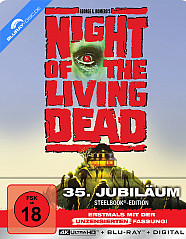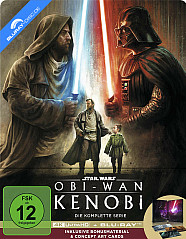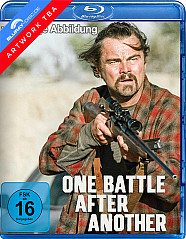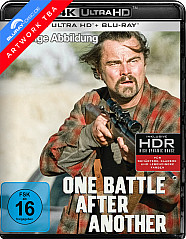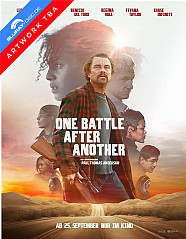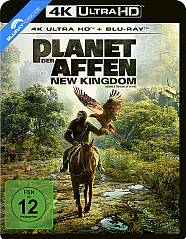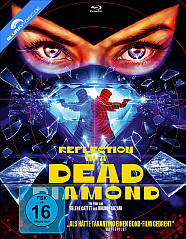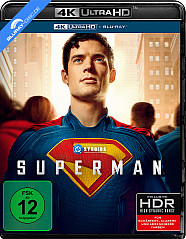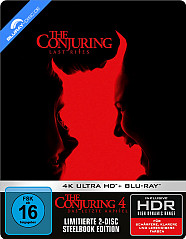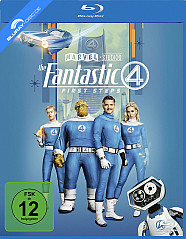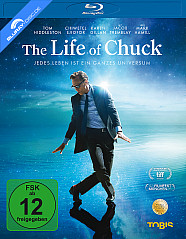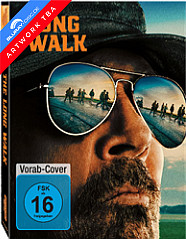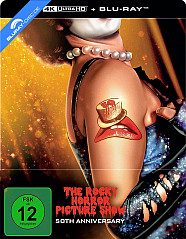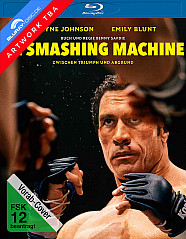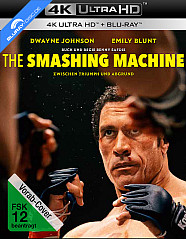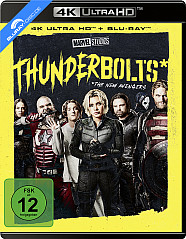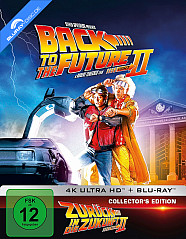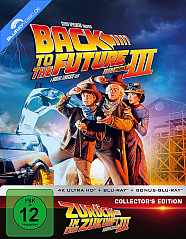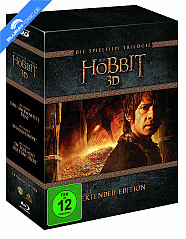USA: Filme auf Blu-ray und Ultra HD Blu-ray im Januar 2026 von Criterion CollectionAstro Records: "Future Force" + "Future Zone" auf Blu-ray in Mediabooks und mehr im Dezember 2025Ab 2026: Leonine Studios übernimmt den physischen Vertrieb von Paramount Home EntertainmentNeue 4K-Multibuy-Aktion bei Amazon.de mit "3 Ultra HD Blu-rays für 2"
NEWSTICKER
Filmbewertungen von kleinhirn
Visconti's opernhaft inszeniertes Widerstands- und Liebesdrama besticht vor allem durch seine oppulente Ausstattung und atmosphärisch kulissenhafte Bildsprache, die unter anderem vom Kameramann Robert Krasner (Der dritte Mann) mitkomponiert wurden.
In der aufgeladenen Stimmung Veneziens im Jahre 1866, Venedig ist von den Österreichern besetzt, lernt die unglücklich mit einem verknöcherten altem Grafen verheiratete Gräfin Livia Serpieri, den jungen österreichischen Leutnant und Frauenheld Franz Mahler kennen. Sie fühlt sich unmittelbar vom schneidigen, zuvorkommenden jungen Gentleman angezogen und stürzt sich mit ihm in eine kurze aber leidenschaftliche Affäre.
Als der Leutnant aber von einem Tag auf den anderen nicht mehr zum tete a tete erscheint, scheinbar weil sein Spieltrieb befriedigt ist, und die Grafenfamilie auf das Landgut der Serpieris übersiedelt um die Widerstandsgefechte schadlos zu überstehen, ist das Unglück der Gräfin Livia grenzenlos.
Doch als eines Nachts Franz unvermittelt auf dem Balkon des Landgutes der Gräfin auftaucht und er ihr reuig seine Besessenheit gesteht, flammt ihre alte Leidenschaft wieder aus und man schmiedet einen schicksalshaften Plan: Franz muß sich vom Wehrarzt dienstuntauglich schreiben lassen um die Widerstandkämpfe unbeschadet zu überdauern. Das Geld für die Bestechung des Arztes soll aus der Kasse der Widerstandskämpfer genommen werden, die der Cousin Livias ihr zur treuhänderischen Verwaltung überantwortet hat, als dieser nach einem wortgefecht mit Franz Mahler aus Venedig in die Verbannung geschickt wurde.
So schlittern alle Protagonisten einem Schicksal entgegen, das tragischer nicht sein könnte und durchaus Dimensionen der Shakespearischen Dramen erreicht...
Visconti wurde immer wieder vorgeworfen, mit Sehnsucht die Ideale des filmischen Neorealismus verraten zu haben, der er bei seinen drei vorangegangenen Werken verhaftet war. Bei genauerer Betrachtung ist die aber völlig unsinnig. Realismus macht vor allem dann Sinn, wenn der Inhalt der Geschichte sich auf reale Lebensdimensionen bezieht. Visconti deutet aber schon am Anfang des Films an, er beginnt in einer Oper, daß er sich der überzeichneten und übertiebenen Darstellungsweise verschreibt.
So folgt denn auch die Form dem Inhalt und verweist mit seinen märchenhaften Kulissen und stets adrett gestriegelten und glänzenden Uniformen auf eine Ästhetik, die der Alltagsrealität übergeordnet ist.
Das Sehnsucht aber nicht zum Kostümball in historischen Kulissen verkommt, liegt in dem durchaus spannenden Ablauf der Geschichte, der mit vielen Wendungen und Überraschungen zu unterhalten vermag und durch die im Hintergrund schwellende kriegerische Auseinandersetzung noch zusätzlich aufgeheizt wird.
Somit liefert Sehnsucht eigentlich alle Voraussetzungen, die vonnöten sind, um sich tief in den Film hineinsaugen zu lassen. Das dies aber nur bedingt gelingt, ist einerseits wohl der mißlungenen Synchronisation der österreichischen Soldaten zu verdanken, die mit ihrem Wiener Schmäh sehr kraftlos und unmotiviert erscheint und andererseits der Rolle des Leutnant Franz Mahler. Dieser wird von Farley Granger gespielt, der die Rolle erhielt, nachdem er zuvor in zwei Hitchcockfilmen aufgetreten war.
Granger nimmt man zu keiner Zeit den Herzensbrecher und Casanova ab, der mit dem Esprit gesegnet ist, die Herzen der Frauen im Sturm zu erobern. Ganz im Gegenteil, gehört er Sorte zur männlicher Dutzendware, die zu Hauf die Offizierkasinos bevölkern.
Auch schauspielerisch kann er nicht den nötigen Verve aufbringen, um beim Zuschauer ein gesteigertes Interesse zu erzeugen.
All dies ist umso bedauerlicher da man der Gräfin Livia die Rolle der Gräfin blind abnimmt. Da die Schauspielerin selbst der Sproß einer österrichisch-italienischen Adelsfamilie ist, somit das aristokratische Verhalten mit der Muttermilch aufgesogen und sich zudem als attraktive Actresse ausgezeichnet hat, die das emotionale Spektrum mit Glaubwürdigkeit innerhalb von Sekunden wechseln kann, wäre ein glaubwürdiger Gegenpart in Form eines gestandenen Mannsbildes mehr als nur wünschenswert.
Umso schmerzlicher ist die Tatsache, daß für die Rolle des Franz Mahler ursprünglich Marlon Brando vorgesehen war, den man aber 1954, ein Jahr vor seinem Oscar für Die Faust im Nacken, als fallenden Stern betrachtete.
Welches zeitloses Meisterwerk hier also durch ein paar wenige handwerkliche Fehler verhindert wurde und mit ein paar leinen Änderungen hätte geschaffen werden können, bleibt so für immer der Phantasie der enntäuschten Cineastengemeinde überlassen...
Das Bild trumpft mit satten Farben in prächtigen Technicolorfarben auf und besticht durch eine von Filmkorn befreite traumartige Bilsprache, durch die die oft mangelnde Bildschärfe in den Hintergrund gerückt wird.
In der aufgeladenen Stimmung Veneziens im Jahre 1866, Venedig ist von den Österreichern besetzt, lernt die unglücklich mit einem verknöcherten altem Grafen verheiratete Gräfin Livia Serpieri, den jungen österreichischen Leutnant und Frauenheld Franz Mahler kennen. Sie fühlt sich unmittelbar vom schneidigen, zuvorkommenden jungen Gentleman angezogen und stürzt sich mit ihm in eine kurze aber leidenschaftliche Affäre.
Als der Leutnant aber von einem Tag auf den anderen nicht mehr zum tete a tete erscheint, scheinbar weil sein Spieltrieb befriedigt ist, und die Grafenfamilie auf das Landgut der Serpieris übersiedelt um die Widerstandsgefechte schadlos zu überstehen, ist das Unglück der Gräfin Livia grenzenlos.
Doch als eines Nachts Franz unvermittelt auf dem Balkon des Landgutes der Gräfin auftaucht und er ihr reuig seine Besessenheit gesteht, flammt ihre alte Leidenschaft wieder aus und man schmiedet einen schicksalshaften Plan: Franz muß sich vom Wehrarzt dienstuntauglich schreiben lassen um die Widerstandkämpfe unbeschadet zu überdauern. Das Geld für die Bestechung des Arztes soll aus der Kasse der Widerstandskämpfer genommen werden, die der Cousin Livias ihr zur treuhänderischen Verwaltung überantwortet hat, als dieser nach einem wortgefecht mit Franz Mahler aus Venedig in die Verbannung geschickt wurde.
So schlittern alle Protagonisten einem Schicksal entgegen, das tragischer nicht sein könnte und durchaus Dimensionen der Shakespearischen Dramen erreicht...
Visconti wurde immer wieder vorgeworfen, mit Sehnsucht die Ideale des filmischen Neorealismus verraten zu haben, der er bei seinen drei vorangegangenen Werken verhaftet war. Bei genauerer Betrachtung ist die aber völlig unsinnig. Realismus macht vor allem dann Sinn, wenn der Inhalt der Geschichte sich auf reale Lebensdimensionen bezieht. Visconti deutet aber schon am Anfang des Films an, er beginnt in einer Oper, daß er sich der überzeichneten und übertiebenen Darstellungsweise verschreibt.
So folgt denn auch die Form dem Inhalt und verweist mit seinen märchenhaften Kulissen und stets adrett gestriegelten und glänzenden Uniformen auf eine Ästhetik, die der Alltagsrealität übergeordnet ist.
Das Sehnsucht aber nicht zum Kostümball in historischen Kulissen verkommt, liegt in dem durchaus spannenden Ablauf der Geschichte, der mit vielen Wendungen und Überraschungen zu unterhalten vermag und durch die im Hintergrund schwellende kriegerische Auseinandersetzung noch zusätzlich aufgeheizt wird.
Somit liefert Sehnsucht eigentlich alle Voraussetzungen, die vonnöten sind, um sich tief in den Film hineinsaugen zu lassen. Das dies aber nur bedingt gelingt, ist einerseits wohl der mißlungenen Synchronisation der österreichischen Soldaten zu verdanken, die mit ihrem Wiener Schmäh sehr kraftlos und unmotiviert erscheint und andererseits der Rolle des Leutnant Franz Mahler. Dieser wird von Farley Granger gespielt, der die Rolle erhielt, nachdem er zuvor in zwei Hitchcockfilmen aufgetreten war.
Granger nimmt man zu keiner Zeit den Herzensbrecher und Casanova ab, der mit dem Esprit gesegnet ist, die Herzen der Frauen im Sturm zu erobern. Ganz im Gegenteil, gehört er Sorte zur männlicher Dutzendware, die zu Hauf die Offizierkasinos bevölkern.
Auch schauspielerisch kann er nicht den nötigen Verve aufbringen, um beim Zuschauer ein gesteigertes Interesse zu erzeugen.
All dies ist umso bedauerlicher da man der Gräfin Livia die Rolle der Gräfin blind abnimmt. Da die Schauspielerin selbst der Sproß einer österrichisch-italienischen Adelsfamilie ist, somit das aristokratische Verhalten mit der Muttermilch aufgesogen und sich zudem als attraktive Actresse ausgezeichnet hat, die das emotionale Spektrum mit Glaubwürdigkeit innerhalb von Sekunden wechseln kann, wäre ein glaubwürdiger Gegenpart in Form eines gestandenen Mannsbildes mehr als nur wünschenswert.
Umso schmerzlicher ist die Tatsache, daß für die Rolle des Franz Mahler ursprünglich Marlon Brando vorgesehen war, den man aber 1954, ein Jahr vor seinem Oscar für Die Faust im Nacken, als fallenden Stern betrachtete.
Welches zeitloses Meisterwerk hier also durch ein paar wenige handwerkliche Fehler verhindert wurde und mit ein paar leinen Änderungen hätte geschaffen werden können, bleibt so für immer der Phantasie der enntäuschten Cineastengemeinde überlassen...
Das Bild trumpft mit satten Farben in prächtigen Technicolorfarben auf und besticht durch eine von Filmkorn befreite traumartige Bilsprache, durch die die oft mangelnde Bildschärfe in den Hintergrund gerückt wird.
mit 4
mit 4
mit 3
mit 3
bewertet am 23.04.12 um 18:02
Auch Heute noch unterhaltsamer Fantasystreifen.
Mehr aus Interesse mich am 80er Jahre Schund zu erlaben, stellte ich erstaunlicherweise fest, daß Conan ein ambitionierteres Stück Kinogeschichte ist, als ich mich noch erinnern mochte.
Natürlich wirkt aus heutiger Sicht vieles trashig. Angefangen von Arnies Schauspielversuchen gegen die sich Pinocchios hölzernes Gestakse wie die Vollendung des Method Acting ausnimmt, bis hin zu Gummimonstern, Styropordekos und peinlich martialischer Wikingerbekleidung.
Aber abgesehen davon schimmern durch die Größe und Ernsthaftigkeit der Erzählung auch immer wieder Momente von epischen Dimensionen, die Vergleiche mit den großen Sandalenklassiker nicht scheuen brauchen, durch.
Dafür verantwortlich dafür dürfte wohl hauptsächlich Waffen- und Gewaltnarr John Milius sein, der bei Conan Regie führte und sich auch für das Drehbuch mitverantwortlich fühlte.
Milius, schon bei Apocalypse Now maßgeblich am Drehbuch beteiligt, bewies schon dort sein Gespür für kernige Dialoge (ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen), Schlachtchoreographien, und Erwachsenengerechten Unterhaltung.
So bedient der Film, bei dem man der gesamten Crew attestieren muß, mit Liebe zum Detail zu Werke gegangen zu sein, Nostalgie- und Fantasyfreunde gleichermaßen, zumahl Arnie, Gott sei Dank, von einer Riege überzeugender Mimen flankiert wird.
Mehr aus Interesse mich am 80er Jahre Schund zu erlaben, stellte ich erstaunlicherweise fest, daß Conan ein ambitionierteres Stück Kinogeschichte ist, als ich mich noch erinnern mochte.
Natürlich wirkt aus heutiger Sicht vieles trashig. Angefangen von Arnies Schauspielversuchen gegen die sich Pinocchios hölzernes Gestakse wie die Vollendung des Method Acting ausnimmt, bis hin zu Gummimonstern, Styropordekos und peinlich martialischer Wikingerbekleidung.
Aber abgesehen davon schimmern durch die Größe und Ernsthaftigkeit der Erzählung auch immer wieder Momente von epischen Dimensionen, die Vergleiche mit den großen Sandalenklassiker nicht scheuen brauchen, durch.
Dafür verantwortlich dafür dürfte wohl hauptsächlich Waffen- und Gewaltnarr John Milius sein, der bei Conan Regie führte und sich auch für das Drehbuch mitverantwortlich fühlte.
Milius, schon bei Apocalypse Now maßgeblich am Drehbuch beteiligt, bewies schon dort sein Gespür für kernige Dialoge (ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen), Schlachtchoreographien, und Erwachsenengerechten Unterhaltung.
So bedient der Film, bei dem man der gesamten Crew attestieren muß, mit Liebe zum Detail zu Werke gegangen zu sein, Nostalgie- und Fantasyfreunde gleichermaßen, zumahl Arnie, Gott sei Dank, von einer Riege überzeugender Mimen flankiert wird.
mit 4
mit 3
mit 3
mit 3
bewertet am 23.04.12 um 11:47
Hervorragender Transfer eines klassischen Piratenabenteuers, der mit allen Klischees des Genres gespickt ist und und durch eine prächtige Technicolorfärbung eine dichte Athmosphäre erzeugt, die dem geneigten Nostalgiker von vorne bis hinten begeistert.
Errol Flynn litt 1952 schon an einer langjährigen Alkohol- und Heroinsucht, was sein Gesicht etwas aufgedunsener als zu seiner Glanzzeit erscheinen läßt. Seiner Spielfreude und Darstellung des umtriebigen Schwerenöters tut die allerdings keinen Abbruch.
Obwohl Flynn damals eigentlich die Faxen dick hatte von Filmen,in denen er ständig in Strumpfhosen herumkaspern muß, bringt er hier nocheinmal das ganze Charisma seines umtriebigen Lebenswandels zum erglühen.
Ebenso non chalant und begeistert spielt auch der Rest des Castes, allen voran Anthony Quinn, auf, so daß sich die positiv harmlose Stimmung unmittelbar auf die Zuschauer überträgt.
Ach, was war das noch für eine paradiesische Filmära, in der man gefangengenomme Haremsdamen ungeschoren und unter jaulendem Gegröle einer schmutzigen Freibeutermeute im Hafen an das nächstbeste Raubein versteigern konnte ohne dabei gleich politische Grundsatzdebatten über den Verfall der Sitten zu initiieren...
Weniger Anlass zum Grölen bietet der Verzicht auf die deutschen Untertitel, die somit das betrachten im Original ungemein erleichtert hätten. Warum nur italienische Untertitel vorhanden sind, bleibt wohl für immer Herr Kochs Geheimnis...
Errol Flynn litt 1952 schon an einer langjährigen Alkohol- und Heroinsucht, was sein Gesicht etwas aufgedunsener als zu seiner Glanzzeit erscheinen läßt. Seiner Spielfreude und Darstellung des umtriebigen Schwerenöters tut die allerdings keinen Abbruch.
Obwohl Flynn damals eigentlich die Faxen dick hatte von Filmen,in denen er ständig in Strumpfhosen herumkaspern muß, bringt er hier nocheinmal das ganze Charisma seines umtriebigen Lebenswandels zum erglühen.
Ebenso non chalant und begeistert spielt auch der Rest des Castes, allen voran Anthony Quinn, auf, so daß sich die positiv harmlose Stimmung unmittelbar auf die Zuschauer überträgt.
Ach, was war das noch für eine paradiesische Filmära, in der man gefangengenomme Haremsdamen ungeschoren und unter jaulendem Gegröle einer schmutzigen Freibeutermeute im Hafen an das nächstbeste Raubein versteigern konnte ohne dabei gleich politische Grundsatzdebatten über den Verfall der Sitten zu initiieren...
Weniger Anlass zum Grölen bietet der Verzicht auf die deutschen Untertitel, die somit das betrachten im Original ungemein erleichtert hätten. Warum nur italienische Untertitel vorhanden sind, bleibt wohl für immer Herr Kochs Geheimnis...
mit 4
mit 4
mit 3
mit 1
bewertet am 22.04.12 um 21:03
Ebenso wie das Original mit John Wayne ist die Neuauflage von True Grit kein Meilenstein des Westerns und die Neuverfilmung dessen bleibt daher etwas nebulös.
Nahm im alten Film noch das junge Mädchen (Mattie) mit ihrer schnippischen Art dem Film jeden Ansatz von Glaubwürdigkeit, übernimmt nun Jeff Bridges mit seiner Überteibung des lonesome rider Typus und Persiflage diverser Westernklischees diesen Part.
Obwohl True Grit mit seiner minimalistischen Handlung eigentlich idealerweise den benötigten Raum für eine Charakterstudie schafft, Bridges somit also eine Steilvorlage liefert seine schauspielerischen Talente auszuspielen, vermasselt dieser die Chance, die Rolle des Rooster Cogburn mit ergreifender Tragik auszustatten.
Stattdessen bewegt er sich mit seinen selbstironischen Sauf- und Schießeskapaden am Rande einer Schießbudenfigur, dem der True Grit (rechter Schneid) abgesprochen werden muß.
Auch wenn man auf Grund seiner markanten Grundpräsenz nicht von einem totalen Ausfall sprechen kann, enntäuscht die Unentschloßenheit darüber, in welche Richtung er die Rolle mit seinem Potential entwickeln will: Tragischer Held, alternder Cowboy oder resignierte Schnapsdrossel. So genau mag er sich da nicht festlegen. Vielmehr verbreiten seine lakonischen Auftritte ein Gefühl von Desinteresse und vermögen es nicht, den Zuschauer in seinen Bann zu ziehen, geschweige denn emotionen zu wecken.
So verpuffen die wenigen schauspielerischen und dramaturgischen Duftnoten dieses zähen Stückes Erzählkinos denn auch rückstandslos in den Weiten des wilden Westens ohne verwertbare Schmauchspuren zu hinterlassen.
Leider bietet neben des nicht ausgeschöpften schauspielerischen Potentials, die Handlung ebenso wenig Anlaß zur Freude. Sie läßt sich knapp aber erschöpfend in -kesses, selbstbewußtes Mädchen heuert Kopfgedjäger an, um mit diesem den Mörder ihres Vaters zu jagen- zusammenfassen.
Diese dürftige und sich nur zäh voranschleppende Handlung führt zwangsläufig dazu, daß es immer wieder zu Längen kommt und sich Langeweile breit macht.
Aber umso weniger Handlung vorhanden ist, umso mehr Gelegenheit bietet sich zwangsläufig, das Hauptaugenmerk auf die Charakterentfaltung und die Dynamik zwischen dem alternden Haudegen und dem willensstarken Jungspund zu beleuchten; ein Drama über Lebensbejahung und Lebensverneinung, über Ideale und Selbszerstörung, über Isolierung, Freundschaft und menschliche Beziehungen im algemeinen zu entwickeln.
Aber Nein, Rooster dackelt einfach nur behäbig auf seinem Gaul durch die Prärie und verströmt die gepflegte Langeweile eines Sonntagnachmittagsausrittes.
Wenigstens hätte man aber doch auf subtile Art den Einfluß Matties auf den verknöcherten Haudegen Rooster und die entstehende Porösität seines durch Einsamkeit verknöcherten Charakterpanzers ins Zentrum des Geschehens rücken können, um dem Film eine menschliche Note bescheren zu können.
Leider bleiben all diese Themen, die nunmal ungefragt zu den bescheidenen Themen der menschlichen Existenz gehören, weitestgehend auf der Strecke und werden nur fragmentarisch in Gesten, Blicken und einigen wenigen Worten angerissen.
Da die Kulissen der grandiosen Westernpanoramen den Abhandlungen dieser Themen durch ihre karge und melanchologische Stimmung aber geradezu die Bühne bereiten, ist die nur ansatzweise angedeutete psychologische Komponente nur schwer verzeihlich.
So bleiben letztendlich auch die karg eingefangenen Landschaftsbilder am nachträglichsten im Gedächtnis haften, können die dramaturgische und erzählerische Leere nicht wieder wett machen.
So knüpft auch das Ende des Films, in dem die Geschichte rückblickend melodramatisch erhöht und durch die Ausdehnung der zeitlichen Dimension ein großer Bogen gespannt werden soll, sich nicht nahtlos an das Gesehene an und hinterläßt nur Unverständnis darüber, was denn hier jetzt bitteschön so aufgeblasen werden soll.
Das Schlußlied trieft zugegeben von sehnsuchtsvoller Schönheit, suggeriert aber eine Rührseligkeit, die sich aus dem Gezeigtem nicht ableiten läßt.
So wiederholt die Neuverfilmung zwar nicht den Fehler des Originals, John Wayne im Kindergarten zu zeigen, verpasst aber durch die uninspiert wirkende Inszenierung die Chance, dem Film trotz eines fähigen Charakterdarstellers eine klare Aussage zu vermitteln.
Damit sind beide Teile im Grunde genommen verzichtbare Genrebeiträge.
Nahm im alten Film noch das junge Mädchen (Mattie) mit ihrer schnippischen Art dem Film jeden Ansatz von Glaubwürdigkeit, übernimmt nun Jeff Bridges mit seiner Überteibung des lonesome rider Typus und Persiflage diverser Westernklischees diesen Part.
Obwohl True Grit mit seiner minimalistischen Handlung eigentlich idealerweise den benötigten Raum für eine Charakterstudie schafft, Bridges somit also eine Steilvorlage liefert seine schauspielerischen Talente auszuspielen, vermasselt dieser die Chance, die Rolle des Rooster Cogburn mit ergreifender Tragik auszustatten.
Stattdessen bewegt er sich mit seinen selbstironischen Sauf- und Schießeskapaden am Rande einer Schießbudenfigur, dem der True Grit (rechter Schneid) abgesprochen werden muß.
Auch wenn man auf Grund seiner markanten Grundpräsenz nicht von einem totalen Ausfall sprechen kann, enntäuscht die Unentschloßenheit darüber, in welche Richtung er die Rolle mit seinem Potential entwickeln will: Tragischer Held, alternder Cowboy oder resignierte Schnapsdrossel. So genau mag er sich da nicht festlegen. Vielmehr verbreiten seine lakonischen Auftritte ein Gefühl von Desinteresse und vermögen es nicht, den Zuschauer in seinen Bann zu ziehen, geschweige denn emotionen zu wecken.
So verpuffen die wenigen schauspielerischen und dramaturgischen Duftnoten dieses zähen Stückes Erzählkinos denn auch rückstandslos in den Weiten des wilden Westens ohne verwertbare Schmauchspuren zu hinterlassen.
Leider bietet neben des nicht ausgeschöpften schauspielerischen Potentials, die Handlung ebenso wenig Anlaß zur Freude. Sie läßt sich knapp aber erschöpfend in -kesses, selbstbewußtes Mädchen heuert Kopfgedjäger an, um mit diesem den Mörder ihres Vaters zu jagen- zusammenfassen.
Diese dürftige und sich nur zäh voranschleppende Handlung führt zwangsläufig dazu, daß es immer wieder zu Längen kommt und sich Langeweile breit macht.
Aber umso weniger Handlung vorhanden ist, umso mehr Gelegenheit bietet sich zwangsläufig, das Hauptaugenmerk auf die Charakterentfaltung und die Dynamik zwischen dem alternden Haudegen und dem willensstarken Jungspund zu beleuchten; ein Drama über Lebensbejahung und Lebensverneinung, über Ideale und Selbszerstörung, über Isolierung, Freundschaft und menschliche Beziehungen im algemeinen zu entwickeln.
Aber Nein, Rooster dackelt einfach nur behäbig auf seinem Gaul durch die Prärie und verströmt die gepflegte Langeweile eines Sonntagnachmittagsausrittes.
Wenigstens hätte man aber doch auf subtile Art den Einfluß Matties auf den verknöcherten Haudegen Rooster und die entstehende Porösität seines durch Einsamkeit verknöcherten Charakterpanzers ins Zentrum des Geschehens rücken können, um dem Film eine menschliche Note bescheren zu können.
Leider bleiben all diese Themen, die nunmal ungefragt zu den bescheidenen Themen der menschlichen Existenz gehören, weitestgehend auf der Strecke und werden nur fragmentarisch in Gesten, Blicken und einigen wenigen Worten angerissen.
Da die Kulissen der grandiosen Westernpanoramen den Abhandlungen dieser Themen durch ihre karge und melanchologische Stimmung aber geradezu die Bühne bereiten, ist die nur ansatzweise angedeutete psychologische Komponente nur schwer verzeihlich.
So bleiben letztendlich auch die karg eingefangenen Landschaftsbilder am nachträglichsten im Gedächtnis haften, können die dramaturgische und erzählerische Leere nicht wieder wett machen.
So knüpft auch das Ende des Films, in dem die Geschichte rückblickend melodramatisch erhöht und durch die Ausdehnung der zeitlichen Dimension ein großer Bogen gespannt werden soll, sich nicht nahtlos an das Gesehene an und hinterläßt nur Unverständnis darüber, was denn hier jetzt bitteschön so aufgeblasen werden soll.
Das Schlußlied trieft zugegeben von sehnsuchtsvoller Schönheit, suggeriert aber eine Rührseligkeit, die sich aus dem Gezeigtem nicht ableiten läßt.
So wiederholt die Neuverfilmung zwar nicht den Fehler des Originals, John Wayne im Kindergarten zu zeigen, verpasst aber durch die uninspiert wirkende Inszenierung die Chance, dem Film trotz eines fähigen Charakterdarstellers eine klare Aussage zu vermitteln.
Damit sind beide Teile im Grunde genommen verzichtbare Genrebeiträge.
mit 3
mit 4
mit 3
mit 2
bewertet am 22.04.12 um 13:02
Film, der sehr vom Tetsuo Bonus des Regisseurs lebt und während der gesamten Dauer auf die Entfesselung schizophrener Energien wie in seinem Kultfilm hoffen läßt.
Aber umsont gehofft. Regisseur Tsukamoto geht hier wesentlich behutsamer, ganz im Stil japanischer Geistermovies, zu Werke.
Diese zeichnen sich aber nicht wie die westlichen Pendants durch massive Schockeffekte, sondern eher durch subtilen Gänsehauthorror aus.
Auch wenn diese Sehgewohnheiten immer mehr Anhänger finden, vor allen aus der antiwestlichen, antikommerziellen und besser weil Original Strömung, ist die unterkühlte Erzählweise doch sehr gewöhnungsbedürftig.
Ich persönlich kann mit den kühlen Bildern, den sterilen Gesichtsausdrücken, den kaum vorhandenen Dialogen, der fehlenden Filmmusik und der reduzierten Spannungsbogen nicht warm werden.
Zugegeben wird es am Ende denn etwas slashiger, da aber der Regisseur hier die fragwürdigen Freuden der verwackelten Videokamerea entdeckt zu haben scheint, kann man auch hier nicht wirklich von Filmgenuss sprechen.
Im beigepackten Interview ist zu erfahren, daß Tsukamoto, wie könnt es anders sein, er kommt ja vom Theater, in erster Linie eine Parabel auf die mangelnde Kommunikation in der Gesellschaft und die Verdrängung der Emotionen in das unterbewußte Reich der Träume, schaffen wollte.
So eine Gesellschaftskritik mag seine Berechtigung haben, die Transformation in einen mißlungenen J-Horrorstreifen rechtfertigt dies jedoch noch lange nicht.
Für Fans des asiatischen Kinos, intellektuellen Cineasten mit tiefenpsychologischen und Neoanthropologischen Stammtischambitionen und Freunden der ungepflegten Langeweile aber ein unbedingtes Muß.
Aber umsont gehofft. Regisseur Tsukamoto geht hier wesentlich behutsamer, ganz im Stil japanischer Geistermovies, zu Werke.
Diese zeichnen sich aber nicht wie die westlichen Pendants durch massive Schockeffekte, sondern eher durch subtilen Gänsehauthorror aus.
Auch wenn diese Sehgewohnheiten immer mehr Anhänger finden, vor allen aus der antiwestlichen, antikommerziellen und besser weil Original Strömung, ist die unterkühlte Erzählweise doch sehr gewöhnungsbedürftig.
Ich persönlich kann mit den kühlen Bildern, den sterilen Gesichtsausdrücken, den kaum vorhandenen Dialogen, der fehlenden Filmmusik und der reduzierten Spannungsbogen nicht warm werden.
Zugegeben wird es am Ende denn etwas slashiger, da aber der Regisseur hier die fragwürdigen Freuden der verwackelten Videokamerea entdeckt zu haben scheint, kann man auch hier nicht wirklich von Filmgenuss sprechen.
Im beigepackten Interview ist zu erfahren, daß Tsukamoto, wie könnt es anders sein, er kommt ja vom Theater, in erster Linie eine Parabel auf die mangelnde Kommunikation in der Gesellschaft und die Verdrängung der Emotionen in das unterbewußte Reich der Träume, schaffen wollte.
So eine Gesellschaftskritik mag seine Berechtigung haben, die Transformation in einen mißlungenen J-Horrorstreifen rechtfertigt dies jedoch noch lange nicht.
Für Fans des asiatischen Kinos, intellektuellen Cineasten mit tiefenpsychologischen und Neoanthropologischen Stammtischambitionen und Freunden der ungepflegten Langeweile aber ein unbedingtes Muß.
mit 2
mit 3
mit 3
mit 3
bewertet am 22.04.12 um 12:39
Zum zweiten mal darf sich Arnie durch Fantasien posen.
Im großen und ganzen noch OK, aber obwohl im Geiste des Vorgängers gedreht, mehr eine Fußnote desgleichen.
Im großen und ganzen noch OK, aber obwohl im Geiste des Vorgängers gedreht, mehr eine Fußnote desgleichen.
mit 3
mit 3
mit 3
mit 2
bewertet am 21.04.12 um 19:51
Solider Fantasymix aus wohlerprobten Genreelementen, der seine Schwerpunkte eindeutig auf Atmosphäre und klassischen Grusel legt.
Der letzte Tempelritter ist weit davon entfernt, mit einem logisch nachvollzieharen Handlungsverlauf wie der Herr der Ringe aufzuwarten oder sich besondere Mühe bei der Ausgestaltung der Charakter zu geben. Die Akteure werden allesamt kurz in einer Comichaften Erhöhung vorgestellt und dann jäh, ohne Ihnen besondere Tiefe verliehen zu haben, auf Ihre Mission, eine vermeintliche Hexe die für die grassiernde Pest verantwortlich gemacht wird, zu einem abgelegen Kloster zu transportieren, geschickt.
Die Reise führt die verschworene Gemeinschaft über Stock und Stein, über Schluchten und Berge, durch Wald und Dickicht. Aber auch der Bruder Wolf treibt im Wald sein Ungemach und sorgt für üble Stimmung unter den 5 Freunden. Erschwert wird die Reise zudem durch die vermeintliche Hexe, die immer wieder versucht die Teammitglieder zu bezirzen und zu verwirren, um sie so gegeneinander auszuspielen.
Letztlich aber kann den Launen der Natur und den psychologischen Wirrungen getrotzt werden und man erreicht das Kloster. Dort wartet allerdings eine Überraschung auf die Herren Ritter...
Auch wenn es inhaltlich von Patzern und logischen Untiefen nur so wimmelt und einige Dialoge bis hart an die Schamgrenze dick aufgetragen sind, überzeugt der Film jedoch vom Anfang bis kurz vorm Ende durch seine morbide und unterschwellig permanent gruselige Stimmung, die ganz in der Tradition des klassischen Horrorfilms steht.
Eine trostlos entsättigte Farbgebung kommt hier ebenso zur Geltung wie stimmungsvolle Kulissen und ein Mittelalter, daß von Schmutz und Krankheit nur so durchtränkt ist.
Vergleiche zum, natürlich weit anspruchsvolleren, Name der Rose drängen sich deshalb nicht nur wegen Ron Perlmann, der in beiden Filmen mitspielt, und dem jungen Reisebegleiter, dem Pendant zu Adson aus dem Name der Rose, auf, sondern auch dadurch, daß sich beide Filme durch eine dichte und dunkel geheimnisvolle Atmosphäre auszeichnen, in die man gerne eintaucht und nach über 90 min. nur ungerne wieder verläßt.
Da die Stärke des Filmes eben die Atmosphäre und der sanfte Grusel ist, sollten sich Mittelalterfreaks, die auf eine historisch exakte Ausarbeitung ihrer idealisierten Epoche Wert legen, ebenso fernhalten wie Anspruchsjünger, die scholastische Debatten über die Werke des Thomas von Aquin erwarten.
Wer aber noch über die emotionale Sensibilität verfügt, seine Nerven von subtilen Mittelalter- und Hexenzauber kitzeln zu lassen, darf sich beim letzten Tempelritter über ein gefundenes Fressen freuen.
Die Spezialeffekte fügen sich stimmig in den Stil des Films ein und sind daher angemeßen, auch wenn nicht völlig state of the art. Nur an den Kamerastil am Ende des Films, in dem die Kampfscenen im "stroboskop" Effekt, in dem man kaum erkennt was eigentlich geschieht, kann ich mich nicht gewöhnen. Im Gegenteil ist dies im Bunde mit den zu dunklen Bildern sogar richtig ärgerlich und versaut den Gesamteindruck nach Hinten raus etwas.
Den Schluß kann man dann viellleicht auch insgesamt als den Pferdefuß des Films bezeichnen, da dort dramaturgisches Potential en masse verschenkt wurde und auf Grund zu einfacher Dramaturgie der gewollte "Tusch" sich nicht richtig auf den Zuschauer überträgt. Hätte man hier etwas mehr Ernsthaftigkeit an den Tag gelegt und sich mehr in Richtung Horrror gewagt, hätte dem Film ein denkwürdigeres Finale und wohler gesonnene Zuschauermeinungen beschert werden können. So bleibt der Film denn schlußendlich, obwohl wiegesagt handwerklich OK, zu sehr in konventionellen Bahnen stecken, als daß er das Genre um ein echtes Highlight bereichert hätte.
Die Schauspieler agieren allerdings allesamt souverän, haben aber drehbuchbedingt kaum Gelegenheit sich in den Vordergrund zu spielen und ordnen sich dementsprechend der Handlung unter.
Da Der letzte Tempelritter aber nunmal kein Schauspielerkino, sondern eine Schauermär ist, geht dies voll in Ordnung und geben der Mode, Nicolas Cage als gefallenen und im B-Movie Sumpf gestrandeten Star zu bezeichnen, keine neue Nahrung.
Auch The Knowing und Drive Angry wissen auf ihre Art durchaus zu gefallen...
Der letzte Tempelritter ist weit davon entfernt, mit einem logisch nachvollzieharen Handlungsverlauf wie der Herr der Ringe aufzuwarten oder sich besondere Mühe bei der Ausgestaltung der Charakter zu geben. Die Akteure werden allesamt kurz in einer Comichaften Erhöhung vorgestellt und dann jäh, ohne Ihnen besondere Tiefe verliehen zu haben, auf Ihre Mission, eine vermeintliche Hexe die für die grassiernde Pest verantwortlich gemacht wird, zu einem abgelegen Kloster zu transportieren, geschickt.
Die Reise führt die verschworene Gemeinschaft über Stock und Stein, über Schluchten und Berge, durch Wald und Dickicht. Aber auch der Bruder Wolf treibt im Wald sein Ungemach und sorgt für üble Stimmung unter den 5 Freunden. Erschwert wird die Reise zudem durch die vermeintliche Hexe, die immer wieder versucht die Teammitglieder zu bezirzen und zu verwirren, um sie so gegeneinander auszuspielen.
Letztlich aber kann den Launen der Natur und den psychologischen Wirrungen getrotzt werden und man erreicht das Kloster. Dort wartet allerdings eine Überraschung auf die Herren Ritter...
Auch wenn es inhaltlich von Patzern und logischen Untiefen nur so wimmelt und einige Dialoge bis hart an die Schamgrenze dick aufgetragen sind, überzeugt der Film jedoch vom Anfang bis kurz vorm Ende durch seine morbide und unterschwellig permanent gruselige Stimmung, die ganz in der Tradition des klassischen Horrorfilms steht.
Eine trostlos entsättigte Farbgebung kommt hier ebenso zur Geltung wie stimmungsvolle Kulissen und ein Mittelalter, daß von Schmutz und Krankheit nur so durchtränkt ist.
Vergleiche zum, natürlich weit anspruchsvolleren, Name der Rose drängen sich deshalb nicht nur wegen Ron Perlmann, der in beiden Filmen mitspielt, und dem jungen Reisebegleiter, dem Pendant zu Adson aus dem Name der Rose, auf, sondern auch dadurch, daß sich beide Filme durch eine dichte und dunkel geheimnisvolle Atmosphäre auszeichnen, in die man gerne eintaucht und nach über 90 min. nur ungerne wieder verläßt.
Da die Stärke des Filmes eben die Atmosphäre und der sanfte Grusel ist, sollten sich Mittelalterfreaks, die auf eine historisch exakte Ausarbeitung ihrer idealisierten Epoche Wert legen, ebenso fernhalten wie Anspruchsjünger, die scholastische Debatten über die Werke des Thomas von Aquin erwarten.
Wer aber noch über die emotionale Sensibilität verfügt, seine Nerven von subtilen Mittelalter- und Hexenzauber kitzeln zu lassen, darf sich beim letzten Tempelritter über ein gefundenes Fressen freuen.
Die Spezialeffekte fügen sich stimmig in den Stil des Films ein und sind daher angemeßen, auch wenn nicht völlig state of the art. Nur an den Kamerastil am Ende des Films, in dem die Kampfscenen im "stroboskop" Effekt, in dem man kaum erkennt was eigentlich geschieht, kann ich mich nicht gewöhnen. Im Gegenteil ist dies im Bunde mit den zu dunklen Bildern sogar richtig ärgerlich und versaut den Gesamteindruck nach Hinten raus etwas.
Den Schluß kann man dann viellleicht auch insgesamt als den Pferdefuß des Films bezeichnen, da dort dramaturgisches Potential en masse verschenkt wurde und auf Grund zu einfacher Dramaturgie der gewollte "Tusch" sich nicht richtig auf den Zuschauer überträgt. Hätte man hier etwas mehr Ernsthaftigkeit an den Tag gelegt und sich mehr in Richtung Horrror gewagt, hätte dem Film ein denkwürdigeres Finale und wohler gesonnene Zuschauermeinungen beschert werden können. So bleibt der Film denn schlußendlich, obwohl wiegesagt handwerklich OK, zu sehr in konventionellen Bahnen stecken, als daß er das Genre um ein echtes Highlight bereichert hätte.
Die Schauspieler agieren allerdings allesamt souverän, haben aber drehbuchbedingt kaum Gelegenheit sich in den Vordergrund zu spielen und ordnen sich dementsprechend der Handlung unter.
Da Der letzte Tempelritter aber nunmal kein Schauspielerkino, sondern eine Schauermär ist, geht dies voll in Ordnung und geben der Mode, Nicolas Cage als gefallenen und im B-Movie Sumpf gestrandeten Star zu bezeichnen, keine neue Nahrung.
Auch The Knowing und Drive Angry wissen auf ihre Art durchaus zu gefallen...
mit 4
mit 4
mit 4
mit 3
bewertet am 17.04.12 um 16:22
Tja! Wie soll man einen Film bewerten, bei dem man über die gesamte Spieldauer den Eindruck nicht loswird, in die uranfängliche Leere des filmischen Nirvanas zu blicken?
Es scheint fast so, als ob Carpenters Film verflüßigt und durch einen Filter gepreßt wurde, bei dem sämtliche mit Spannung und Dramatik aufgeladenen Elemente extrahiert wurden und nur das visuelle Substrat übrig blieb: Denn an sich sind fast alle Elemente, die Carpenters Film so beklemmend machen auch hier enthalten: Der außerirdische Virus; die isolierte Gemeinschaft; die Ungewißheit der Infizierung; das gegenseitige Mißtrauen und spektakuläre Mutationen. Von Beklemmung, geschweige denn Horror ist jedoch weit und breit nichts zu sehen oder zu fühlen.
Statt nämlich einen eigenen, neuen und originellen Mix dieser Zutaten zu präsentieren, stapft Hasenfuss Regisseur Mathijs van Heijningen lieber auf augetretenen Pfaden und kopiert die Handlung von Carpenter nahezu 1:1, ohne jedoch die Bilder des Films auch nur Ansatzweise mit Horror und Spannung zu würzen.
Wäre er dabei aber ein Meister im Umgang mit der Angst und im erzeugen von Gänsehaut gewesen, hätte ja zumindest noch eine interessante Variante des Alienklassikers dabei herauskommen können.
Statt jedoch wie in der Vorlage für ständig steigende Spannung zu sorgen, stümpert und flickschustert sich van Heijningen von einer geklauten Scene zur nächsten ohne sich die Finger an der Spannungsschraube schmutzig zu machen.
Zu diffus springt der Haufen der Polarforscher durchs Bild und zu groß ist die Anzahl der Lagerbewohner, als daß man sich personell orientiert hätte, bevor es dann ganz plötzlich "Los" geht.
Carpenter präsentierte hingegen eine handvoll verschrobener Typen, gab ihnen Raum und Zeit um ihre Eigenheiten verbal, mimisch und gestisch zu demonstrieren und füllte so die Rollen mit Charakter um somit die unabdingbare Grundlage für die nachfühlbare Beklemmung zu schaffen.
Van Heijningens kreatives Genie beschränkt sich leider nur darauf den Personen Bärte anzukleben und mit Namen zu versehen. Das ist traurig und da darf man mehr erwarten.
Als es dann"Los" geht, übernimmt, wieso auch immer, die Paläantologin (Mary Elisabeth Winstead) das Kommando.
Weshalb sich das die halb verwilderte Meute der norwegischen Polarforscher bieten läßt, bleibt bis weit über den Schluß hinaus rätselhaft, da sie weder über Charisma noch das spektakuläre Aussehen verfügt, um bei gestandenen Mannsbildern einen Folgereflex auszulösen, und auch in sonst keiner Scene irgendwie ansatzweise "Tough" wirkt.
So rennen denn auch meistens nur ein paar Männer kreuz und quer durch die Polarstation, nehmen sich gegenseitig mal als Geisel und spielen den Rest der Zeit mit ihren Flammenwerfern Cowboy und Indianer.
Da man so nicht wirklich immer den roten Faden behält, der notwendig gewesen wäre um mitzufiebern, geht man quasi als rettenden Strohalm zwangsläufig dazu über, sich auf die Spezialeffekte zu konzentrieren, waren diese doch die Krönung des Vorläufers.
Aber hier wird schlußendlich die letzte Vorfreude endgültig zu Grabe getragen: Hatten bei Carpenter die Effekte ein Staunen über das noch nie dagewesene verursacht und ein Respekt abnötigendes Wundern über die handwerklichen Meisterleistungen der Maskenbildner hervorgerufen, bleibt der Nachfolger lediglich bei einer seelenlosen digital aufgemotzten Kopie.
Statt, wenn man schon CGI verwendet, der Kreativität Flügel zu verleihen und etwa mit extravaganten außerirdischen Evolutionsformen zu punkten, wird hier bloß das Alte, wenn auch etwas mehr ausgeschmückt, wiederholt und die Wirkung der realistisch anmutenden Verwandlungssequenzen durch eine "unrealistische", weil übertrieben bis albernen CGI Darstellung ersetzt.
Auch hätte man, wenn man sich schon die Mühe macht digitale Effekte zu verwenden, diese etwas ausführlicher und detailverliebter zeigen dürfen. So wird aber durch schnellen Schnitt und abdunkeln bis an die Grenze der Erkenntlichkeit, dem Film auch die letzte Möglichkeit genommen, sich mit etwas positiven im Gedächtnis des Zuschauers zu verankern.
Daran ändern auch die wenigen "Eigenkreationen", wie etwa das aufsuchen des UFO's nichts, da sie wegen des bloßen kopierens diverser Vorläufer mehr an ein Besuch im Science Fiction Museum erinnern, als eine Werkorientierte Interpretation.
Was unterm Strich bleibt, ist die traurige Feststellung, daß der gesamte Film fast ausschließlich von der Erwartung getragen wird, endlich den Drive von Carpenters Version aufzunehmen. So bleibt der Erregungszustand unter Umständen konstant hoch, (wann schockts denn endlich) läßt sich aus dem Film selber heraus jedoch nicht ableiten.
Das die Klasse des nahezu perfekten Streifen Carpenters nicht erreicht werden würde, war den meisten wohl von vornerein klar, daß man bei Remakes, Sequels und Prequels aber nicht von Angst und Feigheit getrieben werden muß, sondern man sich auch mal etwas trauen darf, beweisen z.b. die Alien Filme, mit ihren, den jeweiligen Regisseuren typischen, Interpretation der Weltraumsaga (ob Teil 3 und 4 wirklich notwendig waren, sei jetzt mal dahin gestellt!)
Positiv bleibt anzumerken, daß die gescheiterte Neuverfilmung, die bezeichnender Weise erst durch den Score in der Schlußsequenz Freude augkommen läßt, den Ikonenhaften Status von Carpenters Meisterwerk vielleicht noch ein wenig exponierter erscheinen läßt, auch wenn dieses Werk, konnte man sich bei Kurt Russell's Besuch in der norwegischen Polarstation noch den entfesselten Horror der dort stattgefunden haben mag zurechtphantasieren, wohl immer mit dem Phlegma der filmischen Realität behaftet sein wird.
Aber wieso überhaupt wegen Nichts soviel Worte verlieren....?
Es scheint fast so, als ob Carpenters Film verflüßigt und durch einen Filter gepreßt wurde, bei dem sämtliche mit Spannung und Dramatik aufgeladenen Elemente extrahiert wurden und nur das visuelle Substrat übrig blieb: Denn an sich sind fast alle Elemente, die Carpenters Film so beklemmend machen auch hier enthalten: Der außerirdische Virus; die isolierte Gemeinschaft; die Ungewißheit der Infizierung; das gegenseitige Mißtrauen und spektakuläre Mutationen. Von Beklemmung, geschweige denn Horror ist jedoch weit und breit nichts zu sehen oder zu fühlen.
Statt nämlich einen eigenen, neuen und originellen Mix dieser Zutaten zu präsentieren, stapft Hasenfuss Regisseur Mathijs van Heijningen lieber auf augetretenen Pfaden und kopiert die Handlung von Carpenter nahezu 1:1, ohne jedoch die Bilder des Films auch nur Ansatzweise mit Horror und Spannung zu würzen.
Wäre er dabei aber ein Meister im Umgang mit der Angst und im erzeugen von Gänsehaut gewesen, hätte ja zumindest noch eine interessante Variante des Alienklassikers dabei herauskommen können.
Statt jedoch wie in der Vorlage für ständig steigende Spannung zu sorgen, stümpert und flickschustert sich van Heijningen von einer geklauten Scene zur nächsten ohne sich die Finger an der Spannungsschraube schmutzig zu machen.
Zu diffus springt der Haufen der Polarforscher durchs Bild und zu groß ist die Anzahl der Lagerbewohner, als daß man sich personell orientiert hätte, bevor es dann ganz plötzlich "Los" geht.
Carpenter präsentierte hingegen eine handvoll verschrobener Typen, gab ihnen Raum und Zeit um ihre Eigenheiten verbal, mimisch und gestisch zu demonstrieren und füllte so die Rollen mit Charakter um somit die unabdingbare Grundlage für die nachfühlbare Beklemmung zu schaffen.
Van Heijningens kreatives Genie beschränkt sich leider nur darauf den Personen Bärte anzukleben und mit Namen zu versehen. Das ist traurig und da darf man mehr erwarten.
Als es dann"Los" geht, übernimmt, wieso auch immer, die Paläantologin (Mary Elisabeth Winstead) das Kommando.
Weshalb sich das die halb verwilderte Meute der norwegischen Polarforscher bieten läßt, bleibt bis weit über den Schluß hinaus rätselhaft, da sie weder über Charisma noch das spektakuläre Aussehen verfügt, um bei gestandenen Mannsbildern einen Folgereflex auszulösen, und auch in sonst keiner Scene irgendwie ansatzweise "Tough" wirkt.
So rennen denn auch meistens nur ein paar Männer kreuz und quer durch die Polarstation, nehmen sich gegenseitig mal als Geisel und spielen den Rest der Zeit mit ihren Flammenwerfern Cowboy und Indianer.
Da man so nicht wirklich immer den roten Faden behält, der notwendig gewesen wäre um mitzufiebern, geht man quasi als rettenden Strohalm zwangsläufig dazu über, sich auf die Spezialeffekte zu konzentrieren, waren diese doch die Krönung des Vorläufers.
Aber hier wird schlußendlich die letzte Vorfreude endgültig zu Grabe getragen: Hatten bei Carpenter die Effekte ein Staunen über das noch nie dagewesene verursacht und ein Respekt abnötigendes Wundern über die handwerklichen Meisterleistungen der Maskenbildner hervorgerufen, bleibt der Nachfolger lediglich bei einer seelenlosen digital aufgemotzten Kopie.
Statt, wenn man schon CGI verwendet, der Kreativität Flügel zu verleihen und etwa mit extravaganten außerirdischen Evolutionsformen zu punkten, wird hier bloß das Alte, wenn auch etwas mehr ausgeschmückt, wiederholt und die Wirkung der realistisch anmutenden Verwandlungssequenzen durch eine "unrealistische", weil übertrieben bis albernen CGI Darstellung ersetzt.
Auch hätte man, wenn man sich schon die Mühe macht digitale Effekte zu verwenden, diese etwas ausführlicher und detailverliebter zeigen dürfen. So wird aber durch schnellen Schnitt und abdunkeln bis an die Grenze der Erkenntlichkeit, dem Film auch die letzte Möglichkeit genommen, sich mit etwas positiven im Gedächtnis des Zuschauers zu verankern.
Daran ändern auch die wenigen "Eigenkreationen", wie etwa das aufsuchen des UFO's nichts, da sie wegen des bloßen kopierens diverser Vorläufer mehr an ein Besuch im Science Fiction Museum erinnern, als eine Werkorientierte Interpretation.
Was unterm Strich bleibt, ist die traurige Feststellung, daß der gesamte Film fast ausschließlich von der Erwartung getragen wird, endlich den Drive von Carpenters Version aufzunehmen. So bleibt der Erregungszustand unter Umständen konstant hoch, (wann schockts denn endlich) läßt sich aus dem Film selber heraus jedoch nicht ableiten.
Das die Klasse des nahezu perfekten Streifen Carpenters nicht erreicht werden würde, war den meisten wohl von vornerein klar, daß man bei Remakes, Sequels und Prequels aber nicht von Angst und Feigheit getrieben werden muß, sondern man sich auch mal etwas trauen darf, beweisen z.b. die Alien Filme, mit ihren, den jeweiligen Regisseuren typischen, Interpretation der Weltraumsaga (ob Teil 3 und 4 wirklich notwendig waren, sei jetzt mal dahin gestellt!)
Positiv bleibt anzumerken, daß die gescheiterte Neuverfilmung, die bezeichnender Weise erst durch den Score in der Schlußsequenz Freude augkommen läßt, den Ikonenhaften Status von Carpenters Meisterwerk vielleicht noch ein wenig exponierter erscheinen läßt, auch wenn dieses Werk, konnte man sich bei Kurt Russell's Besuch in der norwegischen Polarstation noch den entfesselten Horror der dort stattgefunden haben mag zurechtphantasieren, wohl immer mit dem Phlegma der filmischen Realität behaftet sein wird.
Aber wieso überhaupt wegen Nichts soviel Worte verlieren....?
mit 2
mit 3
mit 3
mit 3
bewertet am 17.04.12 um 12:02
Halbvergessener Italowestern mit einer handvoll starken aber auch einer Menge schwacher Scenen.
Zu den Stärken muß man eindeutig die Kamerarbeit, die mit einer Menge ungewöhnlicher Perspektiven und Westernpanoramen von zeitloser Ausstrahlung punkten kann ebenso zählen, wie die visuelle Gestalltung, die zu jedem Zeitpunkt genauso zu überzeugen vermag wie die solide schauspielerische Arbeit.
Im Italowestern typisch schmutzig und hartem Look überzeugen vor allem Burt Reynolds und Aldo Sambrell mit ihrem Charisma und Nicoletta Machiavelli als Sahnehäubchen für die männlichen Betrachter.
Zu den weniger gelungenen Momenten muß man sicher die etwas holprige Inszenierung, den nicht immer fließenden Schnitt und das grenzdebile Verhalten der Gangster in den Duellen mit Navajo Joe bezeichnen, die unter Ignorierung sämtlicher Überlebensinstinkte und ergeben wie ein Opferlamm förmlich darum zu betteln scheinen, von Joe in die Jagdgründe befördert zu werden.
Dieses dümmliche Verhalten wertet den Film leider ebenso ein wenig ab, wie die aus heutiger Sicht albernen und auf Effekthascherei getrimmten Gewaltscenen, die dem Film eine primitivere Note verleihen, als er auf Grund der überzeugenden Rahmenbedingungen eigentlich verdient hätte.
Da aber explizite Gewaltscenen und Grausamkeiten nun mal ein Markenzeichen des Spaghettiwesterns sind, muß man das eben wohl oder übel hinnehmen.
Zum Schluß sei noch die Filmmusik vom Altmeister der Bildvertonung Sergio Leone erwähnt, die das Spektrum von einfachem Kinder Sing Sang, bis zu Kompositionen, die den Vergleich zu seinen gelungensten Würfe nicht scheuen brauchen, abdecken und somit in einigen Momenten eine Ahnung von Größe und Erhabenheit durchschimmern lassen, die 2 Jahre später mit "Spiel mir das Lied vom Tod" Wirklichkeit wurde.
Zu den Stärken muß man eindeutig die Kamerarbeit, die mit einer Menge ungewöhnlicher Perspektiven und Westernpanoramen von zeitloser Ausstrahlung punkten kann ebenso zählen, wie die visuelle Gestalltung, die zu jedem Zeitpunkt genauso zu überzeugen vermag wie die solide schauspielerische Arbeit.
Im Italowestern typisch schmutzig und hartem Look überzeugen vor allem Burt Reynolds und Aldo Sambrell mit ihrem Charisma und Nicoletta Machiavelli als Sahnehäubchen für die männlichen Betrachter.
Zu den weniger gelungenen Momenten muß man sicher die etwas holprige Inszenierung, den nicht immer fließenden Schnitt und das grenzdebile Verhalten der Gangster in den Duellen mit Navajo Joe bezeichnen, die unter Ignorierung sämtlicher Überlebensinstinkte und ergeben wie ein Opferlamm förmlich darum zu betteln scheinen, von Joe in die Jagdgründe befördert zu werden.
Dieses dümmliche Verhalten wertet den Film leider ebenso ein wenig ab, wie die aus heutiger Sicht albernen und auf Effekthascherei getrimmten Gewaltscenen, die dem Film eine primitivere Note verleihen, als er auf Grund der überzeugenden Rahmenbedingungen eigentlich verdient hätte.
Da aber explizite Gewaltscenen und Grausamkeiten nun mal ein Markenzeichen des Spaghettiwesterns sind, muß man das eben wohl oder übel hinnehmen.
Zum Schluß sei noch die Filmmusik vom Altmeister der Bildvertonung Sergio Leone erwähnt, die das Spektrum von einfachem Kinder Sing Sang, bis zu Kompositionen, die den Vergleich zu seinen gelungensten Würfe nicht scheuen brauchen, abdecken und somit in einigen Momenten eine Ahnung von Größe und Erhabenheit durchschimmern lassen, die 2 Jahre später mit "Spiel mir das Lied vom Tod" Wirklichkeit wurde.
mit 4
mit 3
mit 3
mit 3
bewertet am 06.04.12 um 15:33
Heimatfilm der düsteren Art, der mit einer Menge guter Schauspieler, viel Lokalkolorit, Bergscenerien fernab vom Postkartenkitsch und einer Handlung, die zwischen Krimi, Schauermär und Liebesdrama hin und her pendelt, ausgestattet ist.
Geschickt erzählt der Regisseur Michael Steiner seine Geschichte in zeitlich verschachtelter Reihenfolge, um dem Zuschauer so lange wie möglich im unklaren zu lassen:
Bei einer Beerdigung auf dem Gemeindefriedhof taucht plötzlich eine verwilderte Frau in einer Kutte auf.
Der Dorfpolizist nimmt sich der entkräfteten Frau an und versucht Ihre Herkunft zu klären. Da die Frau aber nicht spricht und zudem an einer Amnesie zu leiden scheint, schreiten die Ermittlungen nur sehr zäh voran.
Für die Dorfbewohner, allem voran den Pastor, ist indessen der Fall schnell klar: Es kann sich nur um den Dämon halten, der schon seit dem Mittelalter, so berichtet es die Dorfchronik, immer wieder Menschen auf rätselhafte Weise verschwinden läßt...
Während das Geschehen im Dorf, angefeuert durch den Aberglauben, immer merkwürdigere Blüten treibt, werden in Rückblenden die Ereignisse auf einer nahegelegen Alm beleuchtet: Der Grobe Bergbauer Erwin lebt hier mit seinem tauben Neffen Albert, um sein karges Leben mit der Herstellung von Ziegenkäse zu fristen. Als der Wandersgeselle Reusch zu Ihnen trifft, läßt man sich im tiefsten Absinthrausch auf ein dunkles Ritual ein und stellt eine Strohpuppe her, das Sennentuntschi, um sich in der Nacht mit ihr zu vergnügen.
Als am nächsten Morgen tatsächlich eine lebendige Frau im Stall auftaucht, nehmen die Dinge Ihren folgenschweren Lauf....
So handwerklich solide dieses schweizer Kleinod allerdings auch ausgefallen ist, hat es meines Erachtens in seiner Dramaturgie den entscheidenden Fehler gemacht, die Anfangs ausgelegten Fährten aus dem Bereich den unheimlichen und mystischen, die noch zu Unbehagen geführt haben, nicht weiter auszubauen, sondern diese im Laufe des Films einer zunehmenden Profanisierung zu opfern.
Damit fällt die Spannung zum Ende zur allgemeinen Enttäuschung eher ab als sich zu steigern und viele Erwartungen werden so enttäuscht.
Abgesehen von diesem dramaturgischen Kardinalfehler, erlaubt sich der Film aber keine weiteren Schnitzer und gewährt so einen Blick auf die unter einer spröden Schale steckenden und so kaum für möglich gehaltenen dunkle Seite der Seele des Eidgenossen.
Geschickt erzählt der Regisseur Michael Steiner seine Geschichte in zeitlich verschachtelter Reihenfolge, um dem Zuschauer so lange wie möglich im unklaren zu lassen:
Bei einer Beerdigung auf dem Gemeindefriedhof taucht plötzlich eine verwilderte Frau in einer Kutte auf.
Der Dorfpolizist nimmt sich der entkräfteten Frau an und versucht Ihre Herkunft zu klären. Da die Frau aber nicht spricht und zudem an einer Amnesie zu leiden scheint, schreiten die Ermittlungen nur sehr zäh voran.
Für die Dorfbewohner, allem voran den Pastor, ist indessen der Fall schnell klar: Es kann sich nur um den Dämon halten, der schon seit dem Mittelalter, so berichtet es die Dorfchronik, immer wieder Menschen auf rätselhafte Weise verschwinden läßt...
Während das Geschehen im Dorf, angefeuert durch den Aberglauben, immer merkwürdigere Blüten treibt, werden in Rückblenden die Ereignisse auf einer nahegelegen Alm beleuchtet: Der Grobe Bergbauer Erwin lebt hier mit seinem tauben Neffen Albert, um sein karges Leben mit der Herstellung von Ziegenkäse zu fristen. Als der Wandersgeselle Reusch zu Ihnen trifft, läßt man sich im tiefsten Absinthrausch auf ein dunkles Ritual ein und stellt eine Strohpuppe her, das Sennentuntschi, um sich in der Nacht mit ihr zu vergnügen.
Als am nächsten Morgen tatsächlich eine lebendige Frau im Stall auftaucht, nehmen die Dinge Ihren folgenschweren Lauf....
So handwerklich solide dieses schweizer Kleinod allerdings auch ausgefallen ist, hat es meines Erachtens in seiner Dramaturgie den entscheidenden Fehler gemacht, die Anfangs ausgelegten Fährten aus dem Bereich den unheimlichen und mystischen, die noch zu Unbehagen geführt haben, nicht weiter auszubauen, sondern diese im Laufe des Films einer zunehmenden Profanisierung zu opfern.
Damit fällt die Spannung zum Ende zur allgemeinen Enttäuschung eher ab als sich zu steigern und viele Erwartungen werden so enttäuscht.
Abgesehen von diesem dramaturgischen Kardinalfehler, erlaubt sich der Film aber keine weiteren Schnitzer und gewährt so einen Blick auf die unter einer spröden Schale steckenden und so kaum für möglich gehaltenen dunkle Seite der Seele des Eidgenossen.
mit 4
mit 4
mit 4
mit 3
bewertet am 27.03.12 um 11:23
Nettes Feierabendfutter ohne Risiken und Nachwirkungen!
Dick Maas setzt der honigkuchensüßen Verschnulzung des Nikolauskultes eine bitterböse Alternative entgegen: Anstatt die Kinder am 6 Dezember reichlich mit Gaben zu beschenken, wandelt der untote Nikolaus alle 23 Jahre bei Vollmond durch die Gassen Hollands, um sich dafür zu rächen, in mittelalerlicher Vergangenheit von einer aufgebrachten Meute auf seinem Schoner verbrannt worden zu sein.
Das einzige, was die Kinder seit jener Nacht wirklich geschenkt bekommen, ist der Tod. Da die Zeit für seine Rache mit einer halben Nacht sehr knapp bemessen ist, bleibt dem Nikolaus und seinem Todesschwadron auch nicht viel Zeit für subtile Spielchen. Stattdessen bahnt er sich in bester Hack and Slay Manier durch die Kinderzimmer Amsterdams, und macht dabei auch vor den süßesten Frätzchen und den Bewohnern nicht halt, die mal irgendwann Kinder gewesen sind.
Passagenweise geschieht das atmosphärisch sehr ambitioniert, meistens aber zu routiniert, als das es wirklich fesseln würde. Auch wenn die Slasherscenen dem Mtzgermeister höchstpersönlich alle Ehre machen würden, muß sich Saint den Vorwurf gefallen lassen, nicht sonderlich spannend zu sein und auch den humoristischen Ansatz nicht konsequent genug zu verfolgen, um nachhaltig Wirkung zu erzielen.
So bleibt der Film unterm Strich nichts Halbes und nichts Ganzes, ist aber auf Grund seiner soliden Inszenierung allemal sehenswert und sollte in keiner Einschulungstüte zur seelischen Ertüchtigung unserer iDötzchen fehlen!
Dick Maas setzt der honigkuchensüßen Verschnulzung des Nikolauskultes eine bitterböse Alternative entgegen: Anstatt die Kinder am 6 Dezember reichlich mit Gaben zu beschenken, wandelt der untote Nikolaus alle 23 Jahre bei Vollmond durch die Gassen Hollands, um sich dafür zu rächen, in mittelalerlicher Vergangenheit von einer aufgebrachten Meute auf seinem Schoner verbrannt worden zu sein.
Das einzige, was die Kinder seit jener Nacht wirklich geschenkt bekommen, ist der Tod. Da die Zeit für seine Rache mit einer halben Nacht sehr knapp bemessen ist, bleibt dem Nikolaus und seinem Todesschwadron auch nicht viel Zeit für subtile Spielchen. Stattdessen bahnt er sich in bester Hack and Slay Manier durch die Kinderzimmer Amsterdams, und macht dabei auch vor den süßesten Frätzchen und den Bewohnern nicht halt, die mal irgendwann Kinder gewesen sind.
Passagenweise geschieht das atmosphärisch sehr ambitioniert, meistens aber zu routiniert, als das es wirklich fesseln würde. Auch wenn die Slasherscenen dem Mtzgermeister höchstpersönlich alle Ehre machen würden, muß sich Saint den Vorwurf gefallen lassen, nicht sonderlich spannend zu sein und auch den humoristischen Ansatz nicht konsequent genug zu verfolgen, um nachhaltig Wirkung zu erzielen.
So bleibt der Film unterm Strich nichts Halbes und nichts Ganzes, ist aber auf Grund seiner soliden Inszenierung allemal sehenswert und sollte in keiner Einschulungstüte zur seelischen Ertüchtigung unserer iDötzchen fehlen!
mit 3
mit 4
mit 3
mit 2
bewertet am 27.03.12 um 11:20
Norwegian Ninja ist eine Trashfilmagentenparodie, die sich um einige historische Ereignisse herum aufbaut. Die Handlung im einzelnen wiederzugeben macht nicht viel Sinn, da sie absichtlich dilettantisch konfus inszeniert wurde.
Im Groben mag es aber wohl um eine Geheimorganisation gehen, die in Norwegen Anschläge verübt, um sie den Russen in die Schuhe zu schieben, nur damit die Amerikaner intervenieren, um...ja, warum eigentlich?, und die Eliteeinheit des Norwegischen Königs, die Ninjas, die diese Geheimorganisation bekämpfen soll, um...ja, warum eigentlich?
Viele Handlungen bleiben nämlich bis zum Ende unklar, bzw. widersprechen sich selbst. Da aber schon in den ersten Minuten klargestellt wird, wohin der Hase läuft, daß man diesen Film nämlich bitteschön nicht im Ansatz ernst nehmen möge, stört dies überhaupt nicht, sondern ist, im Gegenteil, gewolltes Stilmittel.
Norwegian Ninja möchte in erster (und einziger) Linie nichts weiter als dem Trashfilm huldigen und Spaß verbreiten. Und wenn dabei die Logik im Wege steht: Fort damit.
So wimmelt es dann auch von hohlen Erleuchtungsphrasen, albernen Ehrenkodexen, billigen Plastikmodellen, erbärmlichen Kameratricks, traurigen Spezialeffekten und verblichenem Filmmaterial, daß meiner alten Diasammlung zu aller Ehre gereichen würde.
Leider muß man aber auch bei Norwegian Ninja erneut feststellen, was auch für alle anderen Trashfilmreferenzen gilt: Der Trashfaktor, der sich daraus ergibt, daß die Filmemacher es früher wirklich nicht besser konnten, kann durch keine noch so lieb gemeinte Reproduktion erzeugt werden. Das ergötzen an stümperhafter Inszenierung und grottenschlechter Handlung, sowie die Frechheit aber auch den Mut, für so etwas auch noch Geld zu verlangen, wird nun mal auf ewig mit den Exploitationfilmen der 70er Jahre in Verbindung bleiben.
Dennoch muß man Norwegian Ninja attestieren, jenen Zeitgeist sehr gut eingefangen zu haben. So erinnert die Insel der Ninjas, die mit ihre verworrenen Esoterik Philosophie, ihrer Feng Shui Abwehrkanone, sowie dem trauten Miteinander mit den Tieren des Waldes, sehr an das verwirklichte Ideal einer Hippiekommune aus den 70ern.
So ist Regisseur Thomas Cappelen Malling denn auch zu bescheinigen, eine überzeugende Huldigung an die B-Movies aus den 70ern geglückt zu sein, die sich aber dennoch, trotz vieler gelungenen Parodien und Seitenhiebe auf die auf die Blütejahre der Trashfilmära, den Vorwurf gefallen lassen muß, zwar kongenial den Charme dieser Filme eigefangen zu haben, aber leider nicht mit eigenem Witz punkten zu können.
Und damit ist der Unterhaltungswert nur mittelmäßig!
Im Groben mag es aber wohl um eine Geheimorganisation gehen, die in Norwegen Anschläge verübt, um sie den Russen in die Schuhe zu schieben, nur damit die Amerikaner intervenieren, um...ja, warum eigentlich?, und die Eliteeinheit des Norwegischen Königs, die Ninjas, die diese Geheimorganisation bekämpfen soll, um...ja, warum eigentlich?
Viele Handlungen bleiben nämlich bis zum Ende unklar, bzw. widersprechen sich selbst. Da aber schon in den ersten Minuten klargestellt wird, wohin der Hase läuft, daß man diesen Film nämlich bitteschön nicht im Ansatz ernst nehmen möge, stört dies überhaupt nicht, sondern ist, im Gegenteil, gewolltes Stilmittel.
Norwegian Ninja möchte in erster (und einziger) Linie nichts weiter als dem Trashfilm huldigen und Spaß verbreiten. Und wenn dabei die Logik im Wege steht: Fort damit.
So wimmelt es dann auch von hohlen Erleuchtungsphrasen, albernen Ehrenkodexen, billigen Plastikmodellen, erbärmlichen Kameratricks, traurigen Spezialeffekten und verblichenem Filmmaterial, daß meiner alten Diasammlung zu aller Ehre gereichen würde.
Leider muß man aber auch bei Norwegian Ninja erneut feststellen, was auch für alle anderen Trashfilmreferenzen gilt: Der Trashfaktor, der sich daraus ergibt, daß die Filmemacher es früher wirklich nicht besser konnten, kann durch keine noch so lieb gemeinte Reproduktion erzeugt werden. Das ergötzen an stümperhafter Inszenierung und grottenschlechter Handlung, sowie die Frechheit aber auch den Mut, für so etwas auch noch Geld zu verlangen, wird nun mal auf ewig mit den Exploitationfilmen der 70er Jahre in Verbindung bleiben.
Dennoch muß man Norwegian Ninja attestieren, jenen Zeitgeist sehr gut eingefangen zu haben. So erinnert die Insel der Ninjas, die mit ihre verworrenen Esoterik Philosophie, ihrer Feng Shui Abwehrkanone, sowie dem trauten Miteinander mit den Tieren des Waldes, sehr an das verwirklichte Ideal einer Hippiekommune aus den 70ern.
So ist Regisseur Thomas Cappelen Malling denn auch zu bescheinigen, eine überzeugende Huldigung an die B-Movies aus den 70ern geglückt zu sein, die sich aber dennoch, trotz vieler gelungenen Parodien und Seitenhiebe auf die auf die Blütejahre der Trashfilmära, den Vorwurf gefallen lassen muß, zwar kongenial den Charme dieser Filme eigefangen zu haben, aber leider nicht mit eigenem Witz punkten zu können.
Und damit ist der Unterhaltungswert nur mittelmäßig!
mit 3
mit 3
mit 3
mit 3
bewertet am 26.03.12 um 11:58
Der Mittler (The Go Between) ist eine englische Literaturverfilmung aus dem Jahre 1971 und widmet sich in erster Linie der Schilderung des Lebensstils der feudalen Kaste um die Jahrhundertwende (1900) im edwardianischen Großbritanien.
Der aus gewöhnlichen Verhältnissen stammende 12 jährige Knabe Leo verbringt die Sommerferien im herrschaftlichen Anwesen seines Schulfreundes Marcus, welches in den weitläufigen Landschaften Norfolks thront.
In dieser Atmosphäre der gediegenen Langeweile und des organisierten Müßiggangs, bringt die "Attraktion" Leo etwas frischen Wind in das durch stocksteife Umgangsformen verkrustete Domizil von Marcus Eltern und dessen Verwandten.
Gerne läßt man sich von Leo amüsieren und sonnt sich im aristokratischen Gönnertum.
Aber das Leben läßt sich nun nicht mal mit Konventionen einfangen und der elitäre Cirkel erweist sich als weniger Schottendicht, als zu wünschen ist.
Die Schwester Marcus', Lady Trimingham (Judie Christie), unterhält eine Beziehung zu einem benachbarten Farmer, von der die hohe Gesellschaft nichts erfahren darf.
Da bei jedem Kontakt der verschiedenen Gesellschaftsschichten die Überlegenheit des Adels demonstriert wird, ist eine Vermischung der Verhältnisse verpönt und kommt einem undenkbaren Skandal gleich.
So ist die Verlobung Lady Triminghams und eines auf dem Anwesen gastierenden Lords denn auch über ihren Kopf hinweg schon beschloßene Sache.
Da kommt ihr die plötzliche Masernerkrankung ihres Bruders Marcus gerade richtig: Nun hat sie in Leo einen Laufburschen, mit dem sie den heimlichen Briefverkehr zwischen sich und dem Farmer Ted (Alan Bates) aufrecht erhalten kann.
Leo, anfänglich noch sehr enthusiastisch, fällt doch auch ein wenig von der Verliebtheit Lady Triminghams für ihn ab, bemerkt zu spät, daß er bloß zum Spielball des Pärchens geworden ist. An seinem 13ten Geburtstag wird er mit seiner Rolle als Geheimnisträger überfordert und es kommt zur Katastrophe bei der er sich emotionale Wunden zuzieht, die sein Leben lang nicht heilen werden.
Standesgemäß wurde auf die Bedürfnisse weniger privilgierter Personen nicht geachtet, da dies auf Kosten der gewünschten Dienste gehen würde.
So scheitert Lady Trimingham letztlich an ihren Egoismen, mit denen sie sich zwar über die erstarrten Konventionen ihrer Zeit hinwegsetzen konnte, deren elitäre Attitüden für ihr Umfeld aber nur Verderben brachten.
Aber Vorsicht! Man darf hier kein herzzereißendes Melodram ala vom Winde verweht erwarten. Auch wenn viele Zutaten für ein packendes Beziehungsdrama vorhanden sind und die vorhandenen Allegorien, z.b. der Hang Leos zur schwarzen Magie und Beschwörung dunkler Mächte, quasi nach einer fatalistisch mystischen Interpretation des Gesehenen geradezu schreien um auf eine zweite, poetischere Bedeutungsebene zu verweisen, ist Der Mittler in erster Linie jedoch ein handwerkliches Paradestück, daß vor allem als Gesellschafts- und Zeitgemälde zu überzeugen weiß, welches in dieser Hinsicht qualitativ den Vergleich mit Visconti's "Der Leopard" nicht zu scheuen braucht.
Die lähmende Atmosphäre der Sommerschwüle und die quälende Steifheit des Dresscodes und Tagesablaufes sind auf den Punkt nachvollziehbar eingefangen und erinnern in ihrer Präzision an das semidokumentarische Werk "Das weiße Band", welches ungefähr im selben Zeitraum angesiedelt ist.
Und ähnlich wie beim weißen Band liegt auch genau hier der Hase im Pfeffer begraben:
So gekonnt vergangene Epochen wieder zum Leben erweckt und die Beklemmungen der Lebensweisen wieder spürbar gemacht wurden, so sehr sprechen sie in ihrer handwerklichen Perfektion mehr den Verstand als das Gemüt an.
So sehr die Zurschaustellung der Behäbigkeit des Lebenstempos um die Jahrhundertwende als historische Erfahrung zu gefallen mag, so sehr unterhält diese kunstvolle Art der Inszenierung nur bedingt. Zu langsam kämpft sich die Geschichte durch das langweilige und ziellose durch den Tag tafeln einem spannungsgeladenen Plot entgegen und zu schwach kann sich die Handlung aus der Form schälen, als daß dies sich nicht auf das Gemüt des Zuschauers niederschlagen würde und er sich der bleiernden Schwere der gesellschaftlichen Fesseln entziehen könnte.
Lady Trimingham kann dem von Plattitüden dominierten Leben kurzfristig in den Armen von ihrem vor Leben vibrierenden und unbändige Freiheit verkörpernden Freund noch kurzfristig entkommen. Dem Zuschauer ist dies nicht vergönnt.
Ihm bleibt nur die Möglichkeit sich in dieser Antipode des modernen Blockbusterkinos an der oppulenten Inszenierung und den weitläufigen, sanften Feld- und Wiesenlandschaften zu berauschen, oder Leo bei seinen ersten Schritten aus der verzauberten Welt der Kindheit in die ernüchterte Welt der Erwachsenen zu begleiten.
Egal wofür man sich entscheided, was trotz aller Kritikpunkte bleibt ist ein Gefühl der Dankbarkeit für diese filmische Oase, in einer Ära der Veränderungen im Zeitraffertempo.
Das Bild ist (altersentsprechend) nahezu perfekt und der Ton ist jederzeit gut verständlich.
Der aus gewöhnlichen Verhältnissen stammende 12 jährige Knabe Leo verbringt die Sommerferien im herrschaftlichen Anwesen seines Schulfreundes Marcus, welches in den weitläufigen Landschaften Norfolks thront.
In dieser Atmosphäre der gediegenen Langeweile und des organisierten Müßiggangs, bringt die "Attraktion" Leo etwas frischen Wind in das durch stocksteife Umgangsformen verkrustete Domizil von Marcus Eltern und dessen Verwandten.
Gerne läßt man sich von Leo amüsieren und sonnt sich im aristokratischen Gönnertum.
Aber das Leben läßt sich nun nicht mal mit Konventionen einfangen und der elitäre Cirkel erweist sich als weniger Schottendicht, als zu wünschen ist.
Die Schwester Marcus', Lady Trimingham (Judie Christie), unterhält eine Beziehung zu einem benachbarten Farmer, von der die hohe Gesellschaft nichts erfahren darf.
Da bei jedem Kontakt der verschiedenen Gesellschaftsschichten die Überlegenheit des Adels demonstriert wird, ist eine Vermischung der Verhältnisse verpönt und kommt einem undenkbaren Skandal gleich.
So ist die Verlobung Lady Triminghams und eines auf dem Anwesen gastierenden Lords denn auch über ihren Kopf hinweg schon beschloßene Sache.
Da kommt ihr die plötzliche Masernerkrankung ihres Bruders Marcus gerade richtig: Nun hat sie in Leo einen Laufburschen, mit dem sie den heimlichen Briefverkehr zwischen sich und dem Farmer Ted (Alan Bates) aufrecht erhalten kann.
Leo, anfänglich noch sehr enthusiastisch, fällt doch auch ein wenig von der Verliebtheit Lady Triminghams für ihn ab, bemerkt zu spät, daß er bloß zum Spielball des Pärchens geworden ist. An seinem 13ten Geburtstag wird er mit seiner Rolle als Geheimnisträger überfordert und es kommt zur Katastrophe bei der er sich emotionale Wunden zuzieht, die sein Leben lang nicht heilen werden.
Standesgemäß wurde auf die Bedürfnisse weniger privilgierter Personen nicht geachtet, da dies auf Kosten der gewünschten Dienste gehen würde.
So scheitert Lady Trimingham letztlich an ihren Egoismen, mit denen sie sich zwar über die erstarrten Konventionen ihrer Zeit hinwegsetzen konnte, deren elitäre Attitüden für ihr Umfeld aber nur Verderben brachten.
Aber Vorsicht! Man darf hier kein herzzereißendes Melodram ala vom Winde verweht erwarten. Auch wenn viele Zutaten für ein packendes Beziehungsdrama vorhanden sind und die vorhandenen Allegorien, z.b. der Hang Leos zur schwarzen Magie und Beschwörung dunkler Mächte, quasi nach einer fatalistisch mystischen Interpretation des Gesehenen geradezu schreien um auf eine zweite, poetischere Bedeutungsebene zu verweisen, ist Der Mittler in erster Linie jedoch ein handwerkliches Paradestück, daß vor allem als Gesellschafts- und Zeitgemälde zu überzeugen weiß, welches in dieser Hinsicht qualitativ den Vergleich mit Visconti's "Der Leopard" nicht zu scheuen braucht.
Die lähmende Atmosphäre der Sommerschwüle und die quälende Steifheit des Dresscodes und Tagesablaufes sind auf den Punkt nachvollziehbar eingefangen und erinnern in ihrer Präzision an das semidokumentarische Werk "Das weiße Band", welches ungefähr im selben Zeitraum angesiedelt ist.
Und ähnlich wie beim weißen Band liegt auch genau hier der Hase im Pfeffer begraben:
So gekonnt vergangene Epochen wieder zum Leben erweckt und die Beklemmungen der Lebensweisen wieder spürbar gemacht wurden, so sehr sprechen sie in ihrer handwerklichen Perfektion mehr den Verstand als das Gemüt an.
So sehr die Zurschaustellung der Behäbigkeit des Lebenstempos um die Jahrhundertwende als historische Erfahrung zu gefallen mag, so sehr unterhält diese kunstvolle Art der Inszenierung nur bedingt. Zu langsam kämpft sich die Geschichte durch das langweilige und ziellose durch den Tag tafeln einem spannungsgeladenen Plot entgegen und zu schwach kann sich die Handlung aus der Form schälen, als daß dies sich nicht auf das Gemüt des Zuschauers niederschlagen würde und er sich der bleiernden Schwere der gesellschaftlichen Fesseln entziehen könnte.
Lady Trimingham kann dem von Plattitüden dominierten Leben kurzfristig in den Armen von ihrem vor Leben vibrierenden und unbändige Freiheit verkörpernden Freund noch kurzfristig entkommen. Dem Zuschauer ist dies nicht vergönnt.
Ihm bleibt nur die Möglichkeit sich in dieser Antipode des modernen Blockbusterkinos an der oppulenten Inszenierung und den weitläufigen, sanften Feld- und Wiesenlandschaften zu berauschen, oder Leo bei seinen ersten Schritten aus der verzauberten Welt der Kindheit in die ernüchterte Welt der Erwachsenen zu begleiten.
Egal wofür man sich entscheided, was trotz aller Kritikpunkte bleibt ist ein Gefühl der Dankbarkeit für diese filmische Oase, in einer Ära der Veränderungen im Zeitraffertempo.
Das Bild ist (altersentsprechend) nahezu perfekt und der Ton ist jederzeit gut verständlich.
mit 3
mit 4
mit 3
mit 3
bewertet am 17.03.12 um 19:26
Nicolas Winding Refns (Walhalla Risingg) Streifzug durch die Kopenhagener Halbwelt zeichnet sich weniger durch komplexe Handlung oder furiose Action aus, als vielmehr durch die Charakterstudie der Protagonisten und versucht so ein Stimmungsbild des Drogenmillieus zu erzeugen.
In allen drei Teilen geht es dabei um geplatzte Drogendeals, gepanschten Stoff und um die Streifzüge der Kleindealer, die verzweifelt versuchen Geld aufzutreiben um es sich mit Ihren Bossen und Lieferanten nicht zu verscherzen.
Da hier die Moral aber von Nehmen ist seliger als Geben und Kauf auf Pump geprägt ist, ist niemand wirklich flüßig, bekommen aber alle, ganz bestimmt gleich Morgen, angeblich immer noch von irgend jemanden eine ganze Stange Geld. So werden die Bemühungen Rechnungen auszugleichen zur verzweifelten Sysyphusarbeit.
Begleitet werden die Ritte ins Verderben von jeder Menge Drogen, Leichen und Prostituierten, so daß der Zuschauer sich ein ungefähres Bild vom Leben Kopenhagener Kleinkrimineller machen kann.
Das dabei einiges etwas überzeichnet ist und wie die unterkühlte Variante von Trainspotting wirkt, ist dem Unterhaltungswert durchaus zuträglich und hauptsächlich dem Losertypen Tonny (Mads Mikkelsen) zu verdanken.
Auch dürfte das unerwartete Eingreifen des Schicksals in die Verquickungen der Betäubungsmitteleinzelhändle r untereinander, der einen oder anderen Breaking Bad Folge als Inspiration gedient haben.
Obwohl also alle Zutaten für ein packendes Gangsterdrama vorhanden sind, nehmen die Filme dadurch kaum an Fahrt auf und treiben die Handlung nur sehr zögerlich voran.
Das Hauptaugenmerk liegt nämlich eindeutig bei der Entwicklung der Charaktere und des Studiums Ihres Umfeldes, um so den Zuschauer möglichst nahe am Geschehen teilhaben und ihm die dort vorhandenen destruktiven Energien spüren zu lassen.
In erster Linie erreichte Refn dies durch eine genaue Vorbereitung auf den Film, indem er sich eine Zeitlang an die Versen von Dealern und Zuhältern heftete und versuchte den Habitus und die sozialen Kodexe der kriminellen Emigranten zu entschlüßeln und auf die Leinwand zu übertragen.
Was den Film aber in erster Linie auszeichnet, sind die charismatischen Darsteller!
Viele von Ihnen hat Refn von der Straße, bzw. aus dem jeweiligen Umfeld heraus gecastet. Dadurch wird eine halbdokumentarische Wirkung erreicht, da man den Gangstern und Gangmitgliedern sofort abnimmt, daß sie wissen wovon sie reden, daß sie nicht bloß schauspielen, sondern einfach ihre Wirklichkeit nachahmen und ihre reine Präsenz genau die selbe unangenehm bedrohliche Wirkung erzeugt, die man in der Umgebung von echten Verbrechern und Schlägern spüren würde.
So fällt auch der sonst eher störende, sich vom gewohnten Kinobild emanzipierende Filmlook weniger ins Gewicht, der, zumindest im zweiten und dritten Teil, mit seiner Videokameraästhetik sehr an billig produzierte Lindenstraße oder GZSZ Serien erinnert und, auch durch seine gewollte Grieseligkeit, bemüht ist dokumentarisch zu wirken: Die Charaktere sorgen mit ihrer psychopathischen, abstoßenden oder starken Persönlichkeit für ausreichend Faszination, um diese gewöhnungsbedürftigen Stilmittel weit in den Hintergrund zu drängen.
Unterm Strich läßt sich also sagen, daß sich bei Pusher derjenige gut aufgehoben fühlen dürfte, der sich auf ein von effekthascherischen Mitteln entkerntes Programmkino einlassen kann und sich mit voyeuristischer Freude vom Leben am Rande der Gesellschaft ermuntern oder einschüchtern lassen will.
Cleanen Junkies, meditierenden Vegetariern, Pastorentöchtern und Multkulti Aposteln sei der Film weniger ans Herz gelegt.
Zum Bild: Der Griesellok ist laut dem überflüßigen 2 seitigen beiliegendem Booklet (eher ein Werbeflyer) gewollt, um das Erscheinungbild von Pusher, dem Millieu entsprechend, zu verschmuddeln.
Das Bild des ersten Teils kann jedoch auf Grund der Unschärfe und Verschmierung nur als Frechheit bezeichnet werden. Hat die Vertriebsfirma noch etwas Rückgrat im Kadaver, legt sie die Scheibe neu auf und tauscht sie um. Die Pfusher!
In allen drei Teilen geht es dabei um geplatzte Drogendeals, gepanschten Stoff und um die Streifzüge der Kleindealer, die verzweifelt versuchen Geld aufzutreiben um es sich mit Ihren Bossen und Lieferanten nicht zu verscherzen.
Da hier die Moral aber von Nehmen ist seliger als Geben und Kauf auf Pump geprägt ist, ist niemand wirklich flüßig, bekommen aber alle, ganz bestimmt gleich Morgen, angeblich immer noch von irgend jemanden eine ganze Stange Geld. So werden die Bemühungen Rechnungen auszugleichen zur verzweifelten Sysyphusarbeit.
Begleitet werden die Ritte ins Verderben von jeder Menge Drogen, Leichen und Prostituierten, so daß der Zuschauer sich ein ungefähres Bild vom Leben Kopenhagener Kleinkrimineller machen kann.
Das dabei einiges etwas überzeichnet ist und wie die unterkühlte Variante von Trainspotting wirkt, ist dem Unterhaltungswert durchaus zuträglich und hauptsächlich dem Losertypen Tonny (Mads Mikkelsen) zu verdanken.
Auch dürfte das unerwartete Eingreifen des Schicksals in die Verquickungen der Betäubungsmitteleinzelhändle r untereinander, der einen oder anderen Breaking Bad Folge als Inspiration gedient haben.
Obwohl also alle Zutaten für ein packendes Gangsterdrama vorhanden sind, nehmen die Filme dadurch kaum an Fahrt auf und treiben die Handlung nur sehr zögerlich voran.
Das Hauptaugenmerk liegt nämlich eindeutig bei der Entwicklung der Charaktere und des Studiums Ihres Umfeldes, um so den Zuschauer möglichst nahe am Geschehen teilhaben und ihm die dort vorhandenen destruktiven Energien spüren zu lassen.
In erster Linie erreichte Refn dies durch eine genaue Vorbereitung auf den Film, indem er sich eine Zeitlang an die Versen von Dealern und Zuhältern heftete und versuchte den Habitus und die sozialen Kodexe der kriminellen Emigranten zu entschlüßeln und auf die Leinwand zu übertragen.
Was den Film aber in erster Linie auszeichnet, sind die charismatischen Darsteller!
Viele von Ihnen hat Refn von der Straße, bzw. aus dem jeweiligen Umfeld heraus gecastet. Dadurch wird eine halbdokumentarische Wirkung erreicht, da man den Gangstern und Gangmitgliedern sofort abnimmt, daß sie wissen wovon sie reden, daß sie nicht bloß schauspielen, sondern einfach ihre Wirklichkeit nachahmen und ihre reine Präsenz genau die selbe unangenehm bedrohliche Wirkung erzeugt, die man in der Umgebung von echten Verbrechern und Schlägern spüren würde.
So fällt auch der sonst eher störende, sich vom gewohnten Kinobild emanzipierende Filmlook weniger ins Gewicht, der, zumindest im zweiten und dritten Teil, mit seiner Videokameraästhetik sehr an billig produzierte Lindenstraße oder GZSZ Serien erinnert und, auch durch seine gewollte Grieseligkeit, bemüht ist dokumentarisch zu wirken: Die Charaktere sorgen mit ihrer psychopathischen, abstoßenden oder starken Persönlichkeit für ausreichend Faszination, um diese gewöhnungsbedürftigen Stilmittel weit in den Hintergrund zu drängen.
Unterm Strich läßt sich also sagen, daß sich bei Pusher derjenige gut aufgehoben fühlen dürfte, der sich auf ein von effekthascherischen Mitteln entkerntes Programmkino einlassen kann und sich mit voyeuristischer Freude vom Leben am Rande der Gesellschaft ermuntern oder einschüchtern lassen will.
Cleanen Junkies, meditierenden Vegetariern, Pastorentöchtern und Multkulti Aposteln sei der Film weniger ans Herz gelegt.
Zum Bild: Der Griesellok ist laut dem überflüßigen 2 seitigen beiliegendem Booklet (eher ein Werbeflyer) gewollt, um das Erscheinungbild von Pusher, dem Millieu entsprechend, zu verschmuddeln.
Das Bild des ersten Teils kann jedoch auf Grund der Unschärfe und Verschmierung nur als Frechheit bezeichnet werden. Hat die Vertriebsfirma noch etwas Rückgrat im Kadaver, legt sie die Scheibe neu auf und tauscht sie um. Die Pfusher!
mit 4
mit 3
mit 3
mit 2
bewertet am 04.03.12 um 14:58
Erster Paukenschlag des 80er Jahre Horrorfilms, in dem die Maskenbildner das Ruder übernahmen. Hatte man bis Dato im Monsterfilm nur mehr oder weniger gruselige bis alberne Halloweenmasken zur Verfügung, gelang es durch den Einsatz von komplizierter Mechanik und pneumatisch manipulierbaren Latekkostümen erstmals in "Das Tier", durch eine in Echtzeit präsentierte Verwandlung eines Menschen in einen Werwolf, diesem Fabelwesen Leben einzuhauchen.
Und auch Heute noch überzeugen die mit viel Liebe zum Detail und Sinn fürs Schauderhafte ausgestatten Verwandlungsscenen, die vielen modernen CGI Effekten wegen ihrer realen Existenz, in Punkto Gruselfaktor immer noch den Rang ablaufen.
Den Höhepunkt dieser Kunst setzte Bottin wohl ein paar Jahre später mit Das Ding, der auch Heute noch unerreicht ist.
Der Plot war in Sachen Inszenierung und Tempo auf der Höhe seiner Zeit, wurde von einer begabten Schauspielertruppe mit der notwendigen Ernsthaftigkeit umgesetzt, hat aber nichts desto trotz im Vergleich zu aktuellen Produktionen an Fahrt verloren.
Alles in allem läßt sich aber sagen, daß der Zahn der Zeit nur wenig an dem Film genagt hat und wohl immer noch den einen oder anderen Horrorfilmnovizen mit Alpdruck zu Bette schicken dürfte.
Das Bild ist bis auf wenige gelungene Nahaufnahmen grottenschlecht und wirkt bisweilen so schmierig wie das schlechte alte VHS Signal.
Sammlern sei daher mit gutem Gewissen die DVD ans Herz gelegt, zumahl diese, selten gesehen, um einige Stop Motion Sequenzen erweitert wurde, die selbst im Kinofilm nicht zu sehen waren, da Dante sie im Vergleich zu den real wirkenden Latexkostümen zu künstlich fand. Es passieren doch noch Wunder...
Und auch Heute noch überzeugen die mit viel Liebe zum Detail und Sinn fürs Schauderhafte ausgestatten Verwandlungsscenen, die vielen modernen CGI Effekten wegen ihrer realen Existenz, in Punkto Gruselfaktor immer noch den Rang ablaufen.
Den Höhepunkt dieser Kunst setzte Bottin wohl ein paar Jahre später mit Das Ding, der auch Heute noch unerreicht ist.
Der Plot war in Sachen Inszenierung und Tempo auf der Höhe seiner Zeit, wurde von einer begabten Schauspielertruppe mit der notwendigen Ernsthaftigkeit umgesetzt, hat aber nichts desto trotz im Vergleich zu aktuellen Produktionen an Fahrt verloren.
Alles in allem läßt sich aber sagen, daß der Zahn der Zeit nur wenig an dem Film genagt hat und wohl immer noch den einen oder anderen Horrorfilmnovizen mit Alpdruck zu Bette schicken dürfte.
Das Bild ist bis auf wenige gelungene Nahaufnahmen grottenschlecht und wirkt bisweilen so schmierig wie das schlechte alte VHS Signal.
Sammlern sei daher mit gutem Gewissen die DVD ans Herz gelegt, zumahl diese, selten gesehen, um einige Stop Motion Sequenzen erweitert wurde, die selbst im Kinofilm nicht zu sehen waren, da Dante sie im Vergleich zu den real wirkenden Latexkostümen zu künstlich fand. Es passieren doch noch Wunder...
mit 4
mit 2
mit 3
mit 2
bewertet am 28.02.12 um 10:57
Das Kabinett des Schreckens ist voll und ganz ein Kind seiner Zeit. Der harte Horrorfilm führte in den 80ern mehr und mehr ein Nischendasein und wurde durch perfektionierte Tricktechnik und monströse Latexmasken ersetzt..
So punktet der Film auch nicht mit übermäßiger Spannung, sondern setzt mehr auf abstoßendes Creature Design und sparsam dosierte Schockmomente.
Nachdem eine Gruppe Teenager 45min. über die Kirmes getrödelt ist und dabei einer Handvoll schrulliger Gestalten, vermutlich um beim Zuschauer ein mulmiges Gefühl zu erzeugen, begegnet ist, verschanzt sie sich Nachts zum Spaß und Fummeln in einer Geisterbahn und wird dort Zeuge eines Mordes. Der Mörder wittert Lunte und macht sich nun mit seinem Vater auf die Jagd durch die Geisterbahn, um die Eindringlinge zu liquidieren.
Nachdem also die erste Filmhälfte vertrödelt wurde, kommt allmählich etwas Spannung auf. Diese basiert aber hauptsächlich auf der Tatsache, daß man in der Dunkelheit um die Armeen von Skeletten und Spukgestalten herum, nicht genau weiß, wo sich Hase und Igel, sprich Jäger und Gejagte eigentlich genau befinden. So kann man denn wegen dieses einfachen inszenatorischen Kniffes auch fast eher von einem Krimi sprechen, als von einem Horrorfilm. Wären da nicht die 3-4 Schockmomente.
Da diese optisch zwar in die Kategorie des Splatters einzuorden sind, jedoch mehr amüsieren als gruseln, verläßt man den Film denn auch wieder so entspannt und streßfrei wie nach einen Besuch in der Geisterbahn.
Vermutlich wäre der Film auf Grund seines milden Unterhaltungswertes, der sich vom Niveau her nahtlos in die "Geschichten aus der Gruft" einfügt und als Kurzfilm wohl besser funktioniert hätte, auch nur noch eingefleischten Kennern im Gedächtnis, wäre er nicht von Tobe Hooper (TCM), worauf auch immer wieder besonders herumgeritten wird, inszeniert worden.
Wer also harte Kost bevorzugt, sollte tunlichst die Finger von diesem Werk lassen, wer aber an der Entwicklung des charmanten 80er Jahre Horrors und der Vorbereitung stilistisch ähnlicher Werke Hoopers, Poltergeist und Lifeforce, interessiert ist, kommt an "Funhouse" nicht vorbei.
So punktet der Film auch nicht mit übermäßiger Spannung, sondern setzt mehr auf abstoßendes Creature Design und sparsam dosierte Schockmomente.
Nachdem eine Gruppe Teenager 45min. über die Kirmes getrödelt ist und dabei einer Handvoll schrulliger Gestalten, vermutlich um beim Zuschauer ein mulmiges Gefühl zu erzeugen, begegnet ist, verschanzt sie sich Nachts zum Spaß und Fummeln in einer Geisterbahn und wird dort Zeuge eines Mordes. Der Mörder wittert Lunte und macht sich nun mit seinem Vater auf die Jagd durch die Geisterbahn, um die Eindringlinge zu liquidieren.
Nachdem also die erste Filmhälfte vertrödelt wurde, kommt allmählich etwas Spannung auf. Diese basiert aber hauptsächlich auf der Tatsache, daß man in der Dunkelheit um die Armeen von Skeletten und Spukgestalten herum, nicht genau weiß, wo sich Hase und Igel, sprich Jäger und Gejagte eigentlich genau befinden. So kann man denn wegen dieses einfachen inszenatorischen Kniffes auch fast eher von einem Krimi sprechen, als von einem Horrorfilm. Wären da nicht die 3-4 Schockmomente.
Da diese optisch zwar in die Kategorie des Splatters einzuorden sind, jedoch mehr amüsieren als gruseln, verläßt man den Film denn auch wieder so entspannt und streßfrei wie nach einen Besuch in der Geisterbahn.
Vermutlich wäre der Film auf Grund seines milden Unterhaltungswertes, der sich vom Niveau her nahtlos in die "Geschichten aus der Gruft" einfügt und als Kurzfilm wohl besser funktioniert hätte, auch nur noch eingefleischten Kennern im Gedächtnis, wäre er nicht von Tobe Hooper (TCM), worauf auch immer wieder besonders herumgeritten wird, inszeniert worden.
Wer also harte Kost bevorzugt, sollte tunlichst die Finger von diesem Werk lassen, wer aber an der Entwicklung des charmanten 80er Jahre Horrors und der Vorbereitung stilistisch ähnlicher Werke Hoopers, Poltergeist und Lifeforce, interessiert ist, kommt an "Funhouse" nicht vorbei.
mit 3
mit 3
mit 3
mit 4
bewertet am 26.02.12 um 14:25
Nachdem der bekehrte Christ Link Jones (Gary Cooper), die Sängerin Billie (Julie London) und der Falschspieler Bassley bei einem Zugüberfall auf die Gleise geworfen wurden, macht sich die zufällig zusammengewürfelte Truppe entlang der Schienen auf den Weg zurück in die Zivilisation.
Auf dem Weg dorthin kommen sie an einer alten Farm, einem ehemaligen Wohnsitz Jones, vorbei. Dieser entpuppt sich schnell als Rückzugsort der Eisenbahnräuber. Geführt wird die Gang von Jones Onkel (fantastisch: Lee J. Cobb), welcher sich über das Wiedersehen mit seinem Neffen freut, hatten sie doch in der Vergangenheit zusammen die eine oder andere Bank überfallen und so manchen Widersacher Tod im Staube zurückgelassen.
So in der Vergangenheit schwelgend, möchte er nochmal zusammen mit Jones die gute alte Zeit auferstehen lassen und gemeinsam eine Bank überfallen.
Jones hat keine andere Wahl als gute Mine zum bösen Spiel zu machen, will er sein Leben und das seiner Begleiter retten, da die chronisch reizbare Gang alles andere als zur feinen Gesellschaft gehört, Billie von ihr zum Striptease gezwungen wird und sie auch sonst bedrohlich locker mit dem Zeigefinger am Abzug fuchtelt, und geht so zum Schein auf den Überfall ein.
Als die Bande am nächsten Morgen losreiten will, verkompliziert sich die Situation noch ein wenig, da nun wiederum Jones Neffe, der Jones damaliges Verlassen der Diebesbande um seine Seele zu läutern, garnicht lustig fand und dies ihm auch nicht verziehen hat.
Auch durchschaut er Jones Strategie, den alten Onkel mit sentimentalen Geschichten bei der Stange zu halten und die Diebe gegeneinander aufzuhetzen um so fliehen zu können, sofort, so daß die Stimmung in der Gruppe einem Pulverfass gleicht, welches förmlich darauf wartet, durch das kleinste Fehlverhalten zum explodieren gebracht zu werden.
Aus diesem Psychoduell bezieht der Film seine bis zum Schluß nicht nachlassende Spannung, von der der Zuschauer erst in den letzten Minuten in einer melancholischen Schlußeinstellung erlöst wird.
Das Knistern zwischen den einzelnen Akteuren und die ständige Präsenz des Todes sorgen hier für so viel Intensität, daß die reduzierte Handlung und die spärlich eingesetzten Westernkulissen nicht negativ auffallen, bzw. das integrieren dieser, die Dichte der Atmosphäre auch nur verwäßert hätten und somit als gewolltes Stilmittel betrachtet werden können.
Wieder einmal also beweist hier der Regisseur Anthony Mann sein Gespür für dramatische Stoffe und seine außergewöhnliche Fähigkeit sie für die Leinwand mit Spannung aufzuladen.
Aber auch wenn "Der Mann aus dem Westen" durchgehend überzeugt, so ist es dennoch nicht Manns bester Western und verliert z.b. gegenüber "Nackte Gewalt" deutlich. So ist es auch nur schwer nachzuvollziehen, weßhalb er zu den 10 besten Western aller Zeiten gezählt wird.
Wahrscheinlich ist dies wohl in dem starken Charakter Coopers begründet, der zu seiner Zeit das Gute Amerikas verkörperte wie kein zweiter: Ein bekehrter Sünder, der den Weg zurück zu Gott gefunden hat und nun aufrichtig und ehrlich, mutig, männlich und sich aufopfernd durch das Leben geht. Ein Vorbildcharakter, an dem sich die Nation aufrichten kann. Ein Held, selbst im Angesicht des Todes, berstend von Werten und Charakter...
Das Bild ist durchgehend minimal grieselig aber absolut HD würdig. Die Farbgebung ist in dezentem Technicolor gehalten und wirkt ansatzweise märchenschön, so das auch den zerfurchten Gangsterfressen noch eine schmutzige Ästhetik abgewonnen werden kann. An Extras gibt es außer dem Originaltrailer und einer Diashow noch ein beigelegtes Booklet, in dem Regielegende Godart intellekzuell über das Werk austobt.
Seine philosophische Exkursion über das Werk, das seiner Meinung nach den Western neu erfunden hat, ist mir als Laien etwas zu elitär und insidermäßig. Was nun an der und der Kamerafahrt so genial war und welche Kontrahenten man hier zum erstenmal so und so nebeneinander gesehen hat, mag wohl Filmstudenten ebenso begeistern wie Vergleiche mit der Mathematik und Querverweise auf die gesamte Literaturgeschichte, ist mir aber hohnepiepegal solange es scheppert und kracht, die Luft mit Blei gefüllt ist, der Whiskey auch schon zum Frühstück fließt, der Saloon am Ende renovierungsbedürftig ist und nicht gesungen wird.
Auf dem Weg dorthin kommen sie an einer alten Farm, einem ehemaligen Wohnsitz Jones, vorbei. Dieser entpuppt sich schnell als Rückzugsort der Eisenbahnräuber. Geführt wird die Gang von Jones Onkel (fantastisch: Lee J. Cobb), welcher sich über das Wiedersehen mit seinem Neffen freut, hatten sie doch in der Vergangenheit zusammen die eine oder andere Bank überfallen und so manchen Widersacher Tod im Staube zurückgelassen.
So in der Vergangenheit schwelgend, möchte er nochmal zusammen mit Jones die gute alte Zeit auferstehen lassen und gemeinsam eine Bank überfallen.
Jones hat keine andere Wahl als gute Mine zum bösen Spiel zu machen, will er sein Leben und das seiner Begleiter retten, da die chronisch reizbare Gang alles andere als zur feinen Gesellschaft gehört, Billie von ihr zum Striptease gezwungen wird und sie auch sonst bedrohlich locker mit dem Zeigefinger am Abzug fuchtelt, und geht so zum Schein auf den Überfall ein.
Als die Bande am nächsten Morgen losreiten will, verkompliziert sich die Situation noch ein wenig, da nun wiederum Jones Neffe, der Jones damaliges Verlassen der Diebesbande um seine Seele zu läutern, garnicht lustig fand und dies ihm auch nicht verziehen hat.
Auch durchschaut er Jones Strategie, den alten Onkel mit sentimentalen Geschichten bei der Stange zu halten und die Diebe gegeneinander aufzuhetzen um so fliehen zu können, sofort, so daß die Stimmung in der Gruppe einem Pulverfass gleicht, welches förmlich darauf wartet, durch das kleinste Fehlverhalten zum explodieren gebracht zu werden.
Aus diesem Psychoduell bezieht der Film seine bis zum Schluß nicht nachlassende Spannung, von der der Zuschauer erst in den letzten Minuten in einer melancholischen Schlußeinstellung erlöst wird.
Das Knistern zwischen den einzelnen Akteuren und die ständige Präsenz des Todes sorgen hier für so viel Intensität, daß die reduzierte Handlung und die spärlich eingesetzten Westernkulissen nicht negativ auffallen, bzw. das integrieren dieser, die Dichte der Atmosphäre auch nur verwäßert hätten und somit als gewolltes Stilmittel betrachtet werden können.
Wieder einmal also beweist hier der Regisseur Anthony Mann sein Gespür für dramatische Stoffe und seine außergewöhnliche Fähigkeit sie für die Leinwand mit Spannung aufzuladen.
Aber auch wenn "Der Mann aus dem Westen" durchgehend überzeugt, so ist es dennoch nicht Manns bester Western und verliert z.b. gegenüber "Nackte Gewalt" deutlich. So ist es auch nur schwer nachzuvollziehen, weßhalb er zu den 10 besten Western aller Zeiten gezählt wird.
Wahrscheinlich ist dies wohl in dem starken Charakter Coopers begründet, der zu seiner Zeit das Gute Amerikas verkörperte wie kein zweiter: Ein bekehrter Sünder, der den Weg zurück zu Gott gefunden hat und nun aufrichtig und ehrlich, mutig, männlich und sich aufopfernd durch das Leben geht. Ein Vorbildcharakter, an dem sich die Nation aufrichten kann. Ein Held, selbst im Angesicht des Todes, berstend von Werten und Charakter...
Das Bild ist durchgehend minimal grieselig aber absolut HD würdig. Die Farbgebung ist in dezentem Technicolor gehalten und wirkt ansatzweise märchenschön, so das auch den zerfurchten Gangsterfressen noch eine schmutzige Ästhetik abgewonnen werden kann. An Extras gibt es außer dem Originaltrailer und einer Diashow noch ein beigelegtes Booklet, in dem Regielegende Godart intellekzuell über das Werk austobt.
Seine philosophische Exkursion über das Werk, das seiner Meinung nach den Western neu erfunden hat, ist mir als Laien etwas zu elitär und insidermäßig. Was nun an der und der Kamerafahrt so genial war und welche Kontrahenten man hier zum erstenmal so und so nebeneinander gesehen hat, mag wohl Filmstudenten ebenso begeistern wie Vergleiche mit der Mathematik und Querverweise auf die gesamte Literaturgeschichte, ist mir aber hohnepiepegal solange es scheppert und kracht, die Luft mit Blei gefüllt ist, der Whiskey auch schon zum Frühstück fließt, der Saloon am Ende renovierungsbedürftig ist und nicht gesungen wird.
mit 4
mit 4
mit 3
mit 2
bewertet am 26.02.12 um 14:10
Naturfreund Johnson (Bronson) kann nicht mitansehen wie ein Huskie zum Vergnügen des Mobs bei einem Hundekampf zu Tode gequält wird. Deshalb kauft er ihn noch an Ort und Stelle dem völlig verdatterten Besitzer ab und peppelt Ihn wieder gesund (erregt beim Zuschauer viel Mitleid und Sympathie!).
Als der Besitzer wieder in den Besitz seiner geringen geistigen Kräfte kommt, schlußfolgert er, von dem Trapper Johnson vor den Augen seiner Kompagnons gedemütigt worden zu sein und bläßt zur Hetzjagd auf Ihn.
Unter der Vorspielung falscher Tatsachen versuchen diese nun, den Seargant Millen (Marvin Lee), und damit das Gesetz, mit ins Boot zu holen.
Nach anfänglichem Widerstand, kennt er doch die Gepflogenheiten seiner Pappenheimer, willigt er schließlich ein. Wohl mehr um Lynchjustiz zu vermeiden und für Johnsen eine faire Chance vor Gericht zu erwirken.
Als sie Johnson in dessen Blockhütte stellen, kann eine Bandito sein Zeigefinger nicht kontrollieren und setzt somit ein Blutbad in Gang.
Bei der vorausgangenen Verhandlung Johnsons mit Millen jedoch erkennt Millen in dem Trapper einen geistesverwandten Charakter und nimmt an der anschließenden Verfolgungsjagd durch die Wildnis Nordamerikas teil.
Die Motivation hierfür dürften vor allen Dingen, neben dem Schutz des Trappers und der Faszination für diesen Mann, auch an dem geweckten Jagdinstinkt des Seargants liegen, da diese doch eine anspruchsvolle Herausforderung, wie gemacht wie ganze Kerle wie er, zu werden verspricht.
Die nun folgende Menschenhast wartet mit allen Finessen und Tücken auf, die die grandiose Natur Kanadas hergibt, welche die denkbar dankbarste Kulisse bildet, vor der dieser Urtyp von Mann seine Fähigkeiten demonstrieren kann.
Genauso roh und ungeschliffen wie die Landschaft erweist sich nämlich auch der Charakter Johnsons, so daß er für dieses Terrain wie geschaffen scheint und deshalb auch den Verfolgern immer einen Schritt voraus ist.
So werden in eindrucksvoll eingefangenen Panoramaaufnahmen und mit ausgewiesenen Charakterdarstellern die Trapperleben- und Natursehnsüchte aller romantischen jugendlichen Auswanderphantasien stellvertretend befriedigt.
Aber nicht nur deshalb, sondern auch weil diese in eine einfältige aber dennoch spannende Handlung eingebettet sind, hat der Film mit dazu beigetragen, Bronson zum Mythos zu verklären.
Das Bild ist im großen und ganzen OK, bei den Naturaufnahmen hätte eine größere Detailfülle aber sicher noch für mehr Furore gesorgt.
Als der Besitzer wieder in den Besitz seiner geringen geistigen Kräfte kommt, schlußfolgert er, von dem Trapper Johnson vor den Augen seiner Kompagnons gedemütigt worden zu sein und bläßt zur Hetzjagd auf Ihn.
Unter der Vorspielung falscher Tatsachen versuchen diese nun, den Seargant Millen (Marvin Lee), und damit das Gesetz, mit ins Boot zu holen.
Nach anfänglichem Widerstand, kennt er doch die Gepflogenheiten seiner Pappenheimer, willigt er schließlich ein. Wohl mehr um Lynchjustiz zu vermeiden und für Johnsen eine faire Chance vor Gericht zu erwirken.
Als sie Johnson in dessen Blockhütte stellen, kann eine Bandito sein Zeigefinger nicht kontrollieren und setzt somit ein Blutbad in Gang.
Bei der vorausgangenen Verhandlung Johnsons mit Millen jedoch erkennt Millen in dem Trapper einen geistesverwandten Charakter und nimmt an der anschließenden Verfolgungsjagd durch die Wildnis Nordamerikas teil.
Die Motivation hierfür dürften vor allen Dingen, neben dem Schutz des Trappers und der Faszination für diesen Mann, auch an dem geweckten Jagdinstinkt des Seargants liegen, da diese doch eine anspruchsvolle Herausforderung, wie gemacht wie ganze Kerle wie er, zu werden verspricht.
Die nun folgende Menschenhast wartet mit allen Finessen und Tücken auf, die die grandiose Natur Kanadas hergibt, welche die denkbar dankbarste Kulisse bildet, vor der dieser Urtyp von Mann seine Fähigkeiten demonstrieren kann.
Genauso roh und ungeschliffen wie die Landschaft erweist sich nämlich auch der Charakter Johnsons, so daß er für dieses Terrain wie geschaffen scheint und deshalb auch den Verfolgern immer einen Schritt voraus ist.
So werden in eindrucksvoll eingefangenen Panoramaaufnahmen und mit ausgewiesenen Charakterdarstellern die Trapperleben- und Natursehnsüchte aller romantischen jugendlichen Auswanderphantasien stellvertretend befriedigt.
Aber nicht nur deshalb, sondern auch weil diese in eine einfältige aber dennoch spannende Handlung eingebettet sind, hat der Film mit dazu beigetragen, Bronson zum Mythos zu verklären.
Das Bild ist im großen und ganzen OK, bei den Naturaufnahmen hätte eine größere Detailfülle aber sicher noch für mehr Furore gesorgt.
mit 4
mit 3
mit 3
mit 2
bewertet am 21.02.12 um 17:35
Der Reiz, den die Tolpatschigkeit des adipösen Pandas noch auszeichnete, ist leider auf Grund des vollendeten Studiums der Kung Fu Kunst etwas in den Hintergrund getreten.
Den Panda wieder als dusseliges Dickerchen zu präsentieren wäre hier also unglaubwürdig und deshalb fehl am Platze.
Wahrscheinlich deshalb hat man im Hause Dreamworks beschloßen, Pummelchen mit seinen Freunden auf eine Mission zu schicken, auf der er den größten Bösewicht und Pfannendieb seiner Zeit eine Lektion erteilen darf, sowie sich den dunklen Kapiteln seiner Kindheit stellen muß.
Zum Glück aber ist, trotz dem Ernst der Angelegenheit, Kung Fu Panda von den geistigen, oft zur biederen Seriösität führenden Reifeprozessen der der Adoleszens, verschont geblieben und zieht nach wie vor die Fettnäpfchen magisch an.
So pflanzt sich der erfrischende Humor des ersten Teils nahtlos im zweiten Teil fort, wenn auch handlungsbedingt nicht mehr mit der gleichen Intensität und Unbeschwertheit.
An die Stelle treten jetzt fulminante Kampfspektakel und augenbetäubende Verfolgungsjagden.
So perfekt diese jedoch auch durchchoreagraphiert sind, müßen sie sich doch den Vorwurf gefallen lassen, mit ihrer überbordenen Phantasie den Zuschauer das eine ums andere mal zu erschlagen.
Auf dem heimischen Fernseher drängt sich zu vieles auf zu dichtem Raum, so das man ob der Detailfülle manchesmal den Überblick verliert, bzw. zu viele Details verloren gehen, was über die Dauer von 90 min. etwas ermüdend wirkt.
Trotz der kleinen Enttäuschung über den verlorengegangenen Zauber des ersten Teiles, kann man bei der Fortsetzung auf gar keinem Fall von einer Enttäuschung sprechen, da viele liebgewonnene Elemente mit in den zweiten Teil hinübergerettet wurden.
Die Bildschärfe ist nahezu am darstellbaren Limit, den Punkt Abzug gibts nur wegen der manchmal etwas zu geringen Plastizität (trotz einiger sehr gelungener Pop Up Effekte) im 3D bereich.
Den Panda wieder als dusseliges Dickerchen zu präsentieren wäre hier also unglaubwürdig und deshalb fehl am Platze.
Wahrscheinlich deshalb hat man im Hause Dreamworks beschloßen, Pummelchen mit seinen Freunden auf eine Mission zu schicken, auf der er den größten Bösewicht und Pfannendieb seiner Zeit eine Lektion erteilen darf, sowie sich den dunklen Kapiteln seiner Kindheit stellen muß.
Zum Glück aber ist, trotz dem Ernst der Angelegenheit, Kung Fu Panda von den geistigen, oft zur biederen Seriösität führenden Reifeprozessen der der Adoleszens, verschont geblieben und zieht nach wie vor die Fettnäpfchen magisch an.
So pflanzt sich der erfrischende Humor des ersten Teils nahtlos im zweiten Teil fort, wenn auch handlungsbedingt nicht mehr mit der gleichen Intensität und Unbeschwertheit.
An die Stelle treten jetzt fulminante Kampfspektakel und augenbetäubende Verfolgungsjagden.
So perfekt diese jedoch auch durchchoreagraphiert sind, müßen sie sich doch den Vorwurf gefallen lassen, mit ihrer überbordenen Phantasie den Zuschauer das eine ums andere mal zu erschlagen.
Auf dem heimischen Fernseher drängt sich zu vieles auf zu dichtem Raum, so das man ob der Detailfülle manchesmal den Überblick verliert, bzw. zu viele Details verloren gehen, was über die Dauer von 90 min. etwas ermüdend wirkt.
Trotz der kleinen Enttäuschung über den verlorengegangenen Zauber des ersten Teiles, kann man bei der Fortsetzung auf gar keinem Fall von einer Enttäuschung sprechen, da viele liebgewonnene Elemente mit in den zweiten Teil hinübergerettet wurden.
Die Bildschärfe ist nahezu am darstellbaren Limit, den Punkt Abzug gibts nur wegen der manchmal etwas zu geringen Plastizität (trotz einiger sehr gelungener Pop Up Effekte) im 3D bereich.
mit 4
mit 4
mit 4
mit 3
bewertet am 21.02.12 um 17:31
Psychodrama nach einer Literaturvorlage im Abenteuerfilmkostüm.
Bonna rd (Rosanno Brazzi), der Sohn eines Archäologen, möchte in der Sahara in einer biblischen, sagenumwobenen Stadt einen Schatz bergen. Von diesem hat er aus den Briefen seines Vaters erfahren, der in eben dieser Stadt verschollen ging. Als Führer für diese Expedition heuert er in Timbuktu den erfahrenen Abenteurer Joe (John Wayne) an.
In der ersten Nacht in der Wüste stößt auch noch die Hure und Straßendiebin Dita (Sophia Loren) hinzu, die Joe wohl bekannt ist und mit der Bonnard in Timbuktu angebändelt hat.
In der Kargheit der Wüste, fernab prägender kultureller Einflüße, werden schnell aller zivilastorische und biographische Ballast abgeworfen und die Protagonisten werden auf Ihre reine Existenz, auf ihre nackte Psyche zurückgeworfen. So schälen sich nach und nach in einer Art alchimistischen Gärungsprozess die wahren Charaktere, die existenziellen Triebe aber auch die jeweiligen Lebenslügen heraus, so daß am Ende des Weges nur Läuterung oder der Wahnsinn stehen können.
Im Zuge dessen spielt der Abenteueraspekt auch nur eine untergeordnete, strukturgebende Rolle und man sollte kein Actionfeuerwerk erwarten. Vielmehr fesseln die zwischenmenschlichen Konstellationen, die unterschwelligen Agressionen und offensichtlichen Eifersüchteleien, die in den Balzspielen um Dita zum Tragen kommen, sowie die psychischen Veränderungen unter dem Einfluß von Gier und Mißtrauen, die schon so manche für aufrichtig geglaubte Seele korrumpiert haben.
In diesem Schmelztiegel der Psyche beweißt John Wayne, Vollmacho von der ersten bis zur letzten Minute ( John Waynes tritt in Lorens Arsch wäre so heute sicherlich nicht mehr durchsetzbar), daß wirkliche Stärke nur aus sich selbst heraus geschöpft werden kann und das jeden Anker den man zu seiner Sicherheit in der äußeren Welt gelegt hat, von einem Moment zum nächsten reißen kann und wirklicher Halt nur in einer starken und aufrichtigen Seele zu finden ist.
So ist der Film denn auch nicht sonderlich den Fans klassischer Western zu empfehlen, sondern eher den Freunden des gepflegten Psychodramas oder eben unerschrockenen Fans des Dukes. Diese werden hier mit einer Performance erster Güte belohnt, da sein männlicher Archetypus auch außerhalb des Monument Valleys vorzüglich funktioniert.
Erfreulich aufrichtig berichtet auch das beigelegte Booklet über die Querelen am Set und die Reputation des Filmes, in der die "Stadt der Verlorenen" nicht über den grünen Klee gelobt und zum Schlüßelwerk des amerikanischen Kinos stilisiert, sondern offen mit den Hintergründen umgegangen wird, weshalb er nicht zu den besten, aber sicherlich zu den interessantesten Filmen in Waynes Karriere gehört.
So wird besonders die Tatsache herausgehoben, daß sich die drei Hauptakteure wegen Eifersüchteleien, verletzter Eitelkeiten und Verleumdungen um angebliche amouröse Beziehungen von Brazzi und Loren, keineswegs grün waren und die zwischenmenschlichen Differenzen auch im Spiel vor der Kamera nicht ablegen konnten.
Anstatt aber diese Spannung im Film befruchtend auszuagieren, spielen diese Ausnahmeakteure in Ihren jeweils eigenen Universen und harmonieren auf Grund der geringen Berührungsflächen Ihrer Charaktere nur bedingt miteinander.
So wird nicht das nötige Leinwandknistern erzeut, das nötig gewesen wäre, um den Funken auf den Zuschauer überspringen zu lassen.
Auch wird immer wieder auf das verschenkte Potenzial der Drehbuchvorlage hingewiesen. Es gab anscheinend eine ganze Menge mystische, metaphysische und philosophische Ansätze. Diese fielen aber anscheinend der soliden Grundhaltung des Regisseurs Henry Hathaway zum Opfer, der immer sehr um Bodenständigkeit bemüht war und somit das Werk um seine Metaebene, die für deutlich mehr Tiefe hätte sorgen können, beraubt hat. Die Bühne, die die Wüste mit ihrem veränderten Raum- und Zeitkoordinarten und somit metaphysischen Botschaften quasi den idealen Nährboden bietet, verkümmert hier sozusagen zum Selbstzweck, da es Hathaway nicht vermag, die Handlung über ein gewöhnliches zwischenmenschliches Drama hinaus zu projezieren und die numenösen Eigenschaften der Existenz mit dem Panorama zu verflechten.
Die reine Handlung Hathaways Version bietet zudem zu wenig Potential, bzw. Handlungsmasse um vor der gigantischen Kulisse als Gegengewicht bestehen zu können und von dieser nicht verschluckt zu werden.
Da der Kameramann aber genau diese Ambitionen hatte, das überwältigende und zeitlose der Wüste zu betonen, haben er und der Regisseur somit gegeneinander gearbeitet, so daß man zwei unterschiedliche Filme, einen des Kameramannes und einen des Regisseurs, sehen kann, die auf Grund ihrer unterschiedlichen Intentionen aber zu keiner symbiotischen Einheit führen.
Genau dieser Widerspruch ist es, der den Zuschauer, mehr gefühlt als verstanden, veranlaßt, daß Werk nicht zu den Großtaten, sondern zu den exotischen Exkursionen John Waynes zu zählen.
Die Restauration des Bildes kann man als annährend perfekt bezeichnen!
Bonna rd (Rosanno Brazzi), der Sohn eines Archäologen, möchte in der Sahara in einer biblischen, sagenumwobenen Stadt einen Schatz bergen. Von diesem hat er aus den Briefen seines Vaters erfahren, der in eben dieser Stadt verschollen ging. Als Führer für diese Expedition heuert er in Timbuktu den erfahrenen Abenteurer Joe (John Wayne) an.
In der ersten Nacht in der Wüste stößt auch noch die Hure und Straßendiebin Dita (Sophia Loren) hinzu, die Joe wohl bekannt ist und mit der Bonnard in Timbuktu angebändelt hat.
In der Kargheit der Wüste, fernab prägender kultureller Einflüße, werden schnell aller zivilastorische und biographische Ballast abgeworfen und die Protagonisten werden auf Ihre reine Existenz, auf ihre nackte Psyche zurückgeworfen. So schälen sich nach und nach in einer Art alchimistischen Gärungsprozess die wahren Charaktere, die existenziellen Triebe aber auch die jeweiligen Lebenslügen heraus, so daß am Ende des Weges nur Läuterung oder der Wahnsinn stehen können.
Im Zuge dessen spielt der Abenteueraspekt auch nur eine untergeordnete, strukturgebende Rolle und man sollte kein Actionfeuerwerk erwarten. Vielmehr fesseln die zwischenmenschlichen Konstellationen, die unterschwelligen Agressionen und offensichtlichen Eifersüchteleien, die in den Balzspielen um Dita zum Tragen kommen, sowie die psychischen Veränderungen unter dem Einfluß von Gier und Mißtrauen, die schon so manche für aufrichtig geglaubte Seele korrumpiert haben.
In diesem Schmelztiegel der Psyche beweißt John Wayne, Vollmacho von der ersten bis zur letzten Minute ( John Waynes tritt in Lorens Arsch wäre so heute sicherlich nicht mehr durchsetzbar), daß wirkliche Stärke nur aus sich selbst heraus geschöpft werden kann und das jeden Anker den man zu seiner Sicherheit in der äußeren Welt gelegt hat, von einem Moment zum nächsten reißen kann und wirklicher Halt nur in einer starken und aufrichtigen Seele zu finden ist.
So ist der Film denn auch nicht sonderlich den Fans klassischer Western zu empfehlen, sondern eher den Freunden des gepflegten Psychodramas oder eben unerschrockenen Fans des Dukes. Diese werden hier mit einer Performance erster Güte belohnt, da sein männlicher Archetypus auch außerhalb des Monument Valleys vorzüglich funktioniert.
Erfreulich aufrichtig berichtet auch das beigelegte Booklet über die Querelen am Set und die Reputation des Filmes, in der die "Stadt der Verlorenen" nicht über den grünen Klee gelobt und zum Schlüßelwerk des amerikanischen Kinos stilisiert, sondern offen mit den Hintergründen umgegangen wird, weshalb er nicht zu den besten, aber sicherlich zu den interessantesten Filmen in Waynes Karriere gehört.
So wird besonders die Tatsache herausgehoben, daß sich die drei Hauptakteure wegen Eifersüchteleien, verletzter Eitelkeiten und Verleumdungen um angebliche amouröse Beziehungen von Brazzi und Loren, keineswegs grün waren und die zwischenmenschlichen Differenzen auch im Spiel vor der Kamera nicht ablegen konnten.
Anstatt aber diese Spannung im Film befruchtend auszuagieren, spielen diese Ausnahmeakteure in Ihren jeweils eigenen Universen und harmonieren auf Grund der geringen Berührungsflächen Ihrer Charaktere nur bedingt miteinander.
So wird nicht das nötige Leinwandknistern erzeut, das nötig gewesen wäre, um den Funken auf den Zuschauer überspringen zu lassen.
Auch wird immer wieder auf das verschenkte Potenzial der Drehbuchvorlage hingewiesen. Es gab anscheinend eine ganze Menge mystische, metaphysische und philosophische Ansätze. Diese fielen aber anscheinend der soliden Grundhaltung des Regisseurs Henry Hathaway zum Opfer, der immer sehr um Bodenständigkeit bemüht war und somit das Werk um seine Metaebene, die für deutlich mehr Tiefe hätte sorgen können, beraubt hat. Die Bühne, die die Wüste mit ihrem veränderten Raum- und Zeitkoordinarten und somit metaphysischen Botschaften quasi den idealen Nährboden bietet, verkümmert hier sozusagen zum Selbstzweck, da es Hathaway nicht vermag, die Handlung über ein gewöhnliches zwischenmenschliches Drama hinaus zu projezieren und die numenösen Eigenschaften der Existenz mit dem Panorama zu verflechten.
Die reine Handlung Hathaways Version bietet zudem zu wenig Potential, bzw. Handlungsmasse um vor der gigantischen Kulisse als Gegengewicht bestehen zu können und von dieser nicht verschluckt zu werden.
Da der Kameramann aber genau diese Ambitionen hatte, das überwältigende und zeitlose der Wüste zu betonen, haben er und der Regisseur somit gegeneinander gearbeitet, so daß man zwei unterschiedliche Filme, einen des Kameramannes und einen des Regisseurs, sehen kann, die auf Grund ihrer unterschiedlichen Intentionen aber zu keiner symbiotischen Einheit führen.
Genau dieser Widerspruch ist es, der den Zuschauer, mehr gefühlt als verstanden, veranlaßt, daß Werk nicht zu den Großtaten, sondern zu den exotischen Exkursionen John Waynes zu zählen.
Die Restauration des Bildes kann man als annährend perfekt bezeichnen!
mit 3
mit 4
mit 4
mit 2
bewertet am 19.02.12 um 16:10
In der ersten Hälfte sehr um werksgetreues bemühtes und daher wie eine Imitation wirkendes Remake des 80er Jahre Films, das sich insgesamt athmosphärisch undicht präsentiert.
Die Spannungsmomente sind entweder geklaut oder 1:1 aus dem Horrorfilmhandbuch entlehnt, die Charaktere entfalten keine Persönlichkeit und taumeln wie der gesamte Streifen zwischen Ernsthaftigkeit und Slapstick hin und her, ohne jedoch dabei nennenswerte Ausschläge auf der jeweiligen Meßlatte zu erreichen.
Die Computereffekte machen Spaß und sorgen fast alleine für die wenigen Gruselmomente.
Die Plastizität und damit die 3D Effekte sind durchgehend überzeugend und machen Laune.
Das wars dann aber auch.
Abgehakt. Der nächste bitte.!
Die Spannungsmomente sind entweder geklaut oder 1:1 aus dem Horrorfilmhandbuch entlehnt, die Charaktere entfalten keine Persönlichkeit und taumeln wie der gesamte Streifen zwischen Ernsthaftigkeit und Slapstick hin und her, ohne jedoch dabei nennenswerte Ausschläge auf der jeweiligen Meßlatte zu erreichen.
Die Computereffekte machen Spaß und sorgen fast alleine für die wenigen Gruselmomente.
Die Plastizität und damit die 3D Effekte sind durchgehend überzeugend und machen Laune.
Das wars dann aber auch.
Abgehakt. Der nächste bitte.!
mit 3
mit 4
mit 4
mit 2
bewertet am 16.02.12 um 12:10
Finchers wütende Verfilmung der Buchvorlage von Kultautor Chuck Palahniuk (Choke) hat bis heute nichts von seiner schmutzigen Intensität und subversiven Botschaft eingebüßt.
Die Explosionen der Gewalt eines im domestizierten Bürohengsten gefangenen archaischen Egos und der Ausbruch der bislang unterdrückten Agression des vom Nestbautrieb dominierten Menschen, der seine Lebensumstände in von Sicherheitsdenken bestimmter Lethargie über sich ergehen läßt, gehört auf Grund seiner exzessiven Darstellung und seines komplexen sozialkritischen und philosophischen Unterbaus zum allerbesten was das moderne Hollywood je auf die Leinwand losgelassen hat.
Aufgrund der entfesselten Kompromißlosigkeit mit der Tyler Durdan dem System seine Verlogenheit und Versklavung des Individuums in die Fresse schlagen möchte, sowie die psychologisch anschaulich herausgearbeiten fatalen Auswirkungen die bei der Unterdrückung der Impulse des Freudschen Es zugunsten eines funktionierenden Ichs auftreten, beweißt Fight Club, daß ihm eine gehobene Intelligenz innewohnt, die die Funktion eines vornehmlich auf den reinen Unterhaltungsfaktor getrimmten brutalen Prügelfilms deutlich transzendiert.
Das dabei auch spirituelle, bzw. ontologische Aspekte (Erst wenn Du alles verloren hast, hast Du die Freiheit alles zu tun), angeschnitten werden, beweist unterdessen die universale Bildung von Palahniuk und erzeugt so einen hohen Wiedererkennungswert, da es wohl niemanden gibt, der sich nicht schon mal seine Psyche an den Fesseln der Existenssicherung wundgescheuert hat.
Außer der ungeschminkten, auf die Magengrube schlagenden Gewalt in den Kellerduellen, die als Ventil für den angestauten Existenzfrust dienen und auf drastische Art und Weise visualisieren wie tief der Stachel der täglich ertragenden Demütigungen im Fleische steckt, ist es vor allem das Wühlen in seelischen und zwischenmenschlichen Abgründen, die in der verrotteten Behausung Durdans ihr optisches aquivalent finden und von der genialen Kamera abstoßend faszinierend eingefangen wurden, daß dem Strudel den Fight Club erzeugt, kaum jemand ohne dem Gefühl entkommen kann, etwas beigewohnt zu haben, daß nicht nur Auge, Herz und Hirn erfreut, sondern der es vermag auf Grund seiner erbarmungslosen Aufrichtigkeit und Brachialität auch das Mark zu erschüttern.
Nicht zuletzt aber auch wegen seines anarchischen oft ekelerregenden Humors, erziehlt Fight Club eine intensive Wirkung, die nicht durch noch so raffiniertes Wortgeschrubbel vermittelt werden kann und die die bisher gekannten filmischen Gewohnheiten überschreitet um so das Medium um eine neue Ausdrucksmöglichkeiten zu bereichern.
Die Explosionen der Gewalt eines im domestizierten Bürohengsten gefangenen archaischen Egos und der Ausbruch der bislang unterdrückten Agression des vom Nestbautrieb dominierten Menschen, der seine Lebensumstände in von Sicherheitsdenken bestimmter Lethargie über sich ergehen läßt, gehört auf Grund seiner exzessiven Darstellung und seines komplexen sozialkritischen und philosophischen Unterbaus zum allerbesten was das moderne Hollywood je auf die Leinwand losgelassen hat.
Aufgrund der entfesselten Kompromißlosigkeit mit der Tyler Durdan dem System seine Verlogenheit und Versklavung des Individuums in die Fresse schlagen möchte, sowie die psychologisch anschaulich herausgearbeiten fatalen Auswirkungen die bei der Unterdrückung der Impulse des Freudschen Es zugunsten eines funktionierenden Ichs auftreten, beweißt Fight Club, daß ihm eine gehobene Intelligenz innewohnt, die die Funktion eines vornehmlich auf den reinen Unterhaltungsfaktor getrimmten brutalen Prügelfilms deutlich transzendiert.
Das dabei auch spirituelle, bzw. ontologische Aspekte (Erst wenn Du alles verloren hast, hast Du die Freiheit alles zu tun), angeschnitten werden, beweist unterdessen die universale Bildung von Palahniuk und erzeugt so einen hohen Wiedererkennungswert, da es wohl niemanden gibt, der sich nicht schon mal seine Psyche an den Fesseln der Existenssicherung wundgescheuert hat.
Außer der ungeschminkten, auf die Magengrube schlagenden Gewalt in den Kellerduellen, die als Ventil für den angestauten Existenzfrust dienen und auf drastische Art und Weise visualisieren wie tief der Stachel der täglich ertragenden Demütigungen im Fleische steckt, ist es vor allem das Wühlen in seelischen und zwischenmenschlichen Abgründen, die in der verrotteten Behausung Durdans ihr optisches aquivalent finden und von der genialen Kamera abstoßend faszinierend eingefangen wurden, daß dem Strudel den Fight Club erzeugt, kaum jemand ohne dem Gefühl entkommen kann, etwas beigewohnt zu haben, daß nicht nur Auge, Herz und Hirn erfreut, sondern der es vermag auf Grund seiner erbarmungslosen Aufrichtigkeit und Brachialität auch das Mark zu erschüttern.
Nicht zuletzt aber auch wegen seines anarchischen oft ekelerregenden Humors, erziehlt Fight Club eine intensive Wirkung, die nicht durch noch so raffiniertes Wortgeschrubbel vermittelt werden kann und die die bisher gekannten filmischen Gewohnheiten überschreitet um so das Medium um eine neue Ausdrucksmöglichkeiten zu bereichern.
mit 5
mit 4
mit 4
mit 3
bewertet am 15.02.12 um 11:40
Geglückte Teleportation der Essenz amerikanischen Hurra-Patriotismuses z.Zt. des 2ten Weltkrieges in die heutige Zeit.
Bleibt Captain America noch mit der Bekämpfung der Nazis und Repräsentation des Nationalethos der Kriegsjahre eng bei seinen historischen Wurzeln und mit der Schilderung des von der Armee abgelehnten US Bürgers, der bei einem geheimen Militärexperiment zu Superkräften gelangt noch nahe bei der Comicvorlage von 1941 und beweist somit Authentizismus, so folgt die aus heutiger Sicht notwendige Korrektur der patriotischen Sichtweise auf dem Fuße, ohne sich jedoch an einen Antiamerikanismus ala Michael Moore zu verraten.
Die Parodie, die sich aus der Kluft der Las Vegas reifen Präsentation Captain Americas auf der Bühne und der Kriegsrealität ergibt, nimmt den Kritikern die dem Streifen Supermachtspropagenda vorwerfen, frühzeitig allen Wind aus den Segeln, um sich so ohne politischen Ballast der eigentlichen Geschichte zuwenden zu können: Captain Americas Kampf gegen einen okkulten Nazi-Wissenschaftler.
Die Grundidee ist nicht neu, sollte auch dem letzten Wachkomapatient seit Indiana Jones bekannt sein, wurde aber noch nie in solcher Konsequenz und mit solchem Bombast umgesetzt wie hier. Und da es sich dabei auch um mehr oder weniger um eine Werksgetreue Umsetzung der Originalcomics handelt, kann man sich auch mal fragen, wo Indiana Jones, Hellboy und co. eigentlich abgekupfert haben.
Also, auch wenn einem vieles bekannt vorkommt, so hat man doch zu keiem Zeitpunkt das Gefühl an einem Deja Vu zu leiden, da der Plott zu jedem Zeitpunkt frisch und überraschend wirkt und auch der leise Humor stilsicher platziert wurde.
Die Figuren wirken trotz ihrer zweidimensionalen Vorbilder keineswegs flach, sondern besitzen sogar ansatzweise so etwas wie Tiefe, obwohl ihnen in diesem vorwiegend auf Action getrimmten Spektakel kaum Zeit für die Entwicklung tiefgründiger Charakterzüge bleibt. So holen die Schauspieler, allen voran Hugo Weaving, wohl das Maximum aus ihren Rollen raus.
Auch die Kulissen der Nazitrutzburgen hinterlassen in ihrer bombastischen Ausgestaltung, neben denen selbst Germania sich ausmalt wie eine Sandkastenphantasie, einen nachhaltigen Eindruck und tragen so zum gelungenen Geamteindruck bei.
Zu guter letzt sollten auch die Einflechtungen anderer Figuren aus dem Marvel-Universum, wie z.B. Iron Mans Vater nicht unerwähnt bleiben, da sie durch die intelligente und sinnvolle Integration dem Film so etwas wie Komplexität verleihen.
Bleibt unterm Strich festzuhalten, daß hier ein solides Stück Unterhaltungskino geschaffen wurde, welches sich nur in die letzten 20 min. den Vorwurf gefallen lassen muß, mit den obligatorischen Ballerorgien auf zu konventionellen und altbewährten Pfaden zu schreiten.
Wie andere Comicverfilmungen auch, hält sich Captain America eng an die Comicvorlage und liefert so den Fans eine adäquate Umsetzung des Themas mit den Mitteln der heutigen Zeit und für das Geschmack des heutigen Publikumgs.
Das dabei das Potential des Stoffes und der Schauspieler nicht ausgereizt wird, liegt hierbei in der Natur der Sache, da die Vorlagen wenig Tiefgang besitzen. Die einzige Ausnahme im Comocfilmuniversum bildet da Batman Begins, der mit einer tiefergehenden charakterlichen Wandlung aufwarten kann.
Lobenswert ist auch, wie sich C.A. wohltuend vom platten Amerkanismus entfernt. Captain America war im Laufe seiner Karriere immer auch so etwas wie das moralische und zeitgemäße Sprachrohr seines Landes und dabei mit seinen sozialkritischen Ansätzen nicht immer auf dem aktuellen Parteikurs und präsentierte somit das Gewissen seines Landes und dient somit eigentlich eher weniger als Projektionsfläche für amerikanische Großmachtsphantasien.
Möcht e Steve Rogers zu Beginn einfach nur dem Land dienen und beweißt so hirnlosen Patrotismus bis hin zur Todesverachtung, so verläßt er diesen Status sehr schnell wieder. Schon in der karnevalistischen Übertreibung seines Heldentums auf den Bühnen des Landes, auf die C.A. wider Willen gezehrt wird, wird der uneingeschränkte Hurra Patriotismus der Lächerlichkeit preisgegeben.
Und spätestens als C.A. von den Frontsoldaten (wohlgemerkt, den Amerikanischen!) für seine Bühnenmätzchen nur Hohn erntet, weil diese vielmehr an den Mädels der Tanzgarde interessiert sind, wird die Albernheit dieses Rummels um die Person und die patriotischen Mätzchen deutlich und C.A. kann sich von da an frei auf seine "perönliche" Mission konzentrieren, so daß der oft kritisierte plumpe Amerikanismus eigentlich nur noch über das Kostüm assoziert werden kann. Und das ist etwas zu dürftig, um daraus ein Politikum zu machen.
So benützt C.A. soviel Patriotismus wie nötig, um seiner Vorlage gerecht zu werden, aber so wenig wie möglich, um nicht in den Verdacht eines Propagandafilms zu geraten.
Und wem das nicht paßt der soll von mir aus auf den von jeder politischen Tendenz bereinigten Meister Propper vs. Weißer Riese Film warten: Weltraumtoiletten greifen an- Ein Wischmop schlägt Alarm. O.ä.. Viel Spaß dabei....!
Bleibt Captain America noch mit der Bekämpfung der Nazis und Repräsentation des Nationalethos der Kriegsjahre eng bei seinen historischen Wurzeln und mit der Schilderung des von der Armee abgelehnten US Bürgers, der bei einem geheimen Militärexperiment zu Superkräften gelangt noch nahe bei der Comicvorlage von 1941 und beweist somit Authentizismus, so folgt die aus heutiger Sicht notwendige Korrektur der patriotischen Sichtweise auf dem Fuße, ohne sich jedoch an einen Antiamerikanismus ala Michael Moore zu verraten.
Die Parodie, die sich aus der Kluft der Las Vegas reifen Präsentation Captain Americas auf der Bühne und der Kriegsrealität ergibt, nimmt den Kritikern die dem Streifen Supermachtspropagenda vorwerfen, frühzeitig allen Wind aus den Segeln, um sich so ohne politischen Ballast der eigentlichen Geschichte zuwenden zu können: Captain Americas Kampf gegen einen okkulten Nazi-Wissenschaftler.
Die Grundidee ist nicht neu, sollte auch dem letzten Wachkomapatient seit Indiana Jones bekannt sein, wurde aber noch nie in solcher Konsequenz und mit solchem Bombast umgesetzt wie hier. Und da es sich dabei auch um mehr oder weniger um eine Werksgetreue Umsetzung der Originalcomics handelt, kann man sich auch mal fragen, wo Indiana Jones, Hellboy und co. eigentlich abgekupfert haben.
Also, auch wenn einem vieles bekannt vorkommt, so hat man doch zu keiem Zeitpunkt das Gefühl an einem Deja Vu zu leiden, da der Plott zu jedem Zeitpunkt frisch und überraschend wirkt und auch der leise Humor stilsicher platziert wurde.
Die Figuren wirken trotz ihrer zweidimensionalen Vorbilder keineswegs flach, sondern besitzen sogar ansatzweise so etwas wie Tiefe, obwohl ihnen in diesem vorwiegend auf Action getrimmten Spektakel kaum Zeit für die Entwicklung tiefgründiger Charakterzüge bleibt. So holen die Schauspieler, allen voran Hugo Weaving, wohl das Maximum aus ihren Rollen raus.
Auch die Kulissen der Nazitrutzburgen hinterlassen in ihrer bombastischen Ausgestaltung, neben denen selbst Germania sich ausmalt wie eine Sandkastenphantasie, einen nachhaltigen Eindruck und tragen so zum gelungenen Geamteindruck bei.
Zu guter letzt sollten auch die Einflechtungen anderer Figuren aus dem Marvel-Universum, wie z.B. Iron Mans Vater nicht unerwähnt bleiben, da sie durch die intelligente und sinnvolle Integration dem Film so etwas wie Komplexität verleihen.
Bleibt unterm Strich festzuhalten, daß hier ein solides Stück Unterhaltungskino geschaffen wurde, welches sich nur in die letzten 20 min. den Vorwurf gefallen lassen muß, mit den obligatorischen Ballerorgien auf zu konventionellen und altbewährten Pfaden zu schreiten.
Wie andere Comicverfilmungen auch, hält sich Captain America eng an die Comicvorlage und liefert so den Fans eine adäquate Umsetzung des Themas mit den Mitteln der heutigen Zeit und für das Geschmack des heutigen Publikumgs.
Das dabei das Potential des Stoffes und der Schauspieler nicht ausgereizt wird, liegt hierbei in der Natur der Sache, da die Vorlagen wenig Tiefgang besitzen. Die einzige Ausnahme im Comocfilmuniversum bildet da Batman Begins, der mit einer tiefergehenden charakterlichen Wandlung aufwarten kann.
Lobenswert ist auch, wie sich C.A. wohltuend vom platten Amerkanismus entfernt. Captain America war im Laufe seiner Karriere immer auch so etwas wie das moralische und zeitgemäße Sprachrohr seines Landes und dabei mit seinen sozialkritischen Ansätzen nicht immer auf dem aktuellen Parteikurs und präsentierte somit das Gewissen seines Landes und dient somit eigentlich eher weniger als Projektionsfläche für amerikanische Großmachtsphantasien.
Möcht e Steve Rogers zu Beginn einfach nur dem Land dienen und beweißt so hirnlosen Patrotismus bis hin zur Todesverachtung, so verläßt er diesen Status sehr schnell wieder. Schon in der karnevalistischen Übertreibung seines Heldentums auf den Bühnen des Landes, auf die C.A. wider Willen gezehrt wird, wird der uneingeschränkte Hurra Patriotismus der Lächerlichkeit preisgegeben.
Und spätestens als C.A. von den Frontsoldaten (wohlgemerkt, den Amerikanischen!) für seine Bühnenmätzchen nur Hohn erntet, weil diese vielmehr an den Mädels der Tanzgarde interessiert sind, wird die Albernheit dieses Rummels um die Person und die patriotischen Mätzchen deutlich und C.A. kann sich von da an frei auf seine "perönliche" Mission konzentrieren, so daß der oft kritisierte plumpe Amerikanismus eigentlich nur noch über das Kostüm assoziert werden kann. Und das ist etwas zu dürftig, um daraus ein Politikum zu machen.
So benützt C.A. soviel Patriotismus wie nötig, um seiner Vorlage gerecht zu werden, aber so wenig wie möglich, um nicht in den Verdacht eines Propagandafilms zu geraten.
Und wem das nicht paßt der soll von mir aus auf den von jeder politischen Tendenz bereinigten Meister Propper vs. Weißer Riese Film warten: Weltraumtoiletten greifen an- Ein Wischmop schlägt Alarm. O.ä.. Viel Spaß dabei....!
mit 4
mit 5
mit 5
mit 3
bewertet am 15.02.12 um 11:35
Hervorragender Western mit Elementen der schwarzen Serie, der durch seine Härte und Direktheit die für 1946 untypisch waren, auch heute noch überrascht.
Wie auch schon bei "Ox Bow", geht es hier Regisseur William A. Wellmann, mal wieder mehr um inner- und zwischenmenschliche Dramen, als um die epische Geschichte. Im Gegensatz zum "Ox Bow" kommen hier aber zu Beginn noch einige Landschaftsaufnahmen hinzu. Allerdings keine erhabene Felsmonumente wie bei John Ford oder weite Prärielandschaften wie bei William Wyler, sondern die totbringende Ödniss des Death Valley.
Nach einem Raubüberfall nämlich müßen Stretch und seine Bande dieses lebensfeindliche Areal durchqueren, um schließlich in dem verlaßenen Goldgräberstädtchen Yellow Sky (so auch der Originaltitel) zu stranden. In Bilder von schlichter Schönheit wird dem Film so gleich zu Beginn alle Fröhlichkeit genommen und das Leben als ein von Überlebensinstinkten dominiertes Ereigniss präsentiert. Bemerkenswert ist hier, daß vor allem auf Grund der maskenbildnerischen Leistung, die Qual des Verdurstens und die Hautzerschindene Kraft der Sonne auf so eindringliche Weise dargestellt wird, daß diese beinahe physisch für den Zuschauer nachvollziehbar werden.
Halbtot in Yellow Sky angekommen, treffen die Überlebenden sehr bald auf einen alten Goldgräber und seine schöne Tochter Mike.
Was sich nun entfaltet, gleicht in Teilen dem ein Jahr zuvor erschienen Bogart Klassiker "Der Schatz der Sierra Madre". Auch hier geht es darum, wie das Gold, bzw. die Gier die Psyche der Menschen zersetzt und alle anderen Charakterzüge dominiert.
Freunschaft, Ehre und Moral entpuppen sich unter dem Joch des glitzernden Metalles schnell als nicht ebenbürtige und hinderliche evolutionäre Errungenschaften.
Dazu kommt auch noch das Verhältniss der Bande zu dem schönen Goldgräbermädchen Mike, die die psychischen Verwerfungen noch deutlicher macht.
Einzig und allein in Stretch (Gregory Peck) entfacht die Liebe zu Mike das heilende Feuer der Liebe und löst in ihm so etwas wie eine Läuterung der Seele und des Gewissens aus.
Für alle anderen ist sie nur ein Sexobjekt, das sich den plumpen Annäherungs- und Vergewaltigungsversuchen, in für die damalige Zeit unverholen grob dargestellten Scenen, immer nur mit Not entziehen kann.
Die verrohten Seelen sind auf Grund der Dominanz der primitiven Überlebensinstinkte nicht mehr in der Lage die Schönheiten des Lebens oder des reinen Gewissens zu genießen.
So kommt es, wie es kommen muß: Da sich die rohe Sippe nicht an den Vertrag mit dem Goldgräber halten will, "ehrenwerter Weise" nur das halbe Vermögen zu klauen, und da die Meute untereinander im Streit um das erste Recht auf die weibliche Beute längst im Clinch miteinander liegt, kommt es im Showdown zum Kampf das Gold und die Frau. Alles oder nichts, Liebe oder Vergewaltigung. Gut gegen Böse.
Im Gegensatz zum "Ox Bow" ist hier die Handlung aber auf Grund der Gruppendynamik um einiges komplexer und gestaltet sich dadurch auch interessanter. Gemeinsam mit dem Vorläufer hat er jedoch den überragenden Cast, der mit dieser handverlesenen Schar hochwertiger Charakterschauspieler den Film zu einem besonderen Ereigniss macht.
Nicht unerwähnt sollte auch der Kameramann bleiben, der mit den ästhetischen Wüstenaufnahmen gleich zu Beginn des Films und den starken, von harten Kontrasten geprägten Shots im Showdown, Yellow Sky auch zu einem optischen Leckerbissen gestaltet.
Dafür und für die HD würdige Restaurierung gibts die volle Punktzahl.
Wie auch schon bei "Ox Bow", geht es hier Regisseur William A. Wellmann, mal wieder mehr um inner- und zwischenmenschliche Dramen, als um die epische Geschichte. Im Gegensatz zum "Ox Bow" kommen hier aber zu Beginn noch einige Landschaftsaufnahmen hinzu. Allerdings keine erhabene Felsmonumente wie bei John Ford oder weite Prärielandschaften wie bei William Wyler, sondern die totbringende Ödniss des Death Valley.
Nach einem Raubüberfall nämlich müßen Stretch und seine Bande dieses lebensfeindliche Areal durchqueren, um schließlich in dem verlaßenen Goldgräberstädtchen Yellow Sky (so auch der Originaltitel) zu stranden. In Bilder von schlichter Schönheit wird dem Film so gleich zu Beginn alle Fröhlichkeit genommen und das Leben als ein von Überlebensinstinkten dominiertes Ereigniss präsentiert. Bemerkenswert ist hier, daß vor allem auf Grund der maskenbildnerischen Leistung, die Qual des Verdurstens und die Hautzerschindene Kraft der Sonne auf so eindringliche Weise dargestellt wird, daß diese beinahe physisch für den Zuschauer nachvollziehbar werden.
Halbtot in Yellow Sky angekommen, treffen die Überlebenden sehr bald auf einen alten Goldgräber und seine schöne Tochter Mike.
Was sich nun entfaltet, gleicht in Teilen dem ein Jahr zuvor erschienen Bogart Klassiker "Der Schatz der Sierra Madre". Auch hier geht es darum, wie das Gold, bzw. die Gier die Psyche der Menschen zersetzt und alle anderen Charakterzüge dominiert.
Freunschaft, Ehre und Moral entpuppen sich unter dem Joch des glitzernden Metalles schnell als nicht ebenbürtige und hinderliche evolutionäre Errungenschaften.
Dazu kommt auch noch das Verhältniss der Bande zu dem schönen Goldgräbermädchen Mike, die die psychischen Verwerfungen noch deutlicher macht.
Einzig und allein in Stretch (Gregory Peck) entfacht die Liebe zu Mike das heilende Feuer der Liebe und löst in ihm so etwas wie eine Läuterung der Seele und des Gewissens aus.
Für alle anderen ist sie nur ein Sexobjekt, das sich den plumpen Annäherungs- und Vergewaltigungsversuchen, in für die damalige Zeit unverholen grob dargestellten Scenen, immer nur mit Not entziehen kann.
Die verrohten Seelen sind auf Grund der Dominanz der primitiven Überlebensinstinkte nicht mehr in der Lage die Schönheiten des Lebens oder des reinen Gewissens zu genießen.
So kommt es, wie es kommen muß: Da sich die rohe Sippe nicht an den Vertrag mit dem Goldgräber halten will, "ehrenwerter Weise" nur das halbe Vermögen zu klauen, und da die Meute untereinander im Streit um das erste Recht auf die weibliche Beute längst im Clinch miteinander liegt, kommt es im Showdown zum Kampf das Gold und die Frau. Alles oder nichts, Liebe oder Vergewaltigung. Gut gegen Böse.
Im Gegensatz zum "Ox Bow" ist hier die Handlung aber auf Grund der Gruppendynamik um einiges komplexer und gestaltet sich dadurch auch interessanter. Gemeinsam mit dem Vorläufer hat er jedoch den überragenden Cast, der mit dieser handverlesenen Schar hochwertiger Charakterschauspieler den Film zu einem besonderen Ereigniss macht.
Nicht unerwähnt sollte auch der Kameramann bleiben, der mit den ästhetischen Wüstenaufnahmen gleich zu Beginn des Films und den starken, von harten Kontrasten geprägten Shots im Showdown, Yellow Sky auch zu einem optischen Leckerbissen gestaltet.
Dafür und für die HD würdige Restaurierung gibts die volle Punktzahl.
mit 5
mit 4
mit 3
mit 2
bewertet am 11.02.12 um 12:26
Moralinsaures Stück Westerngeschichte über das Gesetz, Selbstjustiz und den ethischen Anspruch der amerikanischen Rechtsprechung.
In einem Präriekaff wird ein Farmer tot aufgefunden. Schnell finden sich Verdächtige: Drei Reisende, die mit dem Farmer gesehen wurden.
Der Lynch Mob, aber auch einige gemäßigte Kreaturen fackeln nicht lange und nehmen die Verfolgung auf, da der Sherriff gerade nicht in der City ist.
Als die drei vermeintlichen Mörder, die sich aber als Farmer zu erkennen geben, einen Teil der Rinder des getöteten mit sich führen ohne dafür einen Kaufbeleg vorweisen zu können, und einer von Ihnen sich dummerweise auch noch im Besitz des Revolvers des Farmers befindet, gerät der Mob in Wallung und fordert Vergeltung um sich wieder besänftigen zu können.
Die drei vermeintlichen Mörder und Viehdiebe sollen hängen. Und zwar an Ort und Stelle.
Was sich nun entspinnt ist eine Verhandlungsdrama nach dem Muster der zwölf Geschworenen: Eine Anfangs eindeutige Situation gerät bei genauerer Betrachtung mehr und mehr ins Wanken, bis sich herausstellt, daß eine Verurteilung nicht mehr durch Fakten belegt werden kann, sondern nur noch durch den eigenen Racheinstinkt legitimiert worden ist.
Also auch wenn das Muster der Grundhandlung relativ simpel gestrickt ist, so ist die Entwicklung der Verhandlung auf Grund der ungesicherten Faktenlage, der Zwist der rivalisierenden Gruppen im Moblager (Geist gegen Gefühl) und die Reaktion der von Todesangst geplagten Angeklagten durchgehend von Spannung und fesselnden Wendungen geprägt.
Deshalb kann man auf Grund des Fehlens der Western typischen Elemente wie weite Prärielandschaften, kecke Farmerstochter, wilde Schießerei am Rio Grande oder tückische Indianerstämme auch eher von einem Drama im wilden Westen als von einem echten Western sprechen.
Das Fehlen dieser Elemente wird aber durch den bis in die Nebenrollen hervorragenden Cast wieder wett gemacht, der durch etwas besticht, wovon die heutige Schauspielergeneration nur noch träumen kann: Charakter.
So überzeugen auch der Cast um Henry Fonda und Anthony Quinn herum mit einer Ausstrahlungskraft, die mit der Verruchtheit oder aber eben mit der Erhabenheit Ihrer Charaktere Hand in Hand gehen, so daß das sülzig pathetische Ende, bei dem Gottes Wille in dem amerikanische Geist seine Vollendung gefunden zu haben scheint, leicht verdaut werden kann und nur ein geringes Geschmäckle hinterläßt.
Zum Schluß läßt sich sagen, daß das Bild durchweg HD Niveau besitzt und nur durch den Vergleich mit aktuellen Produktionen auf drei Punkte gedrückt werden muß, aber für eine Produktion von 1942 aller Ehren Wert ist.
Hoffentlich läßt Koch Media weitere Veröffentlichungen dieser bemerkenswerten Reihe in gleicher Qualität vom Stapel
Puristen sei noch gesagt, daß sich der FSK Flatschen, wenn auch schwer, abziehen läßt, so daß eine vorherige Wärmebehandlung unbedingt anzuraten ist, will man es sich mit dem Cover nicht verscherzen.
In einem Präriekaff wird ein Farmer tot aufgefunden. Schnell finden sich Verdächtige: Drei Reisende, die mit dem Farmer gesehen wurden.
Der Lynch Mob, aber auch einige gemäßigte Kreaturen fackeln nicht lange und nehmen die Verfolgung auf, da der Sherriff gerade nicht in der City ist.
Als die drei vermeintlichen Mörder, die sich aber als Farmer zu erkennen geben, einen Teil der Rinder des getöteten mit sich führen ohne dafür einen Kaufbeleg vorweisen zu können, und einer von Ihnen sich dummerweise auch noch im Besitz des Revolvers des Farmers befindet, gerät der Mob in Wallung und fordert Vergeltung um sich wieder besänftigen zu können.
Die drei vermeintlichen Mörder und Viehdiebe sollen hängen. Und zwar an Ort und Stelle.
Was sich nun entspinnt ist eine Verhandlungsdrama nach dem Muster der zwölf Geschworenen: Eine Anfangs eindeutige Situation gerät bei genauerer Betrachtung mehr und mehr ins Wanken, bis sich herausstellt, daß eine Verurteilung nicht mehr durch Fakten belegt werden kann, sondern nur noch durch den eigenen Racheinstinkt legitimiert worden ist.
Also auch wenn das Muster der Grundhandlung relativ simpel gestrickt ist, so ist die Entwicklung der Verhandlung auf Grund der ungesicherten Faktenlage, der Zwist der rivalisierenden Gruppen im Moblager (Geist gegen Gefühl) und die Reaktion der von Todesangst geplagten Angeklagten durchgehend von Spannung und fesselnden Wendungen geprägt.
Deshalb kann man auf Grund des Fehlens der Western typischen Elemente wie weite Prärielandschaften, kecke Farmerstochter, wilde Schießerei am Rio Grande oder tückische Indianerstämme auch eher von einem Drama im wilden Westen als von einem echten Western sprechen.
Das Fehlen dieser Elemente wird aber durch den bis in die Nebenrollen hervorragenden Cast wieder wett gemacht, der durch etwas besticht, wovon die heutige Schauspielergeneration nur noch träumen kann: Charakter.
So überzeugen auch der Cast um Henry Fonda und Anthony Quinn herum mit einer Ausstrahlungskraft, die mit der Verruchtheit oder aber eben mit der Erhabenheit Ihrer Charaktere Hand in Hand gehen, so daß das sülzig pathetische Ende, bei dem Gottes Wille in dem amerikanische Geist seine Vollendung gefunden zu haben scheint, leicht verdaut werden kann und nur ein geringes Geschmäckle hinterläßt.
Zum Schluß läßt sich sagen, daß das Bild durchweg HD Niveau besitzt und nur durch den Vergleich mit aktuellen Produktionen auf drei Punkte gedrückt werden muß, aber für eine Produktion von 1942 aller Ehren Wert ist.
Hoffentlich läßt Koch Media weitere Veröffentlichungen dieser bemerkenswerten Reihe in gleicher Qualität vom Stapel
Puristen sei noch gesagt, daß sich der FSK Flatschen, wenn auch schwer, abziehen läßt, so daß eine vorherige Wärmebehandlung unbedingt anzuraten ist, will man es sich mit dem Cover nicht verscherzen.
mit 4
mit 3
mit 3
mit 2
bewertet am 10.02.12 um 13:37
Top Angebote
kleinhirn
GEPRÜFTES MITGLIED
FSK 18
Aktivität
Forenbeiträge0
Kommentare41
Blogbeiträge0
Clubposts0
Bewertungen510
Mein Avatar
Weitere Funktionen
(510)
(16)
Beste Bewertungen
kleinhirn hat die folgenden 4 Blu-rays am besten bewertet:
Letzte Bewertungen
Filme suchen nach
Mit dem Blu-ray Filmfinder können Sie Blu-rays nach vielen unterschiedlichen Kriterien suchen.
Die Filmbewertungen von kleinhirn wurde 341x besucht.