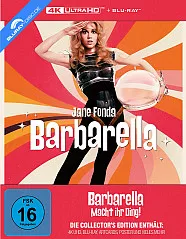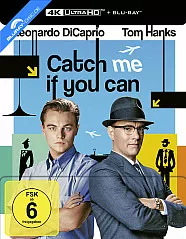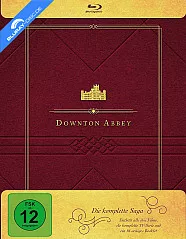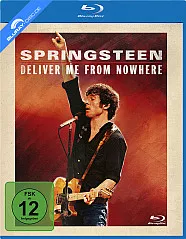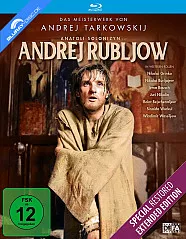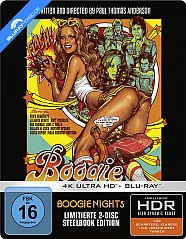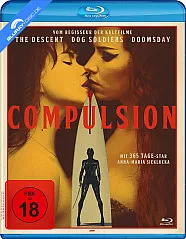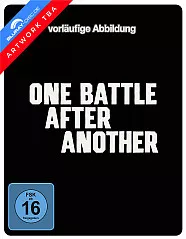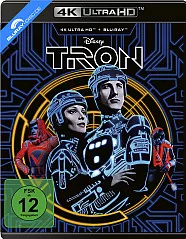"Alien: Romulus": Ab 24. April 2026 bei Amazon und im Leonine Studios Shop auf UHD Blu-ray im Steelbook"Evil Nun": The-Asylum-Horror kommt im Februar 2026 auf Blu-ray Disc herausAb 29.05. auf Blu-ray im Mediabook: "Hakaba Kitaro - Der Junge vom Friedhof - Vol. 2""Breakdown" ab 29.01. auf UHD Blu-ray im Keep Case und "Oderbruch"-Mediabooks ab 12.02. bundesweit erhältlichDer letzte Film von Wolfgang Becker: "Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße" ab 16.04. auf Blu-ray Disc2026 von Shamrock Media: Mehrere Mediabook-Editionen und "D-Tox - Im Auge der Angst" auf Blu-rayJetzt im Kino: "Lurker" von Alex Russell – im kommenden Jahr auf Blu-ray Disc erhältlich"Golgota - Flor de Carne": Horrorfilm erscheint als "VHS Design Edition" auf Blu-ray"Sie verkaufen den Tod" aka "Der Dicke und das Warzenschwein" mit Bud Spencer auf Blu-ray in Mediabooks"Capelight Adventskalender"-Tag 18: "Dawson’s Creek - Die komplette Serie" auf Blu-ray für 66,66€
NEWSTICKER
Gerade gesehen: Cloud Atlas
15. November 2012Wenn es einem Film gelingt, dass ich nach Ende des Abspanns noch wie gebannt im Kinosessel sitze, versuche meinen Gefühlshaushalt wieder in Ordnung zu bringen und am liebsten alle Menschen um mich herum umaramen möchte. Dann, ja dann, hat der Film einiges richtig gemacht. So wie Cloud Atlas.
Eines vorweg: Dieser Film wird nicht jedem gefallen. Manch einer wird mir womöglich einen Hang zum Pathos vorwerfen, andere werden sagen ich wäre voreigenommen, weil ich die Romanvorlage von David Mitchell so liebe. Ich kann die Kritikpunkte, die im Forum schon bald über den Film hereinbrechen, schon förmlich vor mir sehen. Manche werden da schreiben, die Episoden des Films, seien absolut zusammenhanglos. Es wird einige geben, die sagen dass ihnen die eine Geschichte ja wirklich gefallen hätte, der Rest sei aber eher so lala... Es wird viel Häme geben und ich bin mir sicher, dass die üblichen Verdächtigen wieder sagen werden, die Macher seien hier an ihren eigenen Ambitionen gescheitert. Sind sie meines Erachtens nicht und ich versteige mich hier gern zu der Aussage, dass Cloud Atlas der wichtigste Film des Jahres ist. Und das ist nicht selbstverständlich. Wie oft kommt es schon vor, dass eine Verfilmung anspruchsvoller Literatur ihrer Vorlage tatsächlich auf Augenhöhe begegnet?
Aber der Reihe nach, worum geht’s eigentlich? David Mitchell hat in seinem Roman „der Wolkenatlas“ eine Geschichte erzählt, die sich aus sechs einzelnen Episoden zusammensetzen und scheinbar nur lose verbunden sind. Die Aussage und das eigentliche Wesen der Geschichte erschließt sich dem Leser erst gegen Ende des mit seinen 600 eng bedruckten Seiten nicht gerade schlanken Buches, das ich so sehr liebe. Die Geschichten spielen über einen Zeitraum von über 500 Jahren und es ist Mitchells schriftstellerischer Klasse geschuldet, dass jede einzelne Geschichte einen eigenen Stil hat, die sie von den anderen abhebt. Der Reisebericht des Adam Ewing etwa wurde in der Sprache des 19 Jahrhunderts verfasst, die Geschichte um die Anwältin Luisa Rey dagegen wie ein Roman des späten 20 Jahrhunderts. Wie soll man sowas verfilmen? - Zumm Beispiel dadurch, dass man direkt der Regisseure an den Stoff setzt, die ihre eigenen Stile entfalten. Kritiker werden sagen, die einzelnen episoden wirken teils zusammenhanglos und man könne doch deutlich die Unterschiede zwichen den Arbeiten Tykwers und jenen der Wachowskis erkennen. Die Erklärung, dass diese Stilbrüche durchaus beabsichtigt sind, werden sie nicht anerkennen.
Zur Geschichte. Der englische Anwalt Adam Ewing unternimmt 1849 eine Seereise durch den südlichen Pazifik und macht die Bekanntschaft eines Maorisklaven. Die beiden retten sich gegenseitig ihre Leben, Ewing wirdmet sich fortan der Sklavenbefreieung. Seine Reiseberichte fallen 1936 dem jungen Komponisten Frobisher in die Hände der von ihnen inspiriert sein Wolkenatlas-Sextett schreibt. Ein musikalisches Meisterwerk, das den Neid eines Kollegen wachruft und damit sein Leben in Gefahr bringt. Eine der wenigen Kopien von Frobishers Musik ersteht die junge Journalistin Luisa Rey, die gerade an einer Enthüllungstory über Machenschaften im Umfeld eines Atomkraftwerks recherchiert, dessen Explosion den Tod vieler Menschen zur Folge hätte. Spätestens hier wird die Geschichte verkopft. Rey trifft auf den Physiker Sixmith, Jugendliebe von Frobisher, dessen Briefe ihr in die Hände fallen. Mehr noch: Wie die Geschichte um Rey tatsächlich ablief offenbaren weder Film noch Buch. Stattdessen sehen, bzw. lesen wir an dieser Stelle einen Roman dessen Manuskript der gealterte Kleinverleger Frobisher auf seinem Schreibtisch liegen hat. Dessen Geschichte mutet zunächst wie eine fragwürdige Slapstickeinlage an, die mit dem restlichen Ton des Films nun gar nichts mehr zu tun hat. Bis offenbart wird, dass sein Leben verfilmt wurde und im Neo-Seoul der fernen Zukunft von dem Klon Sonmi 451 gesehen wird. In dieser Zukunft wird die Welt als hyperkapitalistische Diktatur dargestellt, in der menschliche Klone für Dienstleistungen geschaffen werden. Sonmi 451 gelingt mit Hilfe von Rebellen der Ausbruch, sie opfert sich selbst um den Menschen die Wahrheit über das Regime mitzuteilen. Für ihren Mut wird sie in einer steinzeitlichen Postapokalypse als Gottheit verehrt. Puh...
Das Ganze wirkt, so kursorisch zusammengefasst konfus, dass es das aber keineswegs ist, ist das Verdienst der grandiosen Regisseure. Anders als im Buch, wo die Geschichten quasi nacheinander erzählt werden, montiert der Film die einzelnen Episoden so geschickt ineinander, dass man als Zuschauer kaum zu blinzeln wagt um nichts zu verpassen. So wie andere Filme zwischen den Handlungsorten springt Cloud Atlas zwischen den Zeiten und entflechtet so parallel die Eskalation der verschiedenen Episoden, deren Zusammenhang plötzlich offenbar wird. In allen Geschichten sehen wir Menschen, die bereit sind für ihre Überzeugungen einzustehen, Konventionen zu brechen und trotz aller Gefahren gegen herrschende Konventionen vorgehen. So selbstverständlich wie es einst die Sklaverei war, so selbstverständlich ist in unserer Zeit die Unterwerfung der Menschen unter die Wirtschaft, die schließlich in der Zukunft im Exzess endet. Den Höhepunkt der Geschichte bildet das Aufbegehren des jungen Adam Ewing, der für seine Überzeugung dass alle Menschen gleich sind mit seiner Familie bricht und sich dem Kampf gegen die Sklaverei verschreibt. Ihr Ende findet diese Science Fiction-Geschichte also in der Vergangenheit, von der man sich noch in der fernen Zukunft erzählt.
Und dann sitzt man nach fast drei Stunden im Kinosessel und möchte nicht aufstehen.
Eines vorweg: Dieser Film wird nicht jedem gefallen. Manch einer wird mir womöglich einen Hang zum Pathos vorwerfen, andere werden sagen ich wäre voreigenommen, weil ich die Romanvorlage von David Mitchell so liebe. Ich kann die Kritikpunkte, die im Forum schon bald über den Film hereinbrechen, schon förmlich vor mir sehen. Manche werden da schreiben, die Episoden des Films, seien absolut zusammenhanglos. Es wird einige geben, die sagen dass ihnen die eine Geschichte ja wirklich gefallen hätte, der Rest sei aber eher so lala... Es wird viel Häme geben und ich bin mir sicher, dass die üblichen Verdächtigen wieder sagen werden, die Macher seien hier an ihren eigenen Ambitionen gescheitert. Sind sie meines Erachtens nicht und ich versteige mich hier gern zu der Aussage, dass Cloud Atlas der wichtigste Film des Jahres ist. Und das ist nicht selbstverständlich. Wie oft kommt es schon vor, dass eine Verfilmung anspruchsvoller Literatur ihrer Vorlage tatsächlich auf Augenhöhe begegnet?
Aber der Reihe nach, worum geht’s eigentlich? David Mitchell hat in seinem Roman „der Wolkenatlas“ eine Geschichte erzählt, die sich aus sechs einzelnen Episoden zusammensetzen und scheinbar nur lose verbunden sind. Die Aussage und das eigentliche Wesen der Geschichte erschließt sich dem Leser erst gegen Ende des mit seinen 600 eng bedruckten Seiten nicht gerade schlanken Buches, das ich so sehr liebe. Die Geschichten spielen über einen Zeitraum von über 500 Jahren und es ist Mitchells schriftstellerischer Klasse geschuldet, dass jede einzelne Geschichte einen eigenen Stil hat, die sie von den anderen abhebt. Der Reisebericht des Adam Ewing etwa wurde in der Sprache des 19 Jahrhunderts verfasst, die Geschichte um die Anwältin Luisa Rey dagegen wie ein Roman des späten 20 Jahrhunderts. Wie soll man sowas verfilmen? - Zumm Beispiel dadurch, dass man direkt der Regisseure an den Stoff setzt, die ihre eigenen Stile entfalten. Kritiker werden sagen, die einzelnen episoden wirken teils zusammenhanglos und man könne doch deutlich die Unterschiede zwichen den Arbeiten Tykwers und jenen der Wachowskis erkennen. Die Erklärung, dass diese Stilbrüche durchaus beabsichtigt sind, werden sie nicht anerkennen.
Zur Geschichte. Der englische Anwalt Adam Ewing unternimmt 1849 eine Seereise durch den südlichen Pazifik und macht die Bekanntschaft eines Maorisklaven. Die beiden retten sich gegenseitig ihre Leben, Ewing wirdmet sich fortan der Sklavenbefreieung. Seine Reiseberichte fallen 1936 dem jungen Komponisten Frobisher in die Hände der von ihnen inspiriert sein Wolkenatlas-Sextett schreibt. Ein musikalisches Meisterwerk, das den Neid eines Kollegen wachruft und damit sein Leben in Gefahr bringt. Eine der wenigen Kopien von Frobishers Musik ersteht die junge Journalistin Luisa Rey, die gerade an einer Enthüllungstory über Machenschaften im Umfeld eines Atomkraftwerks recherchiert, dessen Explosion den Tod vieler Menschen zur Folge hätte. Spätestens hier wird die Geschichte verkopft. Rey trifft auf den Physiker Sixmith, Jugendliebe von Frobisher, dessen Briefe ihr in die Hände fallen. Mehr noch: Wie die Geschichte um Rey tatsächlich ablief offenbaren weder Film noch Buch. Stattdessen sehen, bzw. lesen wir an dieser Stelle einen Roman dessen Manuskript der gealterte Kleinverleger Frobisher auf seinem Schreibtisch liegen hat. Dessen Geschichte mutet zunächst wie eine fragwürdige Slapstickeinlage an, die mit dem restlichen Ton des Films nun gar nichts mehr zu tun hat. Bis offenbart wird, dass sein Leben verfilmt wurde und im Neo-Seoul der fernen Zukunft von dem Klon Sonmi 451 gesehen wird. In dieser Zukunft wird die Welt als hyperkapitalistische Diktatur dargestellt, in der menschliche Klone für Dienstleistungen geschaffen werden. Sonmi 451 gelingt mit Hilfe von Rebellen der Ausbruch, sie opfert sich selbst um den Menschen die Wahrheit über das Regime mitzuteilen. Für ihren Mut wird sie in einer steinzeitlichen Postapokalypse als Gottheit verehrt. Puh...
Das Ganze wirkt, so kursorisch zusammengefasst konfus, dass es das aber keineswegs ist, ist das Verdienst der grandiosen Regisseure. Anders als im Buch, wo die Geschichten quasi nacheinander erzählt werden, montiert der Film die einzelnen Episoden so geschickt ineinander, dass man als Zuschauer kaum zu blinzeln wagt um nichts zu verpassen. So wie andere Filme zwischen den Handlungsorten springt Cloud Atlas zwischen den Zeiten und entflechtet so parallel die Eskalation der verschiedenen Episoden, deren Zusammenhang plötzlich offenbar wird. In allen Geschichten sehen wir Menschen, die bereit sind für ihre Überzeugungen einzustehen, Konventionen zu brechen und trotz aller Gefahren gegen herrschende Konventionen vorgehen. So selbstverständlich wie es einst die Sklaverei war, so selbstverständlich ist in unserer Zeit die Unterwerfung der Menschen unter die Wirtschaft, die schließlich in der Zukunft im Exzess endet. Den Höhepunkt der Geschichte bildet das Aufbegehren des jungen Adam Ewing, der für seine Überzeugung dass alle Menschen gleich sind mit seiner Familie bricht und sich dem Kampf gegen die Sklaverei verschreibt. Ihr Ende findet diese Science Fiction-Geschichte also in der Vergangenheit, von der man sich noch in der fernen Zukunft erzählt.
Und dann sitzt man nach fast drei Stunden im Kinosessel und möchte nicht aufstehen.
Gerade gesehen: the Cabin in the Woods
9. September 2012Wenn das Horrorkino der letzten Jahre nicht schon schon tot war, so lag es doch verdächtig reglos auf dem Sterbebett. Was dem Zuschauer vorgesetzt wurde, erschöpfte sich in aller Regel in uninspirierten Gewaltorgien oder Remakes bekannter Klassiker. Wie erfrischend kommt dagegen the Cabin in the Woods daher, der auf leichte, augenzwinkernde Weise für eine Revitalisierung des Genres sorgt. Achtung, dieser Beitrag enthält Spoiler!
Nicht nur das Personal, nein das gesamte Szenario scheint dem Kanon des Teenieslashers entlehnt: Eine Gruppe von jungen Leuten, will das Wochenende in einer entlegenden Berghütte verbringen, trifft auf dem Weg dorthin auf einen sinistren Tankwart, der mit diffusen Drohungen für ein allenfalls leichtes Ansteigen der Spannungskurve sorgt. Es folgt eine alkoholgetränkte Party, etwas nackte Haut, der obligatorische 'jetzt jage ich meiner Freundin einen schrecken ein'-Moment, sowie die nicht minder obligatorische Entdeckung, dass man sich offenbar an einem Schausplatz aufhält, dessen Vergangenheit bei Weitem nicht so friedlich ist, wie es die Schönheit der Natur suggeriert.
So weit, so bekannt. Doch irgendetwas ist anders im Setting von 'the Cabin in the Woods'. Regisseur Drew Goddard führt direkt in der ersten Szene eine offenbar geheime Einrichtung ein, in der Wissenschaftler, vermeintlich im Regierungsauftrag, unsere dem Verderben geweihten Helden beobachten. Mehr noch, durch einfache Knopfdrücke können die Wissenschaftler das Geschehen in der Berghütte beeinflussen. Das Laborpersonal beginnt, sich mit Wetteinsätzen gegenseitig zu überbieten, wer denn nun den Tot der Studenten herbeiführen wird. Werden es Zombies sein, Kannibalen oder vielleicht doch der Wassermann?
Während das Geschehen in der Hütte seinen Lauf nimmt, wird im Labor bereits der Champus geöffnet, das Projekt steht schließlich unmittelbar vor seinem erfolgreichen Abschluss. Ein Kameraschwenk über zahlreiche Monitore zeigt, dass die Amerikaner damit ihren Kollegen in anderen Erdteilen um einiges voraus sind. Selbst die erfolgsverwöhnten Japaner scheinen beim Versuch, ein paar Schulkinder um die Ecke zu bringen zu scheitern.
Doch warum das alles? Während beim Zuschauer der Grad an Verwirrung steigt, lässt Goddard immer mehr Hinweise einfließen, dass Kammerstück in der Hütte sei nichts anderes als ein Opferritual ist, bei dem die 'alten Götter' besänftigt werden sollen, andernfalls wäre das Ende der Welt unausweichlich. Dumm nur, dass in der Hütte nicht nur die Jungfrau, deren Ableben zwar wünschenswert, aber nicht notwendig ist, überlebt, sondern auch noch der bereits totgeglaubte Kiffer auf den inszenierten Hintergrund ihres Abenteuers stößt.
Was folgt ist ein Parforceritt durch die Geschichte des Horrorkinos, in dem nicht nur Mumien und Zombies, sondern auch Axtmörder und (jaja) der Wassermann aus ihren unterirdischen Zellen ausbrechen und in der Forschungseinrichtung ein Blutbad anrichten.
Produzent Joss Whedon und Regisseur Drew Goddard legen mit ihrem Film den Versuch einer Dekonstruktion des Horrogenres im Allgemeinen vor, schrecken dabei weder vor dem Zitat von Größen wie Poe (Gruselhaus) oder Lovecraft (alte Götter) zurück, sondern flechten auch geschickt Versatzstücke zeitgenössischer Pop- und Trashkultur (Teenieslasher, Tortureporn) ein. Der Film funktioniert dabei auf verschiedenen Metaebenen, die den Zuschauer nicht nur als Komplizen der drahtziehenden Wissenschaftler enttarnt, sondern zugleich das gesamte Genre und seine zwangläufigen Stereotypen offenlegt und augenzwinkernd reproduziert. Damit stellt 'the Cabin in the Woods' zugleich eine Verneigung, sowie eine Persiflage auf das Genre dar und trägt im Idealfall gar zu einer Reflexion des Sehverhaltens seiner Zuschauer bei.
So muss Kino sein. Ein großartiger Film.
Nicht nur das Personal, nein das gesamte Szenario scheint dem Kanon des Teenieslashers entlehnt: Eine Gruppe von jungen Leuten, will das Wochenende in einer entlegenden Berghütte verbringen, trifft auf dem Weg dorthin auf einen sinistren Tankwart, der mit diffusen Drohungen für ein allenfalls leichtes Ansteigen der Spannungskurve sorgt. Es folgt eine alkoholgetränkte Party, etwas nackte Haut, der obligatorische 'jetzt jage ich meiner Freundin einen schrecken ein'-Moment, sowie die nicht minder obligatorische Entdeckung, dass man sich offenbar an einem Schausplatz aufhält, dessen Vergangenheit bei Weitem nicht so friedlich ist, wie es die Schönheit der Natur suggeriert.
So weit, so bekannt. Doch irgendetwas ist anders im Setting von 'the Cabin in the Woods'. Regisseur Drew Goddard führt direkt in der ersten Szene eine offenbar geheime Einrichtung ein, in der Wissenschaftler, vermeintlich im Regierungsauftrag, unsere dem Verderben geweihten Helden beobachten. Mehr noch, durch einfache Knopfdrücke können die Wissenschaftler das Geschehen in der Berghütte beeinflussen. Das Laborpersonal beginnt, sich mit Wetteinsätzen gegenseitig zu überbieten, wer denn nun den Tot der Studenten herbeiführen wird. Werden es Zombies sein, Kannibalen oder vielleicht doch der Wassermann?
Während das Geschehen in der Hütte seinen Lauf nimmt, wird im Labor bereits der Champus geöffnet, das Projekt steht schließlich unmittelbar vor seinem erfolgreichen Abschluss. Ein Kameraschwenk über zahlreiche Monitore zeigt, dass die Amerikaner damit ihren Kollegen in anderen Erdteilen um einiges voraus sind. Selbst die erfolgsverwöhnten Japaner scheinen beim Versuch, ein paar Schulkinder um die Ecke zu bringen zu scheitern.
Doch warum das alles? Während beim Zuschauer der Grad an Verwirrung steigt, lässt Goddard immer mehr Hinweise einfließen, dass Kammerstück in der Hütte sei nichts anderes als ein Opferritual ist, bei dem die 'alten Götter' besänftigt werden sollen, andernfalls wäre das Ende der Welt unausweichlich. Dumm nur, dass in der Hütte nicht nur die Jungfrau, deren Ableben zwar wünschenswert, aber nicht notwendig ist, überlebt, sondern auch noch der bereits totgeglaubte Kiffer auf den inszenierten Hintergrund ihres Abenteuers stößt.
Was folgt ist ein Parforceritt durch die Geschichte des Horrorkinos, in dem nicht nur Mumien und Zombies, sondern auch Axtmörder und (jaja) der Wassermann aus ihren unterirdischen Zellen ausbrechen und in der Forschungseinrichtung ein Blutbad anrichten.
Produzent Joss Whedon und Regisseur Drew Goddard legen mit ihrem Film den Versuch einer Dekonstruktion des Horrogenres im Allgemeinen vor, schrecken dabei weder vor dem Zitat von Größen wie Poe (Gruselhaus) oder Lovecraft (alte Götter) zurück, sondern flechten auch geschickt Versatzstücke zeitgenössischer Pop- und Trashkultur (Teenieslasher, Tortureporn) ein. Der Film funktioniert dabei auf verschiedenen Metaebenen, die den Zuschauer nicht nur als Komplizen der drahtziehenden Wissenschaftler enttarnt, sondern zugleich das gesamte Genre und seine zwangläufigen Stereotypen offenlegt und augenzwinkernd reproduziert. Damit stellt 'the Cabin in the Woods' zugleich eine Verneigung, sowie eine Persiflage auf das Genre dar und trägt im Idealfall gar zu einer Reflexion des Sehverhaltens seiner Zuschauer bei.
So muss Kino sein. Ein großartiger Film.
Gerade gesehen: to Rome with Love
5. September 2012Dem Gesetz der Serie folgend, dürfte Woody Allens neuer Film eher Durchschnittskost sein. Selten schaffte es der Altmeister schließlich in den letzten Jahren zwei gute Filme hintereinander zu drehen. Doch Überraschung: der Nachfolger von 'Midnight in Paris' weiß durchaus zu gefallen.
Nun also Rom. Nach London, Barcelona und Paris muss nun also Italiens Hauptstadt als Kulisse für Woody Allen herhalten. Das Genre 'leichte Sommerkomödie' seiner teils sehr erfolgreichen Vorgänger behält Allen bei, wählt für seinen Romfilm jedoch die Episodenform um seine Geschichte(n) zu erzählen. Im Mittelpunkt stehen dabei weniger seine Protagonisten, als viel mehr die Stadt selbst, die hier zum heimlichen Hauptdarsteller avanciert. Und so ist es tatsächlich schwierig, 'to Rome with Love' inhaltlich zusammenzufassen. Zu (allentypisch) skurill sind seine Figuren, zu diffus die einzelnen Handlungsstränge.

Und doch gelingt es dem Film, den Zuschauer in seinen Bann zu ziehen. Ausschlaggebend ist dafür sicher, dass man sich mit sämtlichen Figuren und ihrem Umfeld sofort vertraut fühlt, fügen sie sich doch nahtlos in den Allenkosmos ein. Da wäre zum Beispiel die pseudo-intellektuelle Schauspielrin Monica, gespielt von der bezaubernden Ellen Page, die den naiven Architekturstudenten Jack (Jesse Eisenberg) um den Finger wickelt. Und das obwohl dieser mit dem scheinbar allwissenden Beobachter John (Alec Baldwin) einen konsequenten Mahner und Warner an seiner Seite, oder besser: in seinem Kopf hat.
In einer zweiten Geschichte lernen wir einen Bestattungsunternehmer (Robert Benigni) kennen, der unter der Dusche zum Startenor avanciert, auf der Bühne jedoch kaum einen Ton trifft und damit die Kreativität des erfolglosen („Er war seiner Zeit stets voraus.“) pensionierten Opernregisseur Jerry (Woody Allen persönlich) heraus fordert. Dann ist da noch der Büroangestellte Leopoldo, dem auf dem Weg zur Arbeit urplötzlich einer Heerschar von Journalisten auflauert, der ohne etwas dafür getan zu haben von Fans um Autogramme gebeten wird, dem Models um den Hals fallen und dessen Ruhm genauso schnell verblasst wie er kam. Und schließlich Penelope Cruz, als leichtes Mädchen das nach einer Verwechslung die brave Verlobte einen kleinstädtischen Nachwuchsmanager geben muss.

Zusammenhang zwischen diesen Episoden? Fehlanzeige. Und dennoch verlässt man den Kinosaal mit einem breiten Grinsen und dem guten Gefühl, mal wieder einen typischen Allen gesehen zu haben. Das liegt nicht zuletzt daran, dass der Altmeister erstmals seit Scoop (2006) wieder selbst vor die Kamera tritt und mit einigen bissigen Gags an seine großen Zeiten erinnert.
Nein, 'to Rome with Love' erreicht zu keinem Zeitpunkt die Klasse von 'Midnight in Paris'. Dennoch gehört der Film zweifellos zu den besseren Allen-Filmen der letzten Jahre.
PS Ja, es ist mir tatsächlich gelungen, diesen Text ohne die Floskel von den vielen Wegen nach Rom, zu schreiben...
Bilder (c) http://http://www.toromewithlove.de/
Nun also Rom. Nach London, Barcelona und Paris muss nun also Italiens Hauptstadt als Kulisse für Woody Allen herhalten. Das Genre 'leichte Sommerkomödie' seiner teils sehr erfolgreichen Vorgänger behält Allen bei, wählt für seinen Romfilm jedoch die Episodenform um seine Geschichte(n) zu erzählen. Im Mittelpunkt stehen dabei weniger seine Protagonisten, als viel mehr die Stadt selbst, die hier zum heimlichen Hauptdarsteller avanciert. Und so ist es tatsächlich schwierig, 'to Rome with Love' inhaltlich zusammenzufassen. Zu (allentypisch) skurill sind seine Figuren, zu diffus die einzelnen Handlungsstränge.

Und doch gelingt es dem Film, den Zuschauer in seinen Bann zu ziehen. Ausschlaggebend ist dafür sicher, dass man sich mit sämtlichen Figuren und ihrem Umfeld sofort vertraut fühlt, fügen sie sich doch nahtlos in den Allenkosmos ein. Da wäre zum Beispiel die pseudo-intellektuelle Schauspielrin Monica, gespielt von der bezaubernden Ellen Page, die den naiven Architekturstudenten Jack (Jesse Eisenberg) um den Finger wickelt. Und das obwohl dieser mit dem scheinbar allwissenden Beobachter John (Alec Baldwin) einen konsequenten Mahner und Warner an seiner Seite, oder besser: in seinem Kopf hat.
In einer zweiten Geschichte lernen wir einen Bestattungsunternehmer (Robert Benigni) kennen, der unter der Dusche zum Startenor avanciert, auf der Bühne jedoch kaum einen Ton trifft und damit die Kreativität des erfolglosen („Er war seiner Zeit stets voraus.“) pensionierten Opernregisseur Jerry (Woody Allen persönlich) heraus fordert. Dann ist da noch der Büroangestellte Leopoldo, dem auf dem Weg zur Arbeit urplötzlich einer Heerschar von Journalisten auflauert, der ohne etwas dafür getan zu haben von Fans um Autogramme gebeten wird, dem Models um den Hals fallen und dessen Ruhm genauso schnell verblasst wie er kam. Und schließlich Penelope Cruz, als leichtes Mädchen das nach einer Verwechslung die brave Verlobte einen kleinstädtischen Nachwuchsmanager geben muss.

Zusammenhang zwischen diesen Episoden? Fehlanzeige. Und dennoch verlässt man den Kinosaal mit einem breiten Grinsen und dem guten Gefühl, mal wieder einen typischen Allen gesehen zu haben. Das liegt nicht zuletzt daran, dass der Altmeister erstmals seit Scoop (2006) wieder selbst vor die Kamera tritt und mit einigen bissigen Gags an seine großen Zeiten erinnert.
Nein, 'to Rome with Love' erreicht zu keinem Zeitpunkt die Klasse von 'Midnight in Paris'. Dennoch gehört der Film zweifellos zu den besseren Allen-Filmen der letzten Jahre.
PS Ja, es ist mir tatsächlich gelungen, diesen Text ohne die Floskel von den vielen Wegen nach Rom, zu schreiben...
Bilder (c) http://http://www.toromewithlove.de/
Gerade gesehen: the Amazing Spider-Man
28. Juni 2012Es ist gerade einmal zehn Jahre her, dass Sam Raimi seine Spider-Man Reihe startete und damit nicht unwesentlich zu dem Superheldenboom beitrug, der in den Folgejahren im Kino ausbrach. Jetzt beginnt die Geschichte von vorn. Achtung, dieser Beitrag enthält Spoiler!
Ich muss gestehen, ich war skeptisch als ich davon hörte, dass Spideys Geschichte einen Reboot erfahren soll. Als bekennder Fan der Raimi-Filme hielt ich dies schlicht für unnötig. So viel vorweg: Der 'neue' Spider-Man hat ohne zweifel seine Daseinsberechtigung. Denn der neue Regisseur Marc Webb (fame of (500) Days of Summer) erzählt die Geschichte auf eine vollkommen neue Art und Weise.
Man merkt dem Film durchaus an, dass sein Regisseur aus dem Indiebereich stammt. So
nimmt sich der Streifen sehr viel Zeit dafür, seinen Protagonisten einzuführen und er tut meines Erachtens nach gut daran. Insbesondere weil uns der Peter Parker aus den Raimi-Filmen noch so präsent ist, halte ich es für eine wirklich gute Sache, dass man der Figur hier mehr Platz für ihre Charakterisierung einräumt. Eine komplette Stunde verwendet Webb darauf, Parker in seinem Highschool-Alltag zu zeigen, auf seinen familiären Background einzugehen und uns die Figur von allen Seiten vorzustellen. Gerade in dieser Grauzone aus Teenieromanze und Selbstfindung eines depressiven Jugendlichen fühlt er sich wohl und zeigt was er kann.

Wir sehen in Rückblenden, wie der junge Peter von seinen Eltern getrennt wurde, wie diese ihr Leben verloren und er in der Folge von seiner Tante May und seinem Onkel Ben aufgezogen wurde. Wir folgen Parker durch seinen Schulalltag, in dem der Außenseiter häufig auf die Nase fällt. Und so ist der Grundton des Streifens ist in der Tat deutlich düsterer als man es womöglich von Spidey erwarten würde.Tatsächlich dachte ich in den ersten Minuten, ohje, das wird hier eine todernste Angelegenheit. Aber weit gefehlt: Der Humor passt und wirkt in keinem Moment gestellt. Insbesondere wenn Peter seine Maske überstreift, gibt er sich regelrecht extrovertiert, scherzt nicht nur mit Polizisten, sondern macht sich gar über die Schurken lustig, die er gerade zur Strecke bringt.
Was die Darsteller betrifft bin ich geteilter Meinung. Emma Stone ist bezaubernd und souverän wie immer. Da gibt es nichts zu deuteln. Andrew Garfield ist da eher ambivalent zu sehen. Von seiner Erscheinung, seinem Look her ist er definitiv eine Traumbesetzung. Nur ist er halt kein wirklich guter Schauspieler. Irgendwie neigt er fast die gesamte Spieldauer über zum Overacting, seine Mimik erinnert streckenweise ans Schultheater. Ich will seine Leistung jetzt nicht komplett schlecht reden, aber ich sehe hier tatsächlich die größte Schwäche des Films.

Die Geschichte als solche bietet nicht viel Neues und folgt im Wesentlichen dem Schema, wie wir es von anderen Superheldenfilmen her kennen. Was mir gut gefallen hat, ist jedoch dass hier einige offene Fragen gestellt und allenfalls diskrete Fährten gestreut wurden, in welche Richtung sich die Reihe entwickeln wird. Aber genau das ist das tolle: Als Zuschauer merkt man, dass der Film einem Plan folgt und dieser Streifen erst der Anfang einer Geschichte ist. Genau das war es damals auch, was Raimis Filme ausgezeichnet hat. Die Figuren entwickelten sich über die Filme hinweg, Webb geht gar noch einen Schritt weiter und lässt uns über viele Hintergründe seiner Geschichte im Dunkeln. Das beweist Mut und wird hoffentlich belohnt.
Marc Webbs Film passt perfekt in unsere Zeit, genau wie Raimis Filme vor zehn Jahren gepasst … hätten. Raimi konzipierte seine Reihe 2000/01, vor 9/11 und so ist es kein Zufall dass seine Filme bunt wurden und vor Optimismus strotzten. Webb hingegen erzählt seine Geschichte vor dem Hintergrund der Krise. Wenn sich Spidey bei ihm durch die Häuserschlichten schwingt, erinnern die Straßenzüge unter ihm eher an Nolans Gotham, als an Raimis New York. Nein, den Vergleich mit den Raimi-Filmen muss the Amazing Spider-Man nicht scheuen. Wir haben es hier schlicht mit einer neuen Interpretation zu tun, die schlicht Ausdruck ihrer Zeit ist. Und so können beide Reihen wunderbar nebeneinander stehen. Ich freue mich schon jetzt auf Teil zwei.
Bilder: (c)http://www.facebook.com/spidermanfilm
Ich muss gestehen, ich war skeptisch als ich davon hörte, dass Spideys Geschichte einen Reboot erfahren soll. Als bekennder Fan der Raimi-Filme hielt ich dies schlicht für unnötig. So viel vorweg: Der 'neue' Spider-Man hat ohne zweifel seine Daseinsberechtigung. Denn der neue Regisseur Marc Webb (fame of (500) Days of Summer) erzählt die Geschichte auf eine vollkommen neue Art und Weise.
Man merkt dem Film durchaus an, dass sein Regisseur aus dem Indiebereich stammt. So
nimmt sich der Streifen sehr viel Zeit dafür, seinen Protagonisten einzuführen und er tut meines Erachtens nach gut daran. Insbesondere weil uns der Peter Parker aus den Raimi-Filmen noch so präsent ist, halte ich es für eine wirklich gute Sache, dass man der Figur hier mehr Platz für ihre Charakterisierung einräumt. Eine komplette Stunde verwendet Webb darauf, Parker in seinem Highschool-Alltag zu zeigen, auf seinen familiären Background einzugehen und uns die Figur von allen Seiten vorzustellen. Gerade in dieser Grauzone aus Teenieromanze und Selbstfindung eines depressiven Jugendlichen fühlt er sich wohl und zeigt was er kann.

Wir sehen in Rückblenden, wie der junge Peter von seinen Eltern getrennt wurde, wie diese ihr Leben verloren und er in der Folge von seiner Tante May und seinem Onkel Ben aufgezogen wurde. Wir folgen Parker durch seinen Schulalltag, in dem der Außenseiter häufig auf die Nase fällt. Und so ist der Grundton des Streifens ist in der Tat deutlich düsterer als man es womöglich von Spidey erwarten würde.Tatsächlich dachte ich in den ersten Minuten, ohje, das wird hier eine todernste Angelegenheit. Aber weit gefehlt: Der Humor passt und wirkt in keinem Moment gestellt. Insbesondere wenn Peter seine Maske überstreift, gibt er sich regelrecht extrovertiert, scherzt nicht nur mit Polizisten, sondern macht sich gar über die Schurken lustig, die er gerade zur Strecke bringt.
Was die Darsteller betrifft bin ich geteilter Meinung. Emma Stone ist bezaubernd und souverän wie immer. Da gibt es nichts zu deuteln. Andrew Garfield ist da eher ambivalent zu sehen. Von seiner Erscheinung, seinem Look her ist er definitiv eine Traumbesetzung. Nur ist er halt kein wirklich guter Schauspieler. Irgendwie neigt er fast die gesamte Spieldauer über zum Overacting, seine Mimik erinnert streckenweise ans Schultheater. Ich will seine Leistung jetzt nicht komplett schlecht reden, aber ich sehe hier tatsächlich die größte Schwäche des Films.

Die Geschichte als solche bietet nicht viel Neues und folgt im Wesentlichen dem Schema, wie wir es von anderen Superheldenfilmen her kennen. Was mir gut gefallen hat, ist jedoch dass hier einige offene Fragen gestellt und allenfalls diskrete Fährten gestreut wurden, in welche Richtung sich die Reihe entwickeln wird. Aber genau das ist das tolle: Als Zuschauer merkt man, dass der Film einem Plan folgt und dieser Streifen erst der Anfang einer Geschichte ist. Genau das war es damals auch, was Raimis Filme ausgezeichnet hat. Die Figuren entwickelten sich über die Filme hinweg, Webb geht gar noch einen Schritt weiter und lässt uns über viele Hintergründe seiner Geschichte im Dunkeln. Das beweist Mut und wird hoffentlich belohnt.
Marc Webbs Film passt perfekt in unsere Zeit, genau wie Raimis Filme vor zehn Jahren gepasst … hätten. Raimi konzipierte seine Reihe 2000/01, vor 9/11 und so ist es kein Zufall dass seine Filme bunt wurden und vor Optimismus strotzten. Webb hingegen erzählt seine Geschichte vor dem Hintergrund der Krise. Wenn sich Spidey bei ihm durch die Häuserschlichten schwingt, erinnern die Straßenzüge unter ihm eher an Nolans Gotham, als an Raimis New York. Nein, den Vergleich mit den Raimi-Filmen muss the Amazing Spider-Man nicht scheuen. Wir haben es hier schlicht mit einer neuen Interpretation zu tun, die schlicht Ausdruck ihrer Zeit ist. Und so können beide Reihen wunderbar nebeneinander stehen. Ich freue mich schon jetzt auf Teil zwei.
Bilder: (c)http://www.facebook.com/spidermanfilm
Gerade gesehen: Extrem laut und unglaublich nah
18. Februar 2012Wenn das Herz entscheiden dürfte, wer das Rennen um den Oscar für den besten Film in diesem Jahr gewinnt, dann käme man an Stephen Daldrys neuem Film wohl nicht vorbei. „Extrem laut & unglaublich nah“ ist schließlich so viel mehr als nur eine weitere Geschichte über den 11. September.
Allein die Namen der Besetzung und der Crew schreien nach dem Oscar: Tom Hanks, Sandra Bullock, in den Nebenrollen John Goodwin, Max von Sydow, James Gandolfini und Jeffrey Wright, dazu der hochgelobte Regisseur Daldry, Kameramann Chris Menges und Drehbuchautor Eric Roth. Wenn man alle Nominierungen und gewonnen preise dieser Truppe zusammenzählt kommt man auf eine nicht gerade niedrige Summe und dennoch kommt „Extrem laut & unglaublich nah“ bei den Kritikern nicht gut weg. Der Grund dafür ist einfach: Die Geschichte wird überall auf die 9/11-Story reduziert die für sie den Hintergrund bildet. Das Wesen des Films wird dabei vielfach übersehen.

Dieser erzählt die Geschichte des zehnjährigen Oskar Shell, dessen Vater bei den Anschlägen auf das WTC sein Leben verloren hat. In dessen Hinterlassenschaften findet der Junge einen Umschlag, darin ein Schlüssel, darauf notiert der begriff 'Black'. Schnell wird klar, 'Black' muss ein Name sein, vermutlich der eines Menschen, der weiß in welches Schloss der Schlüssel passt. Für Oskar ist klar, er muss diesen Menschen finden, nur so kann er die Erinnerung an seinen Vater bewahren. Das Problem: In New York gibt es Hunderte von Blacks. Für Oskar beginnt eine Reise durch die fünf Bezirke der Metropole auf der er unzählige skurrile Persönlichkeiten kennen lernt und ganz nebenbei das Geheimnis um die Geschichte seiner Familie löst.
Daldry schafft es hier, den Bestseller Jonathan Safran Foers in einen phantastischen Film zu übersetzen, ohne dabei die Fehler zu wiederholen die die die Romanvorlage begangen hat. Wo das Buch überladen war, konzentriert sich der Film auf das Wesentliche. So hat Daldry die skurrilsten Blacks aus dem Buch schlicht gestrichen, so beleuchtet er die Rahmenhandlung um den Zweiten Weltkrieg allenfalls zwischen den Zeilen. Statt dessen konzentriert er sich voll auf seinen Protagonisten Oskar (Thomas Horn) und erzählt durch die Augen des Kindes, wie schwierig es ist, das Unbegreifliche rational zu fassen.

Denn genau das ist das eigentliche Thema dieses Films: Die Suche nach Erklärungen für das, was der Verstand des Menschen schlicht nicht verstehen kann. Den plötzlichen Verlust eines geliebten Angehörigen, der das Leben der Hinterbliebenen so radikal ändert, wie es wohl kein anderes Ereignis vermag. Und doch geht das Leben in all seinen Farben und Facetten weiter. 9/11 ist allenfalls der Anlass für diese Geschichte, nicht aber ihr Thema. Der Film über den kleinen Jungen, der unermüdlich auf der Suche nach Antworten auf seine Fragen ist, ist somit letztlich die schönste Liebeserklärung an das Leben und die Menschen dieses Kinowinters. Dass dabei auch gehörig auf die Tränendrüse gedrückt wird und mit unter auch etwas viel Pathos mitschwingt versteht sich von selbst. Aber mal ehrlich: Gehen wir nicht auch dafür ins Kino?
In meinen Augen ein mehr als würdiger Oscaranwärter!
Bilder: © http://wwws.warnerbros.de/extremelyloudandincrediblyclose/index.html
Allein die Namen der Besetzung und der Crew schreien nach dem Oscar: Tom Hanks, Sandra Bullock, in den Nebenrollen John Goodwin, Max von Sydow, James Gandolfini und Jeffrey Wright, dazu der hochgelobte Regisseur Daldry, Kameramann Chris Menges und Drehbuchautor Eric Roth. Wenn man alle Nominierungen und gewonnen preise dieser Truppe zusammenzählt kommt man auf eine nicht gerade niedrige Summe und dennoch kommt „Extrem laut & unglaublich nah“ bei den Kritikern nicht gut weg. Der Grund dafür ist einfach: Die Geschichte wird überall auf die 9/11-Story reduziert die für sie den Hintergrund bildet. Das Wesen des Films wird dabei vielfach übersehen.

Dieser erzählt die Geschichte des zehnjährigen Oskar Shell, dessen Vater bei den Anschlägen auf das WTC sein Leben verloren hat. In dessen Hinterlassenschaften findet der Junge einen Umschlag, darin ein Schlüssel, darauf notiert der begriff 'Black'. Schnell wird klar, 'Black' muss ein Name sein, vermutlich der eines Menschen, der weiß in welches Schloss der Schlüssel passt. Für Oskar ist klar, er muss diesen Menschen finden, nur so kann er die Erinnerung an seinen Vater bewahren. Das Problem: In New York gibt es Hunderte von Blacks. Für Oskar beginnt eine Reise durch die fünf Bezirke der Metropole auf der er unzählige skurrile Persönlichkeiten kennen lernt und ganz nebenbei das Geheimnis um die Geschichte seiner Familie löst.
Daldry schafft es hier, den Bestseller Jonathan Safran Foers in einen phantastischen Film zu übersetzen, ohne dabei die Fehler zu wiederholen die die die Romanvorlage begangen hat. Wo das Buch überladen war, konzentriert sich der Film auf das Wesentliche. So hat Daldry die skurrilsten Blacks aus dem Buch schlicht gestrichen, so beleuchtet er die Rahmenhandlung um den Zweiten Weltkrieg allenfalls zwischen den Zeilen. Statt dessen konzentriert er sich voll auf seinen Protagonisten Oskar (Thomas Horn) und erzählt durch die Augen des Kindes, wie schwierig es ist, das Unbegreifliche rational zu fassen.

Denn genau das ist das eigentliche Thema dieses Films: Die Suche nach Erklärungen für das, was der Verstand des Menschen schlicht nicht verstehen kann. Den plötzlichen Verlust eines geliebten Angehörigen, der das Leben der Hinterbliebenen so radikal ändert, wie es wohl kein anderes Ereignis vermag. Und doch geht das Leben in all seinen Farben und Facetten weiter. 9/11 ist allenfalls der Anlass für diese Geschichte, nicht aber ihr Thema. Der Film über den kleinen Jungen, der unermüdlich auf der Suche nach Antworten auf seine Fragen ist, ist somit letztlich die schönste Liebeserklärung an das Leben und die Menschen dieses Kinowinters. Dass dabei auch gehörig auf die Tränendrüse gedrückt wird und mit unter auch etwas viel Pathos mitschwingt versteht sich von selbst. Aber mal ehrlich: Gehen wir nicht auch dafür ins Kino?
In meinen Augen ein mehr als würdiger Oscaranwärter!
Bilder: © http://wwws.warnerbros.de/extremelyloudandincrediblyclose/index.html
Gerade gesehen: J. Edgar
19. Januar 2012Wenn ein Politiker seine Memoiren schreibt, geht es ihm nicht zuletzt darum, der Nachwelt seine Deutung der Geschichte nahe zu bringen. So ist es auch im Falle J. Edgar Hoovers im neuen Film von Clint Eastwood. Achtung, dieser Beitrag enthält Spoiler!
Gegenüber seinen Mitarbeitern erweckte John Edgar Hoover (Leonardo DiCaprio) stets den Anschein, als hätte er kein Privatleben, als widmete er sich einzig seiner Aufgabe, der Leitung des FBI an dessen Aufbau er maßgeblich beteiligt war. Clint Eastwood stellt in seinem Film dennoch das Private, den Menschen Hoover in den Mittelpunkt ohne dabei wirklich konkrete Aussagen zu treffen.

Aber der Reihe nach. Den Rahmen für Eastwoods Film bildet das Verfassen von dessen Autobiographie. Ihm zu Diensten sind dabei eine Reihe von jungen Assistenten. Diese schauen sichtlich zu dem alten Mann auf, stellen jedoch immer wieder fragen, weisen auf Ungereimtheiten hin. Irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Während seines Diktats sehen wir den Aufstieg des jungen Hoovers, sehen wie er an die Spitze des FBI gelangt und dies, auch gegen den Willen von Öffentlichkeit und Politik, zu einer modernen Ermittlungsbehörde macht. Die FBI-Boss wird hier als gestrenger Mann dargestellt der weder sich selbst, noch seinen Mitarbeitern Schwächen zugesteht.
Immer wieder sehen wir jedoch auch die andere Seite dieses nach außen so souverän und unbeirrbar wirkenden Mannes. Dieser lebt noch im Erwachsenenalter bei seiner Mutter (Judi Dench), steht unter deren Fuchtel, fängt an zu stottern wenn er unsicher ist. Dieser Hoover gerät beinahe in Panik als er von einer Frau zum Tanz aufgefordert wird, wird diesen scheint sein Leben geradezu unvorstellbar, ohne die Anwesenheit seiner Mutter. Es ist eine Figut die einem wegen ihrer Unbeholfenheit fast sympathisch werden könnte, wären da nicht immer wieder diese krassen Brüche. Zurück in seiner Behörde verwandelt sich Hoover nämlich sofort wieder in den fanatischen Machtmenschen den zuvor bereits kennengelernt haben und schon fast wieder vergessen haben.
?Dass beide Facetten glaubhaft dargestellt werden, ist zweifellos dem oscarreifen Spiel DiCaprios geschuldet, der hier einmal mehr beweist dass er einer der großen Schauspieler unserer zeit ist. Neben ihm brilliert? Armie Hammer in der Rolle des Clyde Tolson, einem engen Mitarbeiter und vermeintlichen Geliebten Edgars. In Fachkreisen scheint man inzwischen sicher zu sein, dass es zwischen beiden historischen Persönlichkeiten eine Beziehung gab, die über Arbeit und Freundschaft hinaus geht. Inwiefern diese tatsächlich auch ausgelebt wurde, ist jedoch unklar. Auch Eastwood belässt es im Wesentlichen bei Andeutungen. Er zweigt wie Edgar und Clyde täglich gemeinsam essen, wie der eine die Hand des anderen ergreift, wie sie zusammen in den Urlaub fahren.
Welche Rolle dieser Clyde Tolson tatsächlich für Hoover spielte, zeigt sich nach dessen Schlaganafall und seiner anschließenden Krankheit. Nach dem Tod seiner Mutter, scheint Hoover hier die zweite wichtige Person seines Lebens zu verlieren. Er selbst geht daran sichtlich zu Grunde. gerade das sind die Szenen, in denen der Protagonist seine menschliche Seite zeigt und es ist Eastwood zu verdanken, dass er seine Figur nicht denunziert, den Film nicht zu einer bloßen Abrechnung mit dem historischen Vorbild macht.

Eastwood inszeniert seinen Film in einem recht gemächlichen Tempo, taucht ihn in sehr blasse, kalte Farben. Gerade diese zurückgefahrene Farbpalette trägt zu der dichten Atmosphäre bei, die hier in jeder Szene spürbar ist. Der Zuschauer wird von einem gewissen Unbehagen überzogen. Nein, das hier ist sicher alles andere als ein Feel-Good-Movie, J. Edgar ist ein wirklich anstrengender, vorraussetzungvoller Film. es ist ein Film auf den man sich einlassen muss, der seinen Zuschauer aber für das Durchhalten belohnt.
Diese Belohnung wird serviert in Form von wirklich großer Schauspielkunst, neben den breits genannten DiCaprio, Hammer und Dench sei insbesondere Naomi Watts genannt, die hier als persönliche Assistentin zwar eine kleine, gleichzeitig jedoch ungemein wichtige Rolle spielt. Diese Belohnung kommt jedoch auch in einem kleinen Mindfuck-Moment am Ende des Films. Clyde fordert Edgar geradezu auf, endlich ehrlich zu sich selbst zu sein. Die wirkliche Geschichte sei doch ganz anders gewesen, er beschönigt hier sein leben, schmückt sich mit fremden Federn. Eastwood untermalt diese Aufklärung, in dem er uns einige zuvor gesehene Szenen noch einmal zeigt. Nur ist Hoover diesmal bei den Verhaftungen nicht zugegen, wird von Prominenten nicht wie zuvor gezeigt, freudig empfangen, sind es andere, die im Rampenlicht stehen.
J. Edgar ist ein großer Film. Und nicht zu Unrecht einer der großen Favoriten für die diesjährige Oscarverleihung.
Bilder: (c) http://warnerbros.com/us/jedgar/
Gegenüber seinen Mitarbeitern erweckte John Edgar Hoover (Leonardo DiCaprio) stets den Anschein, als hätte er kein Privatleben, als widmete er sich einzig seiner Aufgabe, der Leitung des FBI an dessen Aufbau er maßgeblich beteiligt war. Clint Eastwood stellt in seinem Film dennoch das Private, den Menschen Hoover in den Mittelpunkt ohne dabei wirklich konkrete Aussagen zu treffen.

Aber der Reihe nach. Den Rahmen für Eastwoods Film bildet das Verfassen von dessen Autobiographie. Ihm zu Diensten sind dabei eine Reihe von jungen Assistenten. Diese schauen sichtlich zu dem alten Mann auf, stellen jedoch immer wieder fragen, weisen auf Ungereimtheiten hin. Irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Während seines Diktats sehen wir den Aufstieg des jungen Hoovers, sehen wie er an die Spitze des FBI gelangt und dies, auch gegen den Willen von Öffentlichkeit und Politik, zu einer modernen Ermittlungsbehörde macht. Die FBI-Boss wird hier als gestrenger Mann dargestellt der weder sich selbst, noch seinen Mitarbeitern Schwächen zugesteht.
Immer wieder sehen wir jedoch auch die andere Seite dieses nach außen so souverän und unbeirrbar wirkenden Mannes. Dieser lebt noch im Erwachsenenalter bei seiner Mutter (Judi Dench), steht unter deren Fuchtel, fängt an zu stottern wenn er unsicher ist. Dieser Hoover gerät beinahe in Panik als er von einer Frau zum Tanz aufgefordert wird, wird diesen scheint sein Leben geradezu unvorstellbar, ohne die Anwesenheit seiner Mutter. Es ist eine Figut die einem wegen ihrer Unbeholfenheit fast sympathisch werden könnte, wären da nicht immer wieder diese krassen Brüche. Zurück in seiner Behörde verwandelt sich Hoover nämlich sofort wieder in den fanatischen Machtmenschen den zuvor bereits kennengelernt haben und schon fast wieder vergessen haben.
?Dass beide Facetten glaubhaft dargestellt werden, ist zweifellos dem oscarreifen Spiel DiCaprios geschuldet, der hier einmal mehr beweist dass er einer der großen Schauspieler unserer zeit ist. Neben ihm brilliert? Armie Hammer in der Rolle des Clyde Tolson, einem engen Mitarbeiter und vermeintlichen Geliebten Edgars. In Fachkreisen scheint man inzwischen sicher zu sein, dass es zwischen beiden historischen Persönlichkeiten eine Beziehung gab, die über Arbeit und Freundschaft hinaus geht. Inwiefern diese tatsächlich auch ausgelebt wurde, ist jedoch unklar. Auch Eastwood belässt es im Wesentlichen bei Andeutungen. Er zweigt wie Edgar und Clyde täglich gemeinsam essen, wie der eine die Hand des anderen ergreift, wie sie zusammen in den Urlaub fahren.
Welche Rolle dieser Clyde Tolson tatsächlich für Hoover spielte, zeigt sich nach dessen Schlaganafall und seiner anschließenden Krankheit. Nach dem Tod seiner Mutter, scheint Hoover hier die zweite wichtige Person seines Lebens zu verlieren. Er selbst geht daran sichtlich zu Grunde. gerade das sind die Szenen, in denen der Protagonist seine menschliche Seite zeigt und es ist Eastwood zu verdanken, dass er seine Figur nicht denunziert, den Film nicht zu einer bloßen Abrechnung mit dem historischen Vorbild macht.

Eastwood inszeniert seinen Film in einem recht gemächlichen Tempo, taucht ihn in sehr blasse, kalte Farben. Gerade diese zurückgefahrene Farbpalette trägt zu der dichten Atmosphäre bei, die hier in jeder Szene spürbar ist. Der Zuschauer wird von einem gewissen Unbehagen überzogen. Nein, das hier ist sicher alles andere als ein Feel-Good-Movie, J. Edgar ist ein wirklich anstrengender, vorraussetzungvoller Film. es ist ein Film auf den man sich einlassen muss, der seinen Zuschauer aber für das Durchhalten belohnt.
Diese Belohnung wird serviert in Form von wirklich großer Schauspielkunst, neben den breits genannten DiCaprio, Hammer und Dench sei insbesondere Naomi Watts genannt, die hier als persönliche Assistentin zwar eine kleine, gleichzeitig jedoch ungemein wichtige Rolle spielt. Diese Belohnung kommt jedoch auch in einem kleinen Mindfuck-Moment am Ende des Films. Clyde fordert Edgar geradezu auf, endlich ehrlich zu sich selbst zu sein. Die wirkliche Geschichte sei doch ganz anders gewesen, er beschönigt hier sein leben, schmückt sich mit fremden Federn. Eastwood untermalt diese Aufklärung, in dem er uns einige zuvor gesehene Szenen noch einmal zeigt. Nur ist Hoover diesmal bei den Verhaftungen nicht zugegen, wird von Prominenten nicht wie zuvor gezeigt, freudig empfangen, sind es andere, die im Rampenlicht stehen.
J. Edgar ist ein großer Film. Und nicht zu Unrecht einer der großen Favoriten für die diesjährige Oscarverleihung.
Bilder: (c) http://warnerbros.com/us/jedgar/
Gerade gesehen: the Ides of March
11. Januar 2012Aktueller kann ein Kinofilm kaum sein. Während in den USA gerade der Wahlkampf um die Kandidatur des republikanischen Präsidentschaftskandidaten tobt, gewährt uns George Clonney in seinem aktuellen Film Einblicke in das demokratische Lager. Achtung, dieser Beitrag enthält Spoiler!
Ob er für das Rednerpult seines Chefs ein Podest bekommen könnte, fragt der junge Wahlkampfmanager Steven Meyers (Ryan Gosling). Ihm war gar nicht klar, dass Gouverneur Mike Morris (Clooney) so klein ist, antwortet ein Mitarbeiter. Darauf Meyers: Ist er auch nicht. Aber sein Konkurrent soll neben ihm aussehen wie ein Hobbit.

Schnell wird klar: Der Mann ist mit allen Wassern gewaschen. Trotz seines fast jugendlichen Alters, weiß Meyers wie man einen Wahlkampf aufzieht, wie man seinen Kandidaten ins rechte Licht stellt. Meyers Trumpf: Er glaubt an das was er tut, er glaubt an Mike Morris. Sein Boss, der erfahrene Wahlkampfmanager Paul Zara (Philip Seymour Hoffman) ist das genaue Gegenteil. Dank langjähriger Erfahrung zum Realisten, um nicht zu sagen zum Zyniker, gereift, scheut er sich nicht auch schmutzige Tricks anzuwenden. Immer wieder drängt er Morris, von seinen Prinzipien ein kleines Stück abzuweichen um einen Vorteil im rennen um die Kandidatur zu erlangen. Dieser scheint standhaft bleiben zu wollen, zu oft wäre er bereits Kompromisse eingegangen, damit müsse endlich schluss sein.
 Man muss kein Kenner der amerikanischen Politik sein, um in Mike Morris den demokratischen Präsidenten Barack Obama zu erkennen. Das vermitteln nicht nur die stilisierten Wahlkampfplakate mit dem Slogan „Believe“ oder die visionären, von Liberalität geprägten Reden, die vermitteln, dass da jemand kommt, der die Gesellschaft verändern will. Nein, das ist auch der Pathos den Morris, stets umgeben von jugebdlichen Anhängern, vor sich her trägt. Clooney spielt den charismatischen Politiker absolut überzeugend, dabei aber zugleich angenehm zurückgenommen. Der eigentliche Star des Films ist nämlich Ryan Gosling, dessen Figur wir durch die Handlung folgen und dessen Wandel vom glühenden Verehrer zum abgestumpften Realisten wir erleben.
Man muss kein Kenner der amerikanischen Politik sein, um in Mike Morris den demokratischen Präsidenten Barack Obama zu erkennen. Das vermitteln nicht nur die stilisierten Wahlkampfplakate mit dem Slogan „Believe“ oder die visionären, von Liberalität geprägten Reden, die vermitteln, dass da jemand kommt, der die Gesellschaft verändern will. Nein, das ist auch der Pathos den Morris, stets umgeben von jugebdlichen Anhängern, vor sich her trägt. Clooney spielt den charismatischen Politiker absolut überzeugend, dabei aber zugleich angenehm zurückgenommen. Der eigentliche Star des Films ist nämlich Ryan Gosling, dessen Figur wir durch die Handlung folgen und dessen Wandel vom glühenden Verehrer zum abgestumpften Realisten wir erleben.
Denn Myers lernt auch die schmutzige Seite des Geschäfts kennen. Und er muss erfahren, wie schnell auch ein Shootingstar abstürzen kann, wenn er die Regeln verletzt. „the Ides of March“ zeigt die Hintergründe des Politikgeschäfts und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Clooney selbst gilt als Anhänger der demokratischen Partei, ist zugleich tief enttäuscht von 'seinem' Präsidenten Barack Obama. Und das merkt man dem Film an. Systematisch demontiert er eine Lichtgestalt Morris und zeigt wie das System den Sympathieträger Meyers korrumpiert.
Beeindruckend: Clooney (verantwortlich für Regie, Drehbuch und Produktion) gelingt es, einen Politikfilm zu drehen, der vollkommen ohne eine Stellungnahme zu aktuellen Fragen auskommt, sein Thema jedoch nicht oberflächlich behandelt. Denn die zynische Wahrheit, die der Film darstellt ist, dass sich die Kandidaten und ihre Teams in erster Linie mit sich selbst befassen. Einen Seitenhieb musste man dann aber doch noch einbauen. Haudegen Zara: „Eines kannst Du mir glauben Junge: Die Republikaner sind noch härter und unfairer als unsere Leute.“ Na dann...
Bilder: (c) http://www.sonypictures.com/homevideo/theidesofmarch/
Ob er für das Rednerpult seines Chefs ein Podest bekommen könnte, fragt der junge Wahlkampfmanager Steven Meyers (Ryan Gosling). Ihm war gar nicht klar, dass Gouverneur Mike Morris (Clooney) so klein ist, antwortet ein Mitarbeiter. Darauf Meyers: Ist er auch nicht. Aber sein Konkurrent soll neben ihm aussehen wie ein Hobbit.

Schnell wird klar: Der Mann ist mit allen Wassern gewaschen. Trotz seines fast jugendlichen Alters, weiß Meyers wie man einen Wahlkampf aufzieht, wie man seinen Kandidaten ins rechte Licht stellt. Meyers Trumpf: Er glaubt an das was er tut, er glaubt an Mike Morris. Sein Boss, der erfahrene Wahlkampfmanager Paul Zara (Philip Seymour Hoffman) ist das genaue Gegenteil. Dank langjähriger Erfahrung zum Realisten, um nicht zu sagen zum Zyniker, gereift, scheut er sich nicht auch schmutzige Tricks anzuwenden. Immer wieder drängt er Morris, von seinen Prinzipien ein kleines Stück abzuweichen um einen Vorteil im rennen um die Kandidatur zu erlangen. Dieser scheint standhaft bleiben zu wollen, zu oft wäre er bereits Kompromisse eingegangen, damit müsse endlich schluss sein.
 Man muss kein Kenner der amerikanischen Politik sein, um in Mike Morris den demokratischen Präsidenten Barack Obama zu erkennen. Das vermitteln nicht nur die stilisierten Wahlkampfplakate mit dem Slogan „Believe“ oder die visionären, von Liberalität geprägten Reden, die vermitteln, dass da jemand kommt, der die Gesellschaft verändern will. Nein, das ist auch der Pathos den Morris, stets umgeben von jugebdlichen Anhängern, vor sich her trägt. Clooney spielt den charismatischen Politiker absolut überzeugend, dabei aber zugleich angenehm zurückgenommen. Der eigentliche Star des Films ist nämlich Ryan Gosling, dessen Figur wir durch die Handlung folgen und dessen Wandel vom glühenden Verehrer zum abgestumpften Realisten wir erleben.
Man muss kein Kenner der amerikanischen Politik sein, um in Mike Morris den demokratischen Präsidenten Barack Obama zu erkennen. Das vermitteln nicht nur die stilisierten Wahlkampfplakate mit dem Slogan „Believe“ oder die visionären, von Liberalität geprägten Reden, die vermitteln, dass da jemand kommt, der die Gesellschaft verändern will. Nein, das ist auch der Pathos den Morris, stets umgeben von jugebdlichen Anhängern, vor sich her trägt. Clooney spielt den charismatischen Politiker absolut überzeugend, dabei aber zugleich angenehm zurückgenommen. Der eigentliche Star des Films ist nämlich Ryan Gosling, dessen Figur wir durch die Handlung folgen und dessen Wandel vom glühenden Verehrer zum abgestumpften Realisten wir erleben. Denn Myers lernt auch die schmutzige Seite des Geschäfts kennen. Und er muss erfahren, wie schnell auch ein Shootingstar abstürzen kann, wenn er die Regeln verletzt. „the Ides of March“ zeigt die Hintergründe des Politikgeschäfts und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Clooney selbst gilt als Anhänger der demokratischen Partei, ist zugleich tief enttäuscht von 'seinem' Präsidenten Barack Obama. Und das merkt man dem Film an. Systematisch demontiert er eine Lichtgestalt Morris und zeigt wie das System den Sympathieträger Meyers korrumpiert.
Beeindruckend: Clooney (verantwortlich für Regie, Drehbuch und Produktion) gelingt es, einen Politikfilm zu drehen, der vollkommen ohne eine Stellungnahme zu aktuellen Fragen auskommt, sein Thema jedoch nicht oberflächlich behandelt. Denn die zynische Wahrheit, die der Film darstellt ist, dass sich die Kandidaten und ihre Teams in erster Linie mit sich selbst befassen. Einen Seitenhieb musste man dann aber doch noch einbauen. Haudegen Zara: „Eines kannst Du mir glauben Junge: Die Republikaner sind noch härter und unfairer als unsere Leute.“ Na dann...
Bilder: (c) http://www.sonypictures.com/homevideo/theidesofmarch/
Gerade gesehen: der Gott des Gemetzels
4. Dezember 2011Wenn die Tage kürzer werden, kommen alljährlich auch 'besonderen' Filme ins Kino. So auch in diesem Jahr. Mit Roman Polanskis neuestem Meisterwerk „der Gott des Gemetzels“ läuft gerade solch ein 'besonderer' Film, einer der sich gänzlich auf seine nicht minder 'besonderen' Schauspieler stützt.
Dass hier vieles Bloß Fassade ist, sieht man auf den ersten Blick. An der Wand Kitsch, schwarzafrikanischen Stils, auf dem Coutisch dekorative Kunstbände. Ja hier ist das Bildungsbürgertum zu hause. 'Hier', das ist eine Wohnung irgendwo in New York, gleichzeitig der Schauplatz für die Auseinandersetzung zweier Paare, die sich eigentlich trafen, um unter Erwachsenen einen Streit ihrer Söhne zu klären.
Der Sohn der gelangweilten Brokerin Nancy (Kate Winslet) und des Unternehmensanwalts Alan (Christoph Waltz) hat dem Sohn der selbsternannten Schriftstellerin Penelope (Jodie Foster) und des Haushaltswarenverkäuverfs Michael (John C. Reilly) einen Zahn ausgeschlagen. Eine vermeintlich alltägliche Szene unter sich raufenden Jungen, die von Penelope jedoch zu einer Grundsatzfrage über das richtige Zusammenleben in einer Gesellschaft aufgeblasen wird. Penelope ist die Karikatur des nervigen Gutmenschen, die hier jedoch so überzeugend von Jodie Foster dargestellt wird, dass es einfach nur Spaß macht, ihr zuzusehen. Waltz' Figur Alan wirkt ihr gegenüber wie ihre personifizierte Antithese: Er glaube nicht an die Menschenrechte, erklärt er ihr, sondern an den Gott des Gemetzels. Eine Aussage, angesichts derer Penelope beinahe in die Luft geht, angesichts derer sich der unsympathische Alan jedoch auch als der ehrlichste Charakter der Geschichte entpuppt.

Denn aus der zunächst zivilisierten Diskussion unter Erwachsnenen wird im Laufe von 80 Minuten eine Schlacht, bei der die Fronten oft wechseln, im Prinzip jede Figur allein steht. Aus den gut situierten Herrschaften werden betrunkene Kombattanten, deren Argumente mehr als einmal unter die Gürtellinie zielen. Hat man sich zunächst noch höflich unterhalten, Kuchen und Einrichtung des Gegenübers gelobt, spricht aus allen Figuren am Ende der blanke Hass.
Polanski inszeniert diese Eskalation auf engstem Raum, ohne großartige Stilmittel. Der Film stützt sich vollkommen auf die Leistung seines grandiosen Ensembles, in dem insbesondere Waltz und Foster oscarreif agieren. Die Geschichte spielt einzig in der engen Wohnung, die hier zunehmend den Charakter eines Gefängnisses bekommt. Man hasst sich, verlässt die Wohnung jedoch nicht. Die gesellschaftlichen Konventionen erfordern es, dass die Gäste immer wieder an der Türschwelle hinein gebeten werden um, der Zuschauer ahnt es schnell, eine nächste Stufe der Eskalation einzuleiten. Polanskis Filme, etwa „Ekel“ oder „Rosmarys Baby“, ziehen ihren Reiz oft aus einer bedrückenden Enge. Hier merkt man dem Film seinen Ursprung als Theaterstück durchaus an, dennoch nutzt Polanski die Mittel des Films, um seine Darsteller, jeden für sich, in den Mittelpunkt zustellen. Dass er dabei aber nie die Enge der Szenenhaftigkeit verliert, ist ein Zeichen für die Klasse dieses Ausnahmeregisseurs.
Der Gott des Gemetzels ist ein grandioses Kinospektakel. Unbedingt reingehen!
Bild (c) http://www.sonyclassics.com/carnage/
Dass hier vieles Bloß Fassade ist, sieht man auf den ersten Blick. An der Wand Kitsch, schwarzafrikanischen Stils, auf dem Coutisch dekorative Kunstbände. Ja hier ist das Bildungsbürgertum zu hause. 'Hier', das ist eine Wohnung irgendwo in New York, gleichzeitig der Schauplatz für die Auseinandersetzung zweier Paare, die sich eigentlich trafen, um unter Erwachsenen einen Streit ihrer Söhne zu klären.
Der Sohn der gelangweilten Brokerin Nancy (Kate Winslet) und des Unternehmensanwalts Alan (Christoph Waltz) hat dem Sohn der selbsternannten Schriftstellerin Penelope (Jodie Foster) und des Haushaltswarenverkäuverfs Michael (John C. Reilly) einen Zahn ausgeschlagen. Eine vermeintlich alltägliche Szene unter sich raufenden Jungen, die von Penelope jedoch zu einer Grundsatzfrage über das richtige Zusammenleben in einer Gesellschaft aufgeblasen wird. Penelope ist die Karikatur des nervigen Gutmenschen, die hier jedoch so überzeugend von Jodie Foster dargestellt wird, dass es einfach nur Spaß macht, ihr zuzusehen. Waltz' Figur Alan wirkt ihr gegenüber wie ihre personifizierte Antithese: Er glaube nicht an die Menschenrechte, erklärt er ihr, sondern an den Gott des Gemetzels. Eine Aussage, angesichts derer Penelope beinahe in die Luft geht, angesichts derer sich der unsympathische Alan jedoch auch als der ehrlichste Charakter der Geschichte entpuppt.

Denn aus der zunächst zivilisierten Diskussion unter Erwachsnenen wird im Laufe von 80 Minuten eine Schlacht, bei der die Fronten oft wechseln, im Prinzip jede Figur allein steht. Aus den gut situierten Herrschaften werden betrunkene Kombattanten, deren Argumente mehr als einmal unter die Gürtellinie zielen. Hat man sich zunächst noch höflich unterhalten, Kuchen und Einrichtung des Gegenübers gelobt, spricht aus allen Figuren am Ende der blanke Hass.
Polanski inszeniert diese Eskalation auf engstem Raum, ohne großartige Stilmittel. Der Film stützt sich vollkommen auf die Leistung seines grandiosen Ensembles, in dem insbesondere Waltz und Foster oscarreif agieren. Die Geschichte spielt einzig in der engen Wohnung, die hier zunehmend den Charakter eines Gefängnisses bekommt. Man hasst sich, verlässt die Wohnung jedoch nicht. Die gesellschaftlichen Konventionen erfordern es, dass die Gäste immer wieder an der Türschwelle hinein gebeten werden um, der Zuschauer ahnt es schnell, eine nächste Stufe der Eskalation einzuleiten. Polanskis Filme, etwa „Ekel“ oder „Rosmarys Baby“, ziehen ihren Reiz oft aus einer bedrückenden Enge. Hier merkt man dem Film seinen Ursprung als Theaterstück durchaus an, dennoch nutzt Polanski die Mittel des Films, um seine Darsteller, jeden für sich, in den Mittelpunkt zustellen. Dass er dabei aber nie die Enge der Szenenhaftigkeit verliert, ist ein Zeichen für die Klasse dieses Ausnahmeregisseurs.
Der Gott des Gemetzels ist ein grandioses Kinospektakel. Unbedingt reingehen!
Bild (c) http://www.sonyclassics.com/carnage/
Gerade gesehen: Contagion
26. Oktober 2011Eine schwarze Leinwand, dann ein Husten. So beginnt Steven Soderberghs starbespicktes Katastrophenepos Contagion. Was folgt ist ein ausgesprochen ungewöhnlicher Blockbuster und ein etwas flaues Gefühl im Magen. Achtung, dieser Beitrag enthält Spoiler!
Als die Virulogin im Film erklärt, der Mensch würde sich täglich mehr als 4000 mal im Gesicht berühren und Keime von Bankautomaten, Waschbecken und Türklinken darauf verteilen, ertappt man sich im Kino schnell dabei, wie man aufhört, sich über den Bart zu streichen oder die Nase zu kratzen. Da steht er plötzlich im Raum, der vielfach gelobte Realismus in Soderberghs neuem Film. Aber das ist gar nicht seine eigentliche Stärke, wie ich finde.

Steven Soderbergh nähert sich seinem Gegenstand, der sich rasend schnell über den gesamten Globus ausbreitenden Seuche, von zwei Seiten. Zum einen ist da die technische, fast sterile Ebene. Immer wieder werden die Namen von Metropolen und Ballungsräumen in denen die Seuche ausgebrochen ist, sowie deren Bevölkerungszahlen eingeblendet. Immer wieder schwenkt die Kamera auf Bildschirme, auf denen die Landstriche markiert sind, in denen die Krankheit grassiert. Und immer wieder sehen wir Expertenzirkel, in denen Szenarien und Handlungsoptionen diskutiert werden, und in denen Wissenschaftler in nüchterner Sprache Hintergründe erläutern. Das Beruhigende daran: Diese Leute wissen oftmals genauso wenig, wie der kleine Mann auf der Straße, hier brillant dargestellt durch Matt Damon.
Und das ist die andere, die Mikroebene des Films. Wie geht ein Mann mit der Katastrophe um, der gerade seine Frau (Gwyneth Paltrow) und seinen Stiefsohn verloren hat? Soderbergh inszeniert gerade seine Geschichte mit sehr viel Empathie, verliert sich jedoch nicht darin und wechselt immer wieder die Szenerie. Wir sehen einen etwas aufgeregt wirkenden Blogger (Jude Law), der sich als großer Aufklärer darstellt, der sich als einziger nicht von den Aussagen der Politik und der Pharmaindustrie blenden lässt, sich dabei aber immer mehr von dem Hersteller eines homöopathischen Medikaments korrumpieren lässt. Wir sehen die Ermittlerin (Marion Cotillard) der Seuchenbehörde, die in China dem Ursprung des Erregers auf den Grund geht. Und wir schauen unzähligen Ärzten und Wissenschaftlern über die Schulter, wie sie an einem wirkstoff gegen die Krankheit arbeiten.
Wenn in Contagion Menschen ihr Leben verlieren, tun sie das ganz ohne Pathos und die für Hollywood typische Ästhetik. Und auch das ist eine Leistung dieses Films. Soderbergh bricht in diesen Momenten mit den Gesetzen des Hollywoodfilms und verleiht seinen Figuren damit eine Würde, wie man sie gern öfter in Katastrophenfilmen sehen würde.
Trotz des Aufgebots an Stars (neben den bisher genannten u.a. auch Kate Winslet, Laurence Fishburne, Armin Rohde) kennt Contagion keinen wirklichen Protagonisten, zu verzweigt, zu komplex ist die Handlung. Dennoch verliert der Film seine Stringenz in keiner Minute aus den Augen. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt jedoch: Wegen der großen Vielfalt an handelnden Personen und involvierten Schauplätzen, bleibt für eine tiefgreifende Charakterentwicklung kaum Zeit. Um nicht falsch verstanden zu werden: Nein, Contagion ist keineswegs oberflächlich, doch wüsste man in mancher Szene gern genauer, mit wem man es eigentlich zu tun hat.

Contagion ist ein unaufgeregter Thriller, der seine Geschichte auf eine unkoventionelle Art erzählt. Ob es tatsächlich der Film des Jahrzehnts ist, wie angesichts des Casts kolportiert wurde, wage ich zu bezweifeln. Auf jeden Fall ist es ein Film, der sich erst einmal setzen muss, und so lasse ich mich jetzt, zwei Stunden nach Filmende, nicht zu einer abschließenden Beurteilung hinreißen. Anschauen lohnt sich aber auf jeden Fall!
Bilder: (c) http://contagionmovie.warnerbros.com
Als die Virulogin im Film erklärt, der Mensch würde sich täglich mehr als 4000 mal im Gesicht berühren und Keime von Bankautomaten, Waschbecken und Türklinken darauf verteilen, ertappt man sich im Kino schnell dabei, wie man aufhört, sich über den Bart zu streichen oder die Nase zu kratzen. Da steht er plötzlich im Raum, der vielfach gelobte Realismus in Soderberghs neuem Film. Aber das ist gar nicht seine eigentliche Stärke, wie ich finde.

Steven Soderbergh nähert sich seinem Gegenstand, der sich rasend schnell über den gesamten Globus ausbreitenden Seuche, von zwei Seiten. Zum einen ist da die technische, fast sterile Ebene. Immer wieder werden die Namen von Metropolen und Ballungsräumen in denen die Seuche ausgebrochen ist, sowie deren Bevölkerungszahlen eingeblendet. Immer wieder schwenkt die Kamera auf Bildschirme, auf denen die Landstriche markiert sind, in denen die Krankheit grassiert. Und immer wieder sehen wir Expertenzirkel, in denen Szenarien und Handlungsoptionen diskutiert werden, und in denen Wissenschaftler in nüchterner Sprache Hintergründe erläutern. Das Beruhigende daran: Diese Leute wissen oftmals genauso wenig, wie der kleine Mann auf der Straße, hier brillant dargestellt durch Matt Damon.
Und das ist die andere, die Mikroebene des Films. Wie geht ein Mann mit der Katastrophe um, der gerade seine Frau (Gwyneth Paltrow) und seinen Stiefsohn verloren hat? Soderbergh inszeniert gerade seine Geschichte mit sehr viel Empathie, verliert sich jedoch nicht darin und wechselt immer wieder die Szenerie. Wir sehen einen etwas aufgeregt wirkenden Blogger (Jude Law), der sich als großer Aufklärer darstellt, der sich als einziger nicht von den Aussagen der Politik und der Pharmaindustrie blenden lässt, sich dabei aber immer mehr von dem Hersteller eines homöopathischen Medikaments korrumpieren lässt. Wir sehen die Ermittlerin (Marion Cotillard) der Seuchenbehörde, die in China dem Ursprung des Erregers auf den Grund geht. Und wir schauen unzähligen Ärzten und Wissenschaftlern über die Schulter, wie sie an einem wirkstoff gegen die Krankheit arbeiten.
Wenn in Contagion Menschen ihr Leben verlieren, tun sie das ganz ohne Pathos und die für Hollywood typische Ästhetik. Und auch das ist eine Leistung dieses Films. Soderbergh bricht in diesen Momenten mit den Gesetzen des Hollywoodfilms und verleiht seinen Figuren damit eine Würde, wie man sie gern öfter in Katastrophenfilmen sehen würde.
Trotz des Aufgebots an Stars (neben den bisher genannten u.a. auch Kate Winslet, Laurence Fishburne, Armin Rohde) kennt Contagion keinen wirklichen Protagonisten, zu verzweigt, zu komplex ist die Handlung. Dennoch verliert der Film seine Stringenz in keiner Minute aus den Augen. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt jedoch: Wegen der großen Vielfalt an handelnden Personen und involvierten Schauplätzen, bleibt für eine tiefgreifende Charakterentwicklung kaum Zeit. Um nicht falsch verstanden zu werden: Nein, Contagion ist keineswegs oberflächlich, doch wüsste man in mancher Szene gern genauer, mit wem man es eigentlich zu tun hat.

Contagion ist ein unaufgeregter Thriller, der seine Geschichte auf eine unkoventionelle Art erzählt. Ob es tatsächlich der Film des Jahrzehnts ist, wie angesichts des Casts kolportiert wurde, wage ich zu bezweifeln. Auf jeden Fall ist es ein Film, der sich erst einmal setzen muss, und so lasse ich mich jetzt, zwei Stunden nach Filmende, nicht zu einer abschließenden Beurteilung hinreißen. Anschauen lohnt sich aber auf jeden Fall!
Bilder: (c) http://contagionmovie.warnerbros.com
Gerade gesehen: Melancholia
11. Oktober 2011Dass die Welt dem Untergang geweiht ist, das macht Lars von Trier in seinem neuen Film Melancholia direkt in der ersten Einstellung unmissverständlich klar. In von Triers Welt ist dies jedoch noch lange kein Grund, auf ein rauschendes fest zu verzichten. Achtung, dieser Beitrag enthält Spoiler!
Zunächst Bombast. Musik von Wagner, dazu schier überwältigende Bilder eines kosmischen Zusammenpralls zweier Planeten, immer wieder unterbrochen von Zeitlupenaufnahmen eines zusammenbrechenden Pferdes, einer durch Spinnweben watenden Braut, einer Sonnenuhr, die zwei Schatten wirft. Der Untergang ist nah, so viel steht fest. Schnitt. Es bedarf schon besonderer Chuzpe darauf eine Slapstickszene folgen zu lassen, in der sich eine Stretchlimo eine enge Serpentine hinauf quält, immer wieder stoppt, zurück setzt, einlenkt, weiterfährt, stoppt, ...

Protagonistin des ersten Teils von Melancholia ist die unter Depressionen leidende Braut Justine (Kirsten Dunst). Von ihrer Krankheit merkt man zu diesem Zeitpunkt noch nichts, sie wirkt ausgelassen, als sie mit ihrem Mann Michael (Alexander Skarsgard) auf dem Rücksitz der viel zu langen Limousine turtelt. Auf dem Empfang ihrer Hochzeit angekommen, verdüstert sich ihre Stimmung jedoch zusehends. Es ist ihre Schwester Claire (Charlotte Gainsbourg) die sie aufzubauen versucht, die die Party in Gang hält, die die Spannungen in der Familie schlichtet. Nach Justines Zusammenbruch am nächsten Morgen ist sie es, die sie pflegt, sie in ihre kleine Familie aufnimmt. Vom Weltuntergang ist noch nicht viel zu spüren. Die Hochzeitsgäste feiern ausgelassen, auf die drohende Katastrophe deutet lediglich ein roter Punkt am Nachthimmel hin. Und Justines eigenartiges Verhalten. Die bislang erfolgreiche Werberin schafft es in dieser Nacht, ihren Job zu verlieren, ihre Familie gegen sich aufzubringen, ihren frisch gebackenen Ehemann zu vergraulen und als Wrack zurück zubleiben.
Und so ist es auch Claire, die zur Protagonistin des zweiten Teils wird und die Katastrophe in die Handlung zieht. Ob er sich sicher sei, dass der Planet die Erde verfehlt, fragt sie ihren Mann John (Kiefer Sutherland). Natürlich, die Wissenschaftler hätten das doch eindeutig berechnet, beruhigt dieser. Im Internet liest sie jedoch von gegenteiligen Theorien: nachdem der gewaltige Planet Melancholia die erde einmal knapp verfehlt, werden beide durch ihre Anziehungskraft im zweiten Anlauf doch auf einander prallen. Hat Claire gerade noch ihre kranke Schwester gepflegt, so kann man nun förmlich dabei zusehen, wie sie angesichts der Angst vor dem Tod altert und schwächer wird. Es sind die Tiere, die rumorenden Pferde im Stall, sowie die unruhigen Vögel am Himmel, die andeuten, dass es zu Ende geht. Und es ist Justine deren Fatalismus im Angesicht des Untergangs sie immer mehr vom Leben entfremdet, dabei aber immer stärker und souveräner macht. Sie ist es auch, die ihrem Neffen kurz vor dem Ende eine Zauberhöhle baut um darin ihn und ihre Schwester an die Hand zu nehmen, zu beruhigen und dem Tod entgegen zu gehen. Sie, die durch die Depression vermutlich ihr Leben lang den Tod vor Augen hatte, scheint hier plötzlich die Einzige zu sein, die einen kühlen Kopf behält.

Es ist gerade dieser zweite Teil, der Melancholia zum Erlebnis macht. Während der Film im ersten Teil durchaus mit einigen Längen zu kämpfen hat, entwickelt er sich hier zum Kammerspiel das seinen Fokus auf die gegensätzliche Entwicklung der Schwestern richtet. Beide Darstellerinnen spielen hier brillant auf, den Preis für die beste Schauspielerin in Cannes hätte Gainsbourg sicher genauso zugestanden wie Dunst. Von Trier entwickelt die Katastrophe in einer bedrückenden Stille, die lediglich von einem latent ansteigenden grollen gestört wird. Natürlich ist sich der Zuschauer von Anfang an der Unausweichlichkeit der Katastrophe bewusst. Doch ist es erst Wagners Musik, die sich in das immer lauter werdende Grollen mischt und endgültige Gewissheit schafft. Nie hat das Kino den Weltuntergang gleichzeitig so grausam direkt und subtil verspielt dargestellt. Am Ende ist dann absolute Stille.
Bilder. (c) http://www.melancholia-derfilm.de
Zunächst Bombast. Musik von Wagner, dazu schier überwältigende Bilder eines kosmischen Zusammenpralls zweier Planeten, immer wieder unterbrochen von Zeitlupenaufnahmen eines zusammenbrechenden Pferdes, einer durch Spinnweben watenden Braut, einer Sonnenuhr, die zwei Schatten wirft. Der Untergang ist nah, so viel steht fest. Schnitt. Es bedarf schon besonderer Chuzpe darauf eine Slapstickszene folgen zu lassen, in der sich eine Stretchlimo eine enge Serpentine hinauf quält, immer wieder stoppt, zurück setzt, einlenkt, weiterfährt, stoppt, ...

Protagonistin des ersten Teils von Melancholia ist die unter Depressionen leidende Braut Justine (Kirsten Dunst). Von ihrer Krankheit merkt man zu diesem Zeitpunkt noch nichts, sie wirkt ausgelassen, als sie mit ihrem Mann Michael (Alexander Skarsgard) auf dem Rücksitz der viel zu langen Limousine turtelt. Auf dem Empfang ihrer Hochzeit angekommen, verdüstert sich ihre Stimmung jedoch zusehends. Es ist ihre Schwester Claire (Charlotte Gainsbourg) die sie aufzubauen versucht, die die Party in Gang hält, die die Spannungen in der Familie schlichtet. Nach Justines Zusammenbruch am nächsten Morgen ist sie es, die sie pflegt, sie in ihre kleine Familie aufnimmt. Vom Weltuntergang ist noch nicht viel zu spüren. Die Hochzeitsgäste feiern ausgelassen, auf die drohende Katastrophe deutet lediglich ein roter Punkt am Nachthimmel hin. Und Justines eigenartiges Verhalten. Die bislang erfolgreiche Werberin schafft es in dieser Nacht, ihren Job zu verlieren, ihre Familie gegen sich aufzubringen, ihren frisch gebackenen Ehemann zu vergraulen und als Wrack zurück zubleiben.
Und so ist es auch Claire, die zur Protagonistin des zweiten Teils wird und die Katastrophe in die Handlung zieht. Ob er sich sicher sei, dass der Planet die Erde verfehlt, fragt sie ihren Mann John (Kiefer Sutherland). Natürlich, die Wissenschaftler hätten das doch eindeutig berechnet, beruhigt dieser. Im Internet liest sie jedoch von gegenteiligen Theorien: nachdem der gewaltige Planet Melancholia die erde einmal knapp verfehlt, werden beide durch ihre Anziehungskraft im zweiten Anlauf doch auf einander prallen. Hat Claire gerade noch ihre kranke Schwester gepflegt, so kann man nun förmlich dabei zusehen, wie sie angesichts der Angst vor dem Tod altert und schwächer wird. Es sind die Tiere, die rumorenden Pferde im Stall, sowie die unruhigen Vögel am Himmel, die andeuten, dass es zu Ende geht. Und es ist Justine deren Fatalismus im Angesicht des Untergangs sie immer mehr vom Leben entfremdet, dabei aber immer stärker und souveräner macht. Sie ist es auch, die ihrem Neffen kurz vor dem Ende eine Zauberhöhle baut um darin ihn und ihre Schwester an die Hand zu nehmen, zu beruhigen und dem Tod entgegen zu gehen. Sie, die durch die Depression vermutlich ihr Leben lang den Tod vor Augen hatte, scheint hier plötzlich die Einzige zu sein, die einen kühlen Kopf behält.

Es ist gerade dieser zweite Teil, der Melancholia zum Erlebnis macht. Während der Film im ersten Teil durchaus mit einigen Längen zu kämpfen hat, entwickelt er sich hier zum Kammerspiel das seinen Fokus auf die gegensätzliche Entwicklung der Schwestern richtet. Beide Darstellerinnen spielen hier brillant auf, den Preis für die beste Schauspielerin in Cannes hätte Gainsbourg sicher genauso zugestanden wie Dunst. Von Trier entwickelt die Katastrophe in einer bedrückenden Stille, die lediglich von einem latent ansteigenden grollen gestört wird. Natürlich ist sich der Zuschauer von Anfang an der Unausweichlichkeit der Katastrophe bewusst. Doch ist es erst Wagners Musik, die sich in das immer lauter werdende Grollen mischt und endgültige Gewissheit schafft. Nie hat das Kino den Weltuntergang gleichzeitig so grausam direkt und subtil verspielt dargestellt. Am Ende ist dann absolute Stille.
Bilder. (c) http://www.melancholia-derfilm.de
Top Angebote
meine wenigkeit
GEPRÜFTES MITGLIED
FSK 18
Aktivität
Forenbeiträge846
Kommentare294
Blogbeiträge40
Clubposts9
Bewertungen72
Mein Avatar
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(6)
(2)
(6)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
Kommentare
DC-Relaunch. Ein Jahr danach
von Michael Speier
am Ein großartiger Blog. …
Der Blog von meine wenigkeit wurde 14.866x besucht.