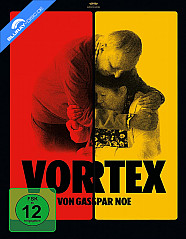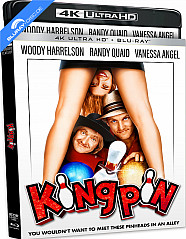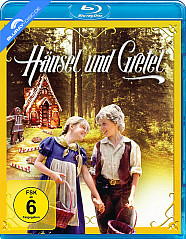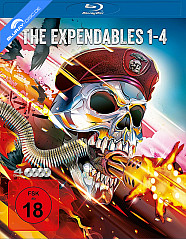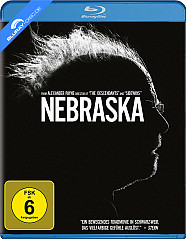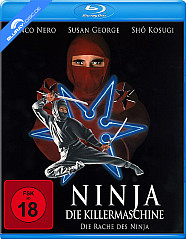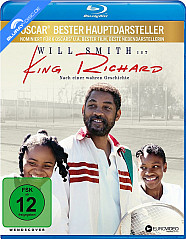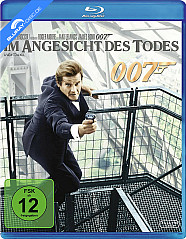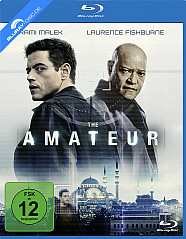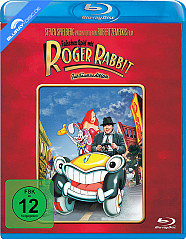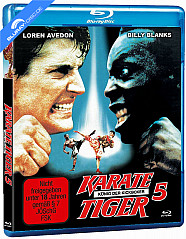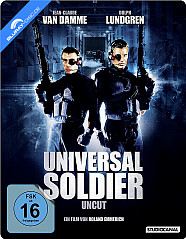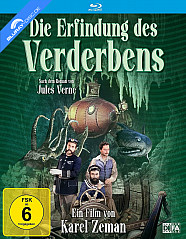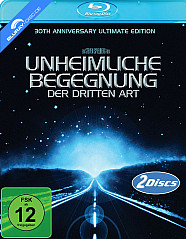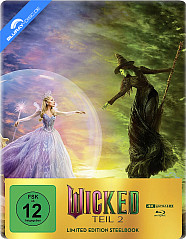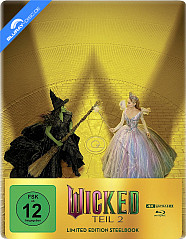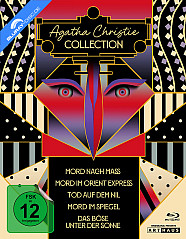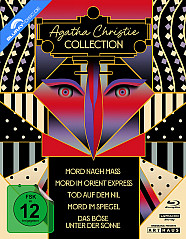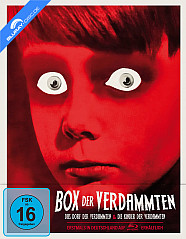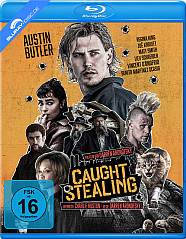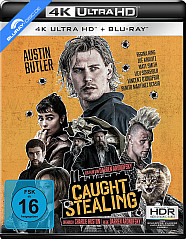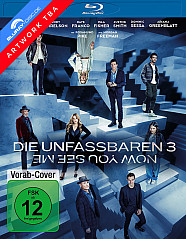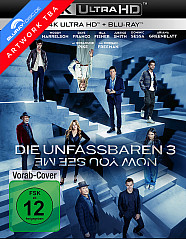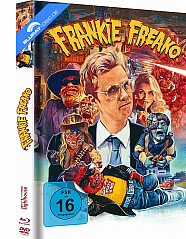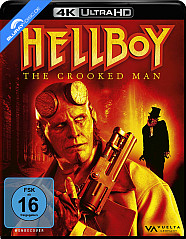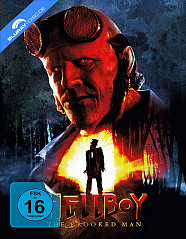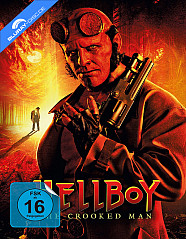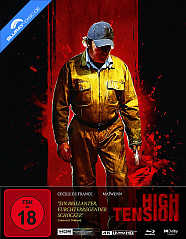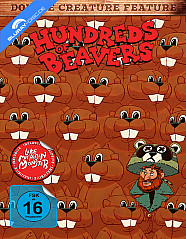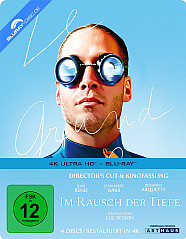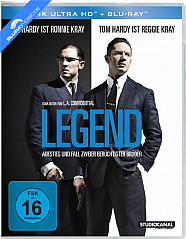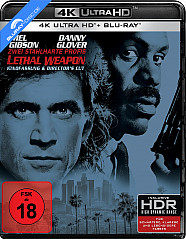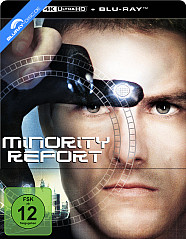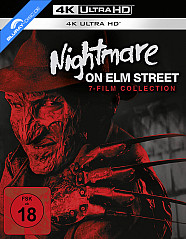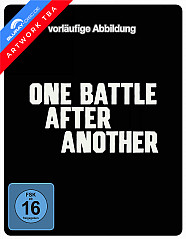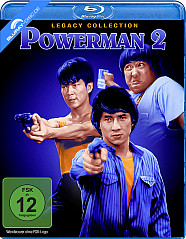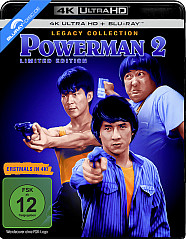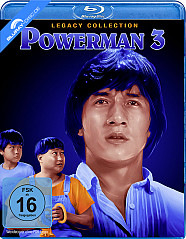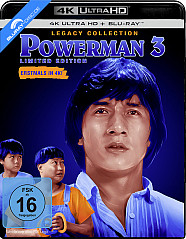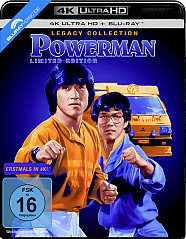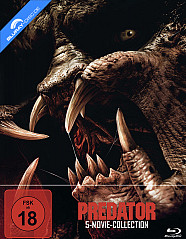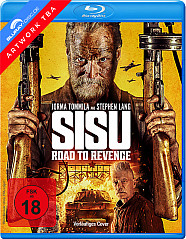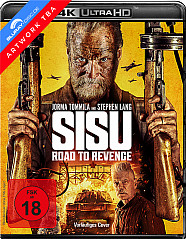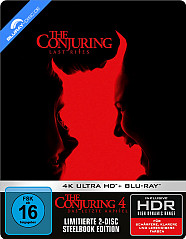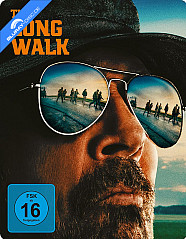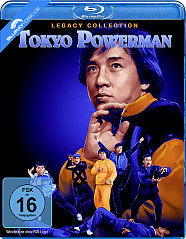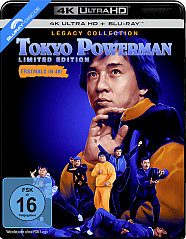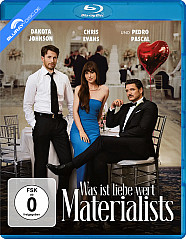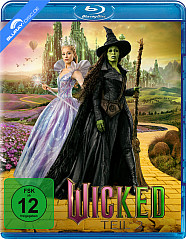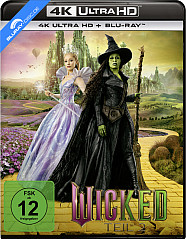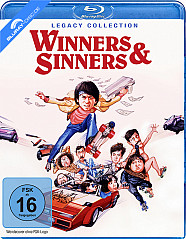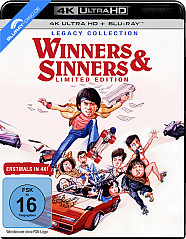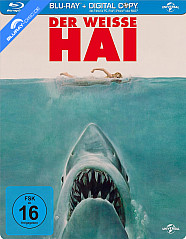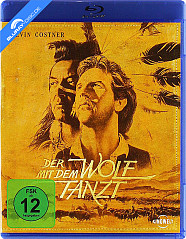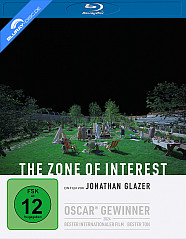Die Saat des heiligen Feigenbaums – Ein intensives Meisterwerk über Angst, Aufbruch und die Zerreißprobe einer Familie:
Schon in den ersten Minuten spürt man die Wucht dieses Films: Die Saat des heiligen Feigenbaums schaut nicht nur auf eine iranische Familie – er schaut in sie hinein. In der Enge einer Wohnung, im Schweigen der Flure und im Schatten eines Berufs, über den man nicht spricht, entfaltet sich ein Drama von bedrückender Unmittelbarkeit. Der Vater ist Henker; er lebt mit seiner Frau und den Töchtern ein Leben, das nach außen hin geordnet wirkt, in Wahrheit aber von Geheimnissen, Schuld und ständiger Furcht durchzogen ist. Draußen gehen junge Menschen – insbesondere Frauen – auf die Straßen; drinnen versucht eine Familie, zwischen Loyalität und Gewissen nicht zu zerbrechen.
Der Funke, der alles entzündet, ist scheinbar klein: Als der Vater seine Amtspistole verliert und ihm eine Gefängnisstrafe droht, kippt die fragile Balance. Was vorher unter Teppichen und hinter Türen verborgen blieb, kommt mit brutaler Klarheit zum Vorschein. Die Wohnung wird zur Druckkammer, die Luft zum Brennstoff, jedes Wort potenziell explosiv. Das private Dilemma verbindet sich mit der politischen Wirklichkeit: Mit Demonstrierenden wird hart, oft unmenschlich umgegangen; die Grenzen des Sagbaren sind eng, Meinungsfreiheit ist – freundlich formuliert – nicht selbstverständlich. Der Film macht daraus kein Thesenstück, sondern ein hochkonzentriertes Kammerspiel, in dem sich gesellschaftliche Gewalt im Intimen spiegelt.
Harte Zeiten für die junge Generation:
In einer der prägnantesten gedanklichen Linien des Films heißt es sinngemäß: Die Welt hat sich verändert, die jungen Menschen haben sich verändert – aber Gott nicht. Übertragen auf unsere Wirklichkeit ließe sich sagen: Die jungen Menschen haben sich verändert, aber der Kapitalismus nicht. In beiden Varianten steckt dieselbe bittere Erkenntnis: Mächtige Systeme verteidigen sich mit Zähnen und Klauen, halten an Ideologien fest und bekämpfen jede Kritik – koste es, was es wolle. Der Film verhandelt diese Spannung nicht abstrakt, sondern als tägliches Ringen um Würde, Wahrheit und Verantwortung.
Die perfekte Besetzung:
Schauspielerisch ist das durchweg grandios. Die Darstellerinnen und Darsteller spielen nicht „Figuren“, sie bewohnen sie. Der Vater, gefangen zwischen Pflicht, Angst und einer langsam erodierenden Selbstrechtfertigung. Die Mutter, die das Gefüge zusammenhalten will und dabei an unsichtbaren Grenzen entlang tastet. Die Töchter, die in ihren Blicken die Gegenwart des Protests tragen – die Weigerung, weiterhin zu schweigen, die Sehnsucht nach einem anderen Morgen. Nichts wirkt aufgesetzt, jede Geste sitzt, jede Pause spricht Bände. Dadurch gelingt es dem Film, uns nicht nur Zuschauende sein zu lassen, sondern Mitfühlende: Man versteht, warum sich alle so verhalten, obwohl man gerade dadurch die Grausamkeit vieler Entscheidungen umso stärker empfindet.
Ein Genie dieser Mohammad Rasoulof:
Formal arbeitet der Film klug und entschlossen: nahe Kameraführung, die den Atem der Figuren mitschneidet; ein Tonbild, das Stille als Druckmittel nutzt; ein Schnitt, der den Puls des Ausnahmezustands präzise trifft. Die Inszenierung verweigert die billige Katharsis und entscheidet sich für eine humanistische Strenge. Nichts wird sentimental weichgezeichnet, und doch ist da eine tiefe Zärtlichkeit für Menschen, die unter Bedingungen leben, die ihnen kaum Spielraum lassen. Diese Haltung macht den Film, bei aller Härte, zutiefst menschenfreundlich.
Der beste feministische Film aller Zeiten:
Gerade in seiner feministischen Dimension ist Die Saat des heiligen Feigenbaums herausragend. Der Film nimmt die Perspektiven der Frauen ernst, ohne sie zu symbolischen Projektionsflächen zu reduzieren. Er fragt mit unerbittlicher Klarheit: Warum klammern sich Männer – und die von ihnen geprägten Institutionen – so verbissen an Macht? Was nützen Regeln, wenn sie vor allem der Unterdrückung dienen? Die Antworten liefert der Film nicht in Reden, sondern in Situationen, in denen die Kosten dieser Macht sichtbar werden: in Angst, in Scham, in gebrochenen Beziehungen. So entsteht keine Parole, sondern Erkenntnis.
Fazit:
Dass ein solcher Film in seiner Heimat umstritten ist, überrascht kaum; Kritik an Herrschaftsstrukturen wird selten mit offenen Armen empfangen – nirgends auf der Welt. Aber gerade deswegen ist sein Dasein so wichtig. Die Saat des heiligen Feigenbaums zeigt, wie Kunst Räume öffnen kann, in denen wir das Unsagbare betrachten und das Unaussprechliche benennen. Er lehrt, ohne zu belehren; er klagt an, ohne zu moralisieren.
Für mich ist das ein nahezu makelloses Werk – intensiv, präzise, notwendig. Ein Film, der einen nicht loslässt und der die Frage stellt, die in Zeiten des Umbruchs die entscheidende ist: Was ist ein Leben wert, das auf Angst gebaut ist – und was wären wir bereit zu riskieren, um diese Angst zu überwinden?
bewertet am 30.07.25 um 12:25