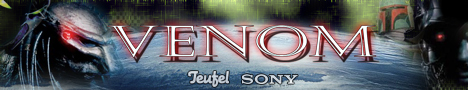Jede Menge "Last Minute Angebote" mit reduzierten Blu-rays bei Amazon.deMit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks: "Catch Me If You Can" ab 30.01. auf Ultra HD Blu-ray im SteelbookNur heute im Plaion Pictures Shop: 20% Rabatt auf alle Arthaus-FilmeIm März von Filmjuwelen: "Graveyard Shift" im 4K-Mediabook und "Panik um King Kong" auf Blu-rayWeltpremiere: "Keoma - Melodie des Sterbens" kommt auf Ultra HD Blu-ray im Mediabook heraus"Shine - Der Weg ins Licht": Ab 18. Dezember 2025 auf Ultra HD Blu-ray im limitierten MediabookEs geht los: Der "bluray-disc.de Weihnachtskalender 2025" mit mehr als 140 Preisen ist da!
NEWSTICKER
Blu-ray Forum → Blu−ray Talk, Kino & Filme, TV−Serien & Gewinnspiele → Blu−ray Filme & Kino
HD Sound Setzt er sich durch oder hat er es schon ?
Gestartet: 31 Okt 2009 17:24 - 185 Antworten
#181
Geschrieben: 27 Nov 2009 19:06
kluivert
Blu-ray Fan
Forenposts: 407
Clubposts: 2
seit 06.07.2008
Clubposts: 2
seit 06.07.2008
Samsung PS-50C7790
Sony PlayStation 3
Blu-ray Filme:
PS 3 Spiele:
Steelbooks:
1
zuletzt kommentiert:
House of Flying Daggers
House of Flying Daggers
Bedankte sich 68 mal.
kluivert ...
so, bringe mal neuen schwung hier rein:
http://www.beisammen.de/board/index.php?page=Thread&threadID=89030&pageNo=1
http://www.beisammen.de/board/index.php?page=Thread&threadID=89030&pageNo=1

#182
Geschrieben: 27 Nov 2009 19:19
Zitat:
Zitat von kluivert
so, bringe mal neuen schwung hier rein:http://www.beisammen.de/board/index.php?page=Thread&threadID=89030&pageNo=1
Sehr gute man!Genau das was ich befürchtet habe!
Nur der Mixer ist der Held!
#183
Geschrieben: 27 Nov 2009 21:23
karstenschilder
Blu-ray Starter
Forenposts: 414
seit 28.02.2008
seit 28.02.2008
Samsung LE-40C750
Sony BDP-S470
Blu-ray Filme:
zuletzt kommentiert:
Sonic Generations
Sonic Generations
zuletzt bewertet:
Arthur und die Minimoys
Arthur und die Minimoys
Bedankte sich 9 mal.
Ich denke auch, dass die neuen Formate bei aktuellen Aufnahmen
keinen wirklichen Vorteil bringen werden, gegenüber den alten
Formaten. Leider wird das theoretische Potential der Tonformate
auch nicht genutzt. Diesen sehe ich in der Unterstützung höherer
Abtastraten (192khz) und evtl. auch in den 24 statt 16 Bit. Gerade
bei viel chaotischer Dynamik (Durcheinander), dürfte eine höhere
Abtastrate eine bessere Differenzierbarkeit bringen.
Aber so lange wie weder Aufnahmetechnik noch Nachbearbeitung von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen, ist es sicher müßig, darüber zu diskutieren, was besser und was schlechter ist.
Aber so lange wie weder Aufnahmetechnik noch Nachbearbeitung von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen, ist es sicher müßig, darüber zu diskutieren, was besser und was schlechter ist.
#184
Geschrieben: 27 Nov 2009 21:35
Zitat:
Zitat von karstenschilder
Ich denke auch, dass die neuen Formate bei aktuellen Aufnahmen
keinen wirklichen Vorteil bringen werden, gegenüber den alten
Formaten. Leider wird das theoretische Potential der Tonformate
auch nicht genutzt. Diesen sehe ich in der Unterstützung höherer
Abtastraten (192khz) und evtl. auch in den 24 statt 16 Bit. Gerade
bei viel chaotischer Dynamik (Durcheinander), dürfte eine höhere
Abtastrate eine bessere Differenzierbarkeit bringen.Aber so lange wie weder Aufnahmetechnik noch Nachbearbeitung von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen, ist es sicher müßig, darüber zu diskutieren, was besser und was schlechter ist.
Da stimme ich dir voll und ganz zu!
#185
Geschrieben: 27 Nov 2009 22:21
Markus Pajonk
Blu-ray Papst
Essen
Forenposts: 12.916
Clubposts: 764
seit 26.10.2008
Clubposts: 764
seit 26.10.2008
Planar PD8150
OPPO BDP-105EU
zuletzt kommentiert:
Cambridge Audio veröffentlicht ersten 3D-fähigen Blu-ray Player
Cambridge Audio veröffentlicht ersten 3D-fähigen Blu-ray Player
zuletzt bewertet:
bluray-disc.de präsentiert die Frühlingsausgabe des "Blulife"-Magazins - Jetzt downloaden!
bluray-disc.de präsentiert die Frühlingsausgabe des "Blulife"-Magazins - Jetzt downloaden!
Bedankte sich 2096 mal.
Markus Pajonk Aktuell keine Lust auf Kreis-Dreh-Diskussionen. Schöne Zeit!
Was wird denn die ganze Zeit hier gesagt? Die Ansatzpunkte sind
andere als ein neuer Standard, zunächst das ausreizen des aktuell
gültigen Standards wäre schon ein gewaltiger Fortschritt.
Der Mensch wächst
mit seinen Problemen! Hier bin ich.
(Eigenzitat)
#186
Geschrieben: 27 Nov 2009 23:10
kekskruemel
Blu-ray Junkie
Nürnberg
Forenposts: 4.713
Clubposts: 19
seit 19.01.2008
Clubposts: 19
seit 19.01.2008
Samsung KU-6519
Benq W7500
LG BP420
Blu-ray Filme:
Steelbooks:
6
Mediabooks:
3
zuletzt kommentiert:
Der Grinch (2000) 4K (4K UHD + Blu-ray + UV Copy)
Der Grinch (2000) 4K (4K UHD + Blu-ray + UV Copy)
zuletzt bewertet:
Moontrap - Angriffsziel Erde
Moontrap - Angriffsziel Erde
Bedankte sich 2409 mal.
kekskruemel beamt endlich in 3D + HD auf 3,50 m
Der Artikel ist interessant und enthält viele Wahrheiten, wenn er
auch nicht ganz auf dem Stand der Technik ist.
So wird zum Beispiel formuliert, dass im Kino sowieso nur niedrige Bitraten gefahren werden, weil die DD und auch die SDDS und DTS Spuren hier nur geringe Bitraten erlauben.
Ist für 35 mm Kopien richtig, doch seit in manchen Kinos auch digital projiziert wird, und sowohl das Bild als auch der Ton von der Festplatte kommt, ist der Ton nicht mehr beschränkt auf lossy Codecs wie DD oder DTS oder SDDS. Die DCI Spezifikation, die hier bei der Verschlüsselung und Wiedergabe der Files zum Zuge kommt, kennt eigentlich nur PCM-Ton. Und zwar bis zu 16.1 Kanäle und 48, 96, und 192 kHz Abtastrate, verbunden mit 16, 20 oder 24 Bit Festkomma.
Dass bei Mischungen das Signal grundsätzlich mal reduziert wird, kann man zumindest heutzutage und bei den Majors mal als Gerücht abstempeln. Selbst die preiswerten Homerecording Digitalmischpulte verarbeiten problemlos 96 kHz und rechnen beim Mischvorgang intern mit wenigstens 40 Bit floating point, einige Pulte mit 64 Bit Festkomma (und das sind immer noch relativ preiswerte Homerecordingpulte).
Digitale Mischungen werden eigentlich erst dann so richtig übel, wenn sie komplett am PC mit Hobbyvideoschnittsoftware oder Hobbymusikersoftware wie Magix Video Deluxe oder Music Studio o.ä. gemischt werden - denn diese Programme arbeiten intern tatsächlich nur mit 24 oder 16 Bit (auch in den Effekt Plugins) - und das wird schnell eng, wenn man mal bei ein paar Frequenzen etwas am Equalizer schraubt und noch dynamische Kompression macht.
Für ziemlich vernachlässigbar halte ich auch die Frage nach der Güte der Mikrofone. Frequenzgang ist erstens nicht alles. Und zweitens wissen die wenigsten, was Frequenzgang wirklich heißt. Das Frequenzspektrum eines digitalen Bauteils endet nach oben hin ziemlich genau bei seiner oberen Grenzfrequenz (bedingt durch das Abtasttheorem: größte maximal nutzbare Frequenz ist gleich Abtastfrequenz geteilt durch 2). Ein A/D Wandler mit 20Hz - 20kHz liefert ein Spektrum, das genau von 20 Hz bis 20 kHz Frequenzen enthält. Der Frequenzgang eines analogen Bauteils, sagen wir eines Tonbandgerätes mit einem Frequenzgang von 50-16 kHz heißt eben NICHT, dass das Tonbandgerät keine 17 und 18 kHz Frequenzen mehr speichert, sondern dass nur im Bereich zwischen 50-16.000 Hz die Speicherung MIT ETWA GLEICHEM WIRKUNGSGRAD geschieht. Tonbandgeräte mit Frequenzgang bis 16 kHz sind (bei entsprechender Güte der Bauteile) durchaus in der Lage auch Frequenzen um 30 kHz aufzuzeichnen - nur eben nicht mehr mit dem selben Wirkungsgrad, will sagen, mit deutlich schwächerem Pegel.
Was heißt das? Das heißt, dass der Frequenzgang bei analogen Bauteilen keine Auskunft darüber gibt, wie viele Frequenzen nach oben hin noch mit übertragen werden. Typische Argumentation: "die Mikros gehen im Frequenzgang ja bloß bis 20 kHz, also wenn man den von diesen Mikros kommenden Ton digitalisiert mit 44,1kHz (und "digitalem" F-Gang bis 20kHz), dann hat man ja alles drauf". Ist leider falsch, da der F-Gang des analogen Bauteils "Mikrofon" nur aussagt, dass bis 20k die Pegel der Frequenzen einigermaßen gleich bleiben. Das 20Hz-20kHz Mikro ist aber in der Lage auch 30kHz und eventuell sogar 40kHz Frequenzen zu übertragen. Somit geht bei der Digitalisierung mit Ziel-F-Gang 20-20k durchaus Information verloren.
Ob sie hörbar ist, ist eine andere Frage. Es geht, das möchte ich noch anmerken, aber nicht nur um konstante Frequenzen, sondern auch um steile Anstiege im Signal und Impulse sowie Impulstreue...
ich schweife ab.
Wahr ist: bei der Aufnahme von O-Ton (Dialoge am Set) wird heutzutage selten mit Frequenzen über 48kHz gesamplet. Schöner wärs. Geschieht aber (noch) nicht so häufig. Die Aufnahme des Soundtracks (Musik) geschieht schon eher mit 192 kHz oder eventuell sogar mit 1-bit DSD Formaten (entweder 2,8xx oder 5,6xx Mhz fs). Bei den Sound-Effekten, zusätzlichen Geräuschen bedient man sich ab und an aus Soundlibrarys mit minderer (44,1 kHz) Samplingrate, teilweise geht man aber schon in die Richtung, dass man neue Soundlibrarys mit höherer fs erstellt.
Wahr ist auch, dass manchmal der DD oder DTS Ton der DVD-Ausgabe einfach nur gestretcht (25->24fps) und in einen äußerlich höherwertig aussehenden Track (DTS-HD HR oder sowas) umverpackt wird (ohne technischen Gewinn und nur aus Marketinggründen).
Wahr ist auch, dass neuere (MP3-) Encoder effizienter sind, als ältere. Und die neuen daher bessere Qualität liefern - bei gleicher Bitrate. Das liegt aber weniger am Format MP3, sondern am Encodingvorgang.
Bißchen merkwürdig finde ich, dass der Autor nur auf frequenztechnische Aspekte der lossy (MP3) Codierung eingeht und behauptet, der Klang (den er hier seiner Argumentation folgend mit "Frequenzspektrum" gleichsetzt) verändere sich weitgehend nicht. Ich finde dass sich der Klang (sowohl spektral betrachtet - also frequenztechnisch) als auch in seinem ZEITLICHEN Verlauf durch die Komprimierung sehr verändert. Impulse kommen eben nicht mehr akkurat, blitzartig sondern werden so "verschmiert". Das ist aber ein Problem des zeitlichen Verlaufs des Signals. Die MP3 Komprimierung nutzt zum einen den rein pegeltechnischen Maskierungseffekt, aber auch zeitliche psychoakustische Phänomene, um Daten zu entsorgen. Und diese zeitliche Verunschärfung geht schon auch zu Lasten des Klangs.
Was jetzt mit diesen Anlistungen und Vergleichen gemeint sein soll, verstehe ich eher gar nicht. Wer sagt denn dass 640 kbps DD (und dann auch noch "Plus") vergleichbar sein soll mit 128 kbps AAC? Woher kommt das? Ausgedacht? Gefühlt?
Merkwürdig. :eek:
So wird zum Beispiel formuliert, dass im Kino sowieso nur niedrige Bitraten gefahren werden, weil die DD und auch die SDDS und DTS Spuren hier nur geringe Bitraten erlauben.
Ist für 35 mm Kopien richtig, doch seit in manchen Kinos auch digital projiziert wird, und sowohl das Bild als auch der Ton von der Festplatte kommt, ist der Ton nicht mehr beschränkt auf lossy Codecs wie DD oder DTS oder SDDS. Die DCI Spezifikation, die hier bei der Verschlüsselung und Wiedergabe der Files zum Zuge kommt, kennt eigentlich nur PCM-Ton. Und zwar bis zu 16.1 Kanäle und 48, 96, und 192 kHz Abtastrate, verbunden mit 16, 20 oder 24 Bit Festkomma.
Dass bei Mischungen das Signal grundsätzlich mal reduziert wird, kann man zumindest heutzutage und bei den Majors mal als Gerücht abstempeln. Selbst die preiswerten Homerecording Digitalmischpulte verarbeiten problemlos 96 kHz und rechnen beim Mischvorgang intern mit wenigstens 40 Bit floating point, einige Pulte mit 64 Bit Festkomma (und das sind immer noch relativ preiswerte Homerecordingpulte).
Digitale Mischungen werden eigentlich erst dann so richtig übel, wenn sie komplett am PC mit Hobbyvideoschnittsoftware oder Hobbymusikersoftware wie Magix Video Deluxe oder Music Studio o.ä. gemischt werden - denn diese Programme arbeiten intern tatsächlich nur mit 24 oder 16 Bit (auch in den Effekt Plugins) - und das wird schnell eng, wenn man mal bei ein paar Frequenzen etwas am Equalizer schraubt und noch dynamische Kompression macht.
Für ziemlich vernachlässigbar halte ich auch die Frage nach der Güte der Mikrofone. Frequenzgang ist erstens nicht alles. Und zweitens wissen die wenigsten, was Frequenzgang wirklich heißt. Das Frequenzspektrum eines digitalen Bauteils endet nach oben hin ziemlich genau bei seiner oberen Grenzfrequenz (bedingt durch das Abtasttheorem: größte maximal nutzbare Frequenz ist gleich Abtastfrequenz geteilt durch 2). Ein A/D Wandler mit 20Hz - 20kHz liefert ein Spektrum, das genau von 20 Hz bis 20 kHz Frequenzen enthält. Der Frequenzgang eines analogen Bauteils, sagen wir eines Tonbandgerätes mit einem Frequenzgang von 50-16 kHz heißt eben NICHT, dass das Tonbandgerät keine 17 und 18 kHz Frequenzen mehr speichert, sondern dass nur im Bereich zwischen 50-16.000 Hz die Speicherung MIT ETWA GLEICHEM WIRKUNGSGRAD geschieht. Tonbandgeräte mit Frequenzgang bis 16 kHz sind (bei entsprechender Güte der Bauteile) durchaus in der Lage auch Frequenzen um 30 kHz aufzuzeichnen - nur eben nicht mehr mit dem selben Wirkungsgrad, will sagen, mit deutlich schwächerem Pegel.
Was heißt das? Das heißt, dass der Frequenzgang bei analogen Bauteilen keine Auskunft darüber gibt, wie viele Frequenzen nach oben hin noch mit übertragen werden. Typische Argumentation: "die Mikros gehen im Frequenzgang ja bloß bis 20 kHz, also wenn man den von diesen Mikros kommenden Ton digitalisiert mit 44,1kHz (und "digitalem" F-Gang bis 20kHz), dann hat man ja alles drauf". Ist leider falsch, da der F-Gang des analogen Bauteils "Mikrofon" nur aussagt, dass bis 20k die Pegel der Frequenzen einigermaßen gleich bleiben. Das 20Hz-20kHz Mikro ist aber in der Lage auch 30kHz und eventuell sogar 40kHz Frequenzen zu übertragen. Somit geht bei der Digitalisierung mit Ziel-F-Gang 20-20k durchaus Information verloren.
Ob sie hörbar ist, ist eine andere Frage. Es geht, das möchte ich noch anmerken, aber nicht nur um konstante Frequenzen, sondern auch um steile Anstiege im Signal und Impulse sowie Impulstreue...
ich schweife ab.
Wahr ist: bei der Aufnahme von O-Ton (Dialoge am Set) wird heutzutage selten mit Frequenzen über 48kHz gesamplet. Schöner wärs. Geschieht aber (noch) nicht so häufig. Die Aufnahme des Soundtracks (Musik) geschieht schon eher mit 192 kHz oder eventuell sogar mit 1-bit DSD Formaten (entweder 2,8xx oder 5,6xx Mhz fs). Bei den Sound-Effekten, zusätzlichen Geräuschen bedient man sich ab und an aus Soundlibrarys mit minderer (44,1 kHz) Samplingrate, teilweise geht man aber schon in die Richtung, dass man neue Soundlibrarys mit höherer fs erstellt.
Wahr ist auch, dass manchmal der DD oder DTS Ton der DVD-Ausgabe einfach nur gestretcht (25->24fps) und in einen äußerlich höherwertig aussehenden Track (DTS-HD HR oder sowas) umverpackt wird (ohne technischen Gewinn und nur aus Marketinggründen).
Wahr ist auch, dass neuere (MP3-) Encoder effizienter sind, als ältere. Und die neuen daher bessere Qualität liefern - bei gleicher Bitrate. Das liegt aber weniger am Format MP3, sondern am Encodingvorgang.
Bißchen merkwürdig finde ich, dass der Autor nur auf frequenztechnische Aspekte der lossy (MP3) Codierung eingeht und behauptet, der Klang (den er hier seiner Argumentation folgend mit "Frequenzspektrum" gleichsetzt) verändere sich weitgehend nicht. Ich finde dass sich der Klang (sowohl spektral betrachtet - also frequenztechnisch) als auch in seinem ZEITLICHEN Verlauf durch die Komprimierung sehr verändert. Impulse kommen eben nicht mehr akkurat, blitzartig sondern werden so "verschmiert". Das ist aber ein Problem des zeitlichen Verlaufs des Signals. Die MP3 Komprimierung nutzt zum einen den rein pegeltechnischen Maskierungseffekt, aber auch zeitliche psychoakustische Phänomene, um Daten zu entsorgen. Und diese zeitliche Verunschärfung geht schon auch zu Lasten des Klangs.
Zitat:
DD+ mit 640kbps wäre gleich zu setzen mit einem
2-Kanal-AAC zwischen 96 und 128kbps
Was jetzt mit diesen Anlistungen und Vergleichen gemeint sein soll, verstehe ich eher gar nicht. Wer sagt denn dass 640 kbps DD (und dann auch noch "Plus") vergleichbar sein soll mit 128 kbps AAC? Woher kommt das? Ausgedacht? Gefühlt?
Merkwürdig. :eek:
Blu-ray Forum → Blu−ray Talk, Kino & Filme, TV−Serien & Gewinnspiele → Blu−ray Filme & Kino
Es sind 108 Benutzer und 11665 Gäste online.